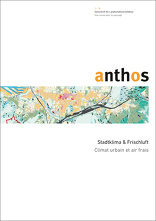Zeitschrift
anthos 2018/03
Stadtklima & Frischluft

Hitze in Städten
Die voranschreitende Klimaveränderung bewirkt eine zunehmende Hitzebelastung in Städten. Die Schweiz liegt bezüglich der weltweiten Erwärmung gar über dem Durchschnitt, steht in der Vorsorge aber mehrheitlich erst am Anfang. Die klimaangepasste Siedlungsentwicklung stellt eine grosse planerische Herausforderung dar und ist ein wichtiges Aufgabenfeld für unseren Berufsstand.
10. September 2018 - Cordula Weber
Das städtische Phänomen der städtischen Hitzeinseln belastet tagsüber die Aufenthalts- und Lebensqualität. Tropennächte von über 20 Grad Celsius bergen gesundheitliche Risiken für die Bevölkerung. Die Sterblichkeit war in den extrem heissen Sommermonaten der Jahre 2003 und 2015 nachweislich erhöht. Die Schweiz gehört weltweit zu den Regionen, in denen die Hitzetage über die letzten Jahrzehnte am meisten zugenommen haben. Die Klimaerwärmung wird die Anzahl der Hitzewellen weiter erhöhen: Modellrechnungen von MeteoSchweiz zeigen, dass Hitzewellen wie jene von 2003 und 2015 ab Mitte des Jahrhunderts je nach Region jährlich vorkommen können. Aktuell erarbeitet MeteoSchweiz gemein-sam mit Forschungsinstitutionen neue Klimaszenarien «CH2018», die Ende Jahr veröffentlicht werden.
Die Betroffenheit nimmt zu – wie reagiert der Bund?
Mit der Klimaerwärmung erhöht sich die Hitze im Siedlungsgebiet. Die bauliche Verdichtung führt zudem meist zu einem Verlust an Strukturen und Elementen, welche der Hitze entgegenwirken. Über 82 Prozent der Bevölkerung lebten 2015 bereits in Räumen mit städtischem Charakter, Tendenz steigend. Die Betroffenheit durch Hitze im Siedlungsraum wird also aufgrund der Entwicklungen weiter steigen. Der Bundesrat sieht gemäss seiner Strategie «Anpassung an den Klimawandel» von 2012 daher die Hitzebelastung als eine der grössten sektorübergreifenden Aufgaben in Städten und Agglomerationen. Massnahmen sind im Aktionsplan für die Periode 2014 bis 2019 beschrieben. Das BAFU lancierte ein Pilotprogramm, um die Umsetzung der Strategie anzustossen. Von 2014 bis 2017 wurden zum Thema der klimaangepassten Stadt- und Siedlungsentwicklung folgende Projekte erarbeitet:
– ACCLIMATASION – eine klimaangepasste Stadtentwicklung für Sitten,
– Urban Green & Climate Bern − die Rolle und Bewirtschaftung von Bäumen in einer klimaangepassten Stadtentwicklung,
– Effekt von Hitzeperioden auf die Sterblichkeit und mögliche Adaptionsmassnahmen.
Ausgewählte Projekte für die zweite Programmphase des Pilotprogramms von 2018 bis 2022 befinden sich momentan in Konkretisierung.
Mit dem Bericht «Hitze in Städten – Grundlage für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung» stellt das BAFU im Herbst 2018 den verantwortlichen Behörden und Planenden einen unterstützenden Leitfaden zur Verfügung, der in die Thematik einführt und Entscheidungshilfen bietet. Basierend auf Best-Practice-Analysen von ausgewählten Städten im Ausland werden Planungsgrundsätze, städtebauliche Leitsätze und lokale Massnahmen aufgezeigt sowie Erfolgsfaktoren der Hitzevorsorge benannt.
Beispiele aus der Schweiz
Nachfolgende ausgewählte Schweizer Beispiele zeigen den Umgang mit Luft in der klimaangepassten Siedlungsentwicklung auf. Das Lufthygieneamt beider Basel und die Planungsämter Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft lösten im Jahr 1998 die Klimaanalyse Basel KABA aus. Diese für raumplanerische Zwecke durchgeführte Analyse zeigt Gebiete mit starker Überwärmung und schlechter Durchlüftung auf. Sie diente als Grundlage für Planungsempfehlungen und zur Beurteilung von Bebauungsplänen. Die Klimaanalyse konnte die städtebauliche Entwicklung im Areal Erlenmatt erfolgreich beeinflussen, indem die Gebäudeausrichtung gezielt auf die Frischluftzufuhr aus dem Wiesental in Nord-Süd-Richtung Rücksicht nahm. Derzeit wird für das Kantonsgebiet Basel-Stadt eine Modellierung der mikroklimatischen Verhältnisse in einer 10-Meter-Rasterauflösung durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Analyse soll eine Planungshinweiskarte erstellt werden, welche räumlich verortete Handlungsempfehlungen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung liefert. Sie wird zudem auch die Grundlage für den strategischen «Rahmenplan Stadtklima» bilden, welcher wiederum in den kantonalen Richt- und in den Luftreinhalteplan einfliesst.
Die Stadt Zürich liess im Jahr 2010 eine Klimaanalyse KLAZ erstellen. Dabei wurden unter anderem mesoskalige1 und lokale Windsysteme im Hinblick auf die thermische Situation, die Luftqualität und die Durchlüftung analysiert und bewertet. Die Erkenntnisse aus KLAZ sind als Handlungsanweisungen in übergeordnete Instrumente wie die «Räumliche Entwicklungsstrategie RES» oder die regionale Richtplanung eingeflossen. In «Planen und Bauen im Einklang mit dem Stadtklima» regen fünf Grundsätze die planerische Umsetzung an. Bei konkreten Projekten zeigt jedoch die Empfehlung wegen fehlender konkreter Vorgaben und Verbindlichkeit nicht immer die erzielte Wirkung: Die Vorgabe «Errichtung bedeutsamer Strömungshindernisse wie Gebäuderiegel vermeiden» wurde zum Beispiel in der Jurierung des qualitativen Verfahrens zur Überbauung an der Tièchestrasse in Zürich nicht gebührend berücksichtigt. Aktuell erarbeitet die Verwaltung einen vom Parlament in Auftrag gegebenen «Masterplan Stadtklima», welcher sich auf die Grundlage der kantonalen Klimaanalyse abstützt. Er wird einen Leitplan, einen Massnahmenkatalog und eine Umsetzungsstrategie mit Kompensationsmassnahmen enthalten.
Der Kanton Zürich stellt seit Sommer 2018 eine mesoskalige Klimaanalyse in der Auflösung von 25 Metern zu Verfügung. Zentrales Ergebnis bilden die Planungshinweiskarten, welche räumlich konkrete Informationen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung liefern und Handlungsempfehlungen verorten. Die Gemeinden können auf beispielhafte und sehr präzise Analysen zu Lufttemperatur und Durchlüftung, Tag- und Nachtsituation sowie Bioklimaindikatoren zugreifen, um ihre Anpassungsmassnahmen zu entwickeln.
Eine planerische Herausforderung
Forscher der ETH Zürich bezeichnen im Bericht «Brennpunkt Klima Schweiz» von 2016 die Hitzeentlastung und -vorsorge als grosse Herausforderung in der klimaangepassten Siedlungsentwicklung. Die Schweiz steht hier im internationalen Vergleich mehrheitlich erst am Anfang. Die Sicherung der grünen und blauen Infrastruktur, die Nutzung von Synergien und die Verankerung von wirkungsvollen Massnahmen bilden daher ein zentrales und gewichtiges Aufgabenfeld für die Fachdisziplin der Landschaftsarchitektur – sowohl in der konzeptionellen Planung, der Sensibilisierung und Beratung als auch in der baulichen Umsetzung von klimaangepassten Projekten im Siedlungsraum.
Die Betroffenheit nimmt zu – wie reagiert der Bund?
Mit der Klimaerwärmung erhöht sich die Hitze im Siedlungsgebiet. Die bauliche Verdichtung führt zudem meist zu einem Verlust an Strukturen und Elementen, welche der Hitze entgegenwirken. Über 82 Prozent der Bevölkerung lebten 2015 bereits in Räumen mit städtischem Charakter, Tendenz steigend. Die Betroffenheit durch Hitze im Siedlungsraum wird also aufgrund der Entwicklungen weiter steigen. Der Bundesrat sieht gemäss seiner Strategie «Anpassung an den Klimawandel» von 2012 daher die Hitzebelastung als eine der grössten sektorübergreifenden Aufgaben in Städten und Agglomerationen. Massnahmen sind im Aktionsplan für die Periode 2014 bis 2019 beschrieben. Das BAFU lancierte ein Pilotprogramm, um die Umsetzung der Strategie anzustossen. Von 2014 bis 2017 wurden zum Thema der klimaangepassten Stadt- und Siedlungsentwicklung folgende Projekte erarbeitet:
– ACCLIMATASION – eine klimaangepasste Stadtentwicklung für Sitten,
– Urban Green & Climate Bern − die Rolle und Bewirtschaftung von Bäumen in einer klimaangepassten Stadtentwicklung,
– Effekt von Hitzeperioden auf die Sterblichkeit und mögliche Adaptionsmassnahmen.
Ausgewählte Projekte für die zweite Programmphase des Pilotprogramms von 2018 bis 2022 befinden sich momentan in Konkretisierung.
Mit dem Bericht «Hitze in Städten – Grundlage für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung» stellt das BAFU im Herbst 2018 den verantwortlichen Behörden und Planenden einen unterstützenden Leitfaden zur Verfügung, der in die Thematik einführt und Entscheidungshilfen bietet. Basierend auf Best-Practice-Analysen von ausgewählten Städten im Ausland werden Planungsgrundsätze, städtebauliche Leitsätze und lokale Massnahmen aufgezeigt sowie Erfolgsfaktoren der Hitzevorsorge benannt.
Beispiele aus der Schweiz
Nachfolgende ausgewählte Schweizer Beispiele zeigen den Umgang mit Luft in der klimaangepassten Siedlungsentwicklung auf. Das Lufthygieneamt beider Basel und die Planungsämter Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft lösten im Jahr 1998 die Klimaanalyse Basel KABA aus. Diese für raumplanerische Zwecke durchgeführte Analyse zeigt Gebiete mit starker Überwärmung und schlechter Durchlüftung auf. Sie diente als Grundlage für Planungsempfehlungen und zur Beurteilung von Bebauungsplänen. Die Klimaanalyse konnte die städtebauliche Entwicklung im Areal Erlenmatt erfolgreich beeinflussen, indem die Gebäudeausrichtung gezielt auf die Frischluftzufuhr aus dem Wiesental in Nord-Süd-Richtung Rücksicht nahm. Derzeit wird für das Kantonsgebiet Basel-Stadt eine Modellierung der mikroklimatischen Verhältnisse in einer 10-Meter-Rasterauflösung durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Analyse soll eine Planungshinweiskarte erstellt werden, welche räumlich verortete Handlungsempfehlungen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung liefert. Sie wird zudem auch die Grundlage für den strategischen «Rahmenplan Stadtklima» bilden, welcher wiederum in den kantonalen Richt- und in den Luftreinhalteplan einfliesst.
Die Stadt Zürich liess im Jahr 2010 eine Klimaanalyse KLAZ erstellen. Dabei wurden unter anderem mesoskalige1 und lokale Windsysteme im Hinblick auf die thermische Situation, die Luftqualität und die Durchlüftung analysiert und bewertet. Die Erkenntnisse aus KLAZ sind als Handlungsanweisungen in übergeordnete Instrumente wie die «Räumliche Entwicklungsstrategie RES» oder die regionale Richtplanung eingeflossen. In «Planen und Bauen im Einklang mit dem Stadtklima» regen fünf Grundsätze die planerische Umsetzung an. Bei konkreten Projekten zeigt jedoch die Empfehlung wegen fehlender konkreter Vorgaben und Verbindlichkeit nicht immer die erzielte Wirkung: Die Vorgabe «Errichtung bedeutsamer Strömungshindernisse wie Gebäuderiegel vermeiden» wurde zum Beispiel in der Jurierung des qualitativen Verfahrens zur Überbauung an der Tièchestrasse in Zürich nicht gebührend berücksichtigt. Aktuell erarbeitet die Verwaltung einen vom Parlament in Auftrag gegebenen «Masterplan Stadtklima», welcher sich auf die Grundlage der kantonalen Klimaanalyse abstützt. Er wird einen Leitplan, einen Massnahmenkatalog und eine Umsetzungsstrategie mit Kompensationsmassnahmen enthalten.
Der Kanton Zürich stellt seit Sommer 2018 eine mesoskalige Klimaanalyse in der Auflösung von 25 Metern zu Verfügung. Zentrales Ergebnis bilden die Planungshinweiskarten, welche räumlich konkrete Informationen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung liefern und Handlungsempfehlungen verorten. Die Gemeinden können auf beispielhafte und sehr präzise Analysen zu Lufttemperatur und Durchlüftung, Tag- und Nachtsituation sowie Bioklimaindikatoren zugreifen, um ihre Anpassungsmassnahmen zu entwickeln.
Eine planerische Herausforderung
Forscher der ETH Zürich bezeichnen im Bericht «Brennpunkt Klima Schweiz» von 2016 die Hitzeentlastung und -vorsorge als grosse Herausforderung in der klimaangepassten Siedlungsentwicklung. Die Schweiz steht hier im internationalen Vergleich mehrheitlich erst am Anfang. Die Sicherung der grünen und blauen Infrastruktur, die Nutzung von Synergien und die Verankerung von wirkungsvollen Massnahmen bilden daher ein zentrales und gewichtiges Aufgabenfeld für die Fachdisziplin der Landschaftsarchitektur – sowohl in der konzeptionellen Planung, der Sensibilisierung und Beratung als auch in der baulichen Umsetzung von klimaangepassten Projekten im Siedlungsraum.
Für den Beitrag verantwortlich: anthos
Ansprechpartner:in für diese Seite: Daniel Haid