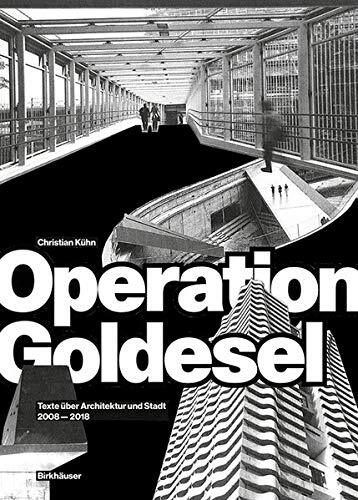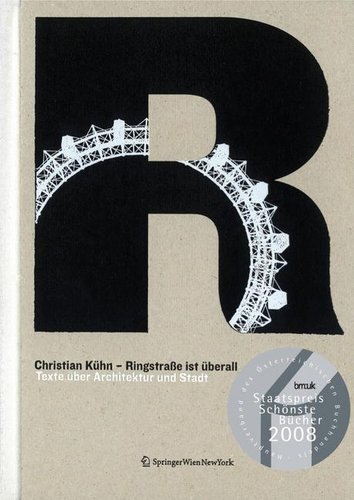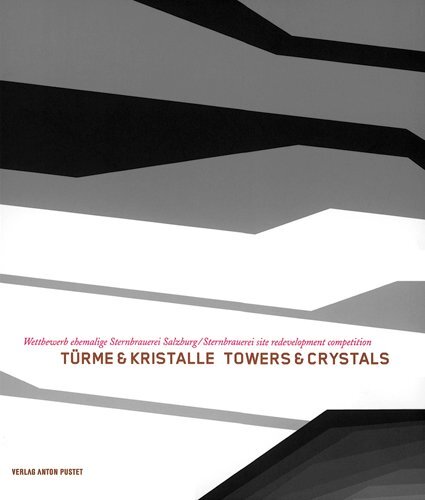Wer baut Wien? Unter diesem Titel publizierte Reinhard Seiß 2007 sein Sittenpanorama der Wiener Stadtplanung seit den 1980er-Jahren. Das Skandalöse an diesem Titel war die Frage nach dem „Wer“: Gibt es überhaupt noch so etwas wie persönliche Verantwortung im Städtebau? Baut sich die Stadt nicht längst selbst, in einem Strom systemisch verknoteter, unkontrollierbarer Prozesse, die sich jedem individuellen Zugriff entziehen? Seiß hat nachgewiesen, dass diese Darstellung der Dinge falsch ist und vor allem ein Ziel verfolgt: die für die Stadtplanung grundlegende Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Interessen zu vernebeln. Für die Jahre bis 2007 konnte Seiß an zahlreichen Wiener Beispielen nachweisen, wie sich in diesem Nebel gute Geschäfte machen ließen, von denen Investoren, Parteifreunde und Beamte profitierten.
Seither hat sich viel geändert. Das Jahr 2010 markiert den Beginn einer rot-grünen Koalition, deren Juniorpartner für die Stadtplanung verantwortlich ist. Das Bekenntnis zur Stadt, das Maria Vassilakou kurz nach ihremAmtsantritt ablegte, klang authentisch. Die Stadt ließ ihr auch keine Wahl, da sie beschlossen hatte, heftig zu wachsen. Das wirft Fragen nach Bebauungsdichten und -höhenauf, die zu den Idealen mancher grüner Parteigänger – für die ein Haus grundsätzlich nicht höher zu sein hat als ein Baum – deutlich im Widerspruch stehen. Dass sich das Hochhaus in den Jahren der rot-grünen Koalition vom Exoten zu einem Normalfall der Stadtverdichtung entwickelt hat, ist jedenfalls bemerkenswert.
Die bisherigen Leitlinien für den Bau vonHochhäusern stammen aus dem Jahr 2002 und waren kein Konzept, sondern ein Patchwork, mit Angaben über Ausschlusszonen, freizuhaltende Sichtachsen und einer Definition von Eignungszonen, die der Spekulation mehr als genug Raum ließ: „Alle nicht als Ausschlusszonen deklarierten Stadtbereiche sind potenzielle Eignungszonen.“ Zusätzliche Vorgabe war das Vorhandensein einer „höherrangigen“ öffentlichen Verkehrsanbindung – ein Konzept, das spitze Kommentare geradezu herausforderte: Kann in Wien ein Hochhaus gebaut werden, wo immer sich zwei Straßenbahnlinien kreuzen und keine Ausschlusszone vorliegt? Städtebauliche Leitbilder sollten erst im Lauf der Projektentwicklung für ein konkretes Hochhaus entstehen, was gewissermaßen eine Schubumkehr der Stadtplanung bedeutet: Statt vom Leitbild gesteuert zu werden, schafft das Projekt sich sein Leitbild selbst.
Dieses Hochhauskonzept aus dem Jahr 2002 war das dritte, das die Stadt Wien in Auftrag gegeben hatte. Das erste wurde 30 Jahre zuvor von Hugo Potyka verfasst. Es lieferte 1972 einen auf einer minutiösen Analyse von Topografie, Verkehr und Stadtstruktur aufbauenden städtebaulichen Entwurf, der geeignete Standorte und verträgliche Höhen festlegte, durchaus mit dem Ziel, mit einigen dieser Objekte Dominanten zu setzen, so wie es expressionistische Architekten wie Bruno Taut in den 1920er-Jahren mit ihrer Idee der „Stadtkrone“ getan hatten. Auf besonderes Interesse stieß dieses Konzept nicht. Im Gegenteil: Ende der 1980er-Jahre herrschte in den für die Stadtentwicklung zuständigen Abteilungen des Wiener Magistrats geradezu eine Hochhausphobie. Dass Wien seine eigene, kleine Tradition im Hochhausbau besaß, wurde verdrängt. Hochhäuser aus den 1950er-Jahren wie der Ringturm und das Hochhaus am Matzleinsdorfer Platz – als Theodor-Körner-Hof hochrangig tituliert – wurden zu ihrer Zeit als Wahrzeichen des Wiederaufbaus verstanden. Auch das erste Wiener Hochhaus in der Herrengasse, ein Entwurf der Architekten Theiss und Jaksch aus dem Jahr 1932, war nicht nur ein elegantes bürgerliches Wohnhaus im Stil einer moderaten Moderne, sondern auch ein Politikum.
Erste Ideen, Hochhäuser auch im Rahmen des sozialen Wohnbaus zu errichten, gab es bereits Mitte der 1920er-Jahre. Es blieb freilich bei vertikalen Gesten – wie beim Reumann-Hof aus dem Jahr 1926, für dessen Zentrum Hubert Gessner ursprünglich ein zwölfgeschoßiges Hochhaus geplant hatte. Stadtrat Franz Siegel („Persönlich bin ich prinzipiell gegen das Hochhaus“) entschied, den Leuchtturm des aufstrebenden Proletariats nicht zu bauen.
Zwei Jahre später hatten sich die Dinge geändert: 1928 fand ein Wettbewerb für ein Hochhaus an der Ecke Währingerstraße/Spitalgasse, also auf dem Gelände des heutigen Arne-Carlsson-Parks statt, mit dem sich die Sozialdemokratie ein Denkmal setzen wollte. Neben 245 Wohnungen sollte das Haus eine Bibliothek, die Zentrale der Wiener Stadtwerke, ein Jugendheim, Postamt, Kindergärten und Künstlerateliers enthalten. Der Wagner-Schüler Rudolf Fraß gewann den Wettbewerb mit einem expressionistischen Entwurf, der breite Zustimmung fand.
Ende 1930 waren die Ausführungspläne fertiggestellt, Brandschutz- und Windkanalversuche positiv abgeschlossen. Zu dem für das Frühjahr 1931 vorgesehenen Spatenstich kam es jedoch nicht. Die dem roten kommunalen Wohnbau äußerst feindselig gestimmte schwarze Bundesregierung beschloss einen neuen Finanzausgleich, der den Wiener sozialen Wohnbau zugunsten Niederösterreichs praktisch zum Erliegen brachte. Als dann die bereits bewilligten Mittel aus der Bundeswohnbauförderung in das Hochhausprojekt in der Herrengasse umgeleitet wurden, legten die Sozialdemokraten ihre Hochhauspläne zu den Akten. Das bürgerliche Lager hatte den Wettlauf um das erste Hochhaus gewonnen. Öffentliche Flächen beschränkten sich hier auf ein Tanzcafé in den obersten beiden Geschoßen. Ende der 1960er-Jahre wurde auch dieses in Wohnungen umgewidmet.
Die ausführliche Darstellung dieser Geschichte findet sich im zweiten Wiener Hochhauskonzept, das Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky von Coop Himmelb(l)au 1992 gemeinsam mit Michael Wagner-Pinter vom Forschungsinstitut Synthesis und zahlreichen Partnern wie Max Rieder, Hans Peter Wörndl und Jan Tabor erstellten. Der Auftrag dafür kam vom damaligen Planungsstadtrat, Hannes Swoboda, der den Magistrat von seiner Hochhausphobie kurieren wollte. Coop Himmelb(l)au, der Stadt spätestens nach der Erfahrung mit dem gescheiterten Projekt des Ronacher-Umbaus in Hassliebe verbunden, produzierte mit ihren Partnern ein dreibändiges Werk, das, kostbar gebunden, nur in wenigen Exemplaren aufgelegt wurde. Das provokante Großformat war darauf angelegt, in keinen Papierkorb zu passen und so der raschen bürokratischen Entsorgung zu entgehen.
Inhaltlich hätte die „Wiener Hochhausstudie“ diese Überhöhung nicht gebraucht. Sie geht das Thema in voller Breite an, von der Geschichte des Hochhauses über städtebauliche und konstruktive Fragen bis hin zum Planungsprozess und zur Sozialverträglichkeit. Gefordert werden die programmatische Durchmischung von Hochhäusern und die Schaffung von Durchlässigkeit und zusätzlichem öffentlichem Raum in den unteren Geschoßen, wofür sich die Autoren amerikanische Großstädte wie New York zum Vorbild nehmen. Nicht zuletzt geht es im Konzept um die politische Dimension von Architektur, die bei Hochhäusern naturgemäß von besonderer Bedeutung ist. Das liest sich dann streckenweise wie eine Abrechnung mit der Selbstgefälligkeit der roten Alleinregierung in Wien: „Die Vorstellung von einem Zentrum der Politik, die im Modell der Industriegesellschaft kultiviert wird, beruht auf einer eigentümlichen Halbierung der Demokratie. Einerseits bleiben Handlungsfelder der Subpolitik von der Anwendung demokratischer Regeln ausgespart. Andererseits trägt auch im Inneren die Politik den systematisch geschürten äußeren Ansprüchen nach majestätische Züge.“
Ob die solcherart Adressierten diese Sprache verstanden haben, darf bezweifelt werden. Das Konzept wurde im Magistrat jedenfalls von Herzen ignoriert. Dass wenig später der Wienerberg zum erstrangigen Hochhausstandort werden konnte, abseits von öffentlicher Verkehrsanbindung und ohne sinnvolles städtebauliches Leitbild, spricht für sich.
Die große Chance zu einem städtebaulichen Durchbruch war zu diesem Zeitpunkt schon durch die Entscheidung verspielt, das Gelände vor der UNO-City als Hochhauszone freizugeben, statt die Wiener Messe hier anzusiedeln. Im Konzept von Coop Himmelb(l)au und Synthesis war noch zumindest die Option enthalten gewesen, Hochhäuser diesseits der Donau entlang der Lassallestraße auf dem Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs zu realisieren. Dieser Standort hatte im Vergleich zum Gelände vor der UNO-City durchaus höhere Attraktivität, da er mehr Spielraum bot und deutlich weniger isoliert ist als der transdanubische. Für diesen hätte sich als Nachnutzung der geplanten Weltausstellung Expo 95 die Übersiedlung der Wiener Messe angeboten, die damit unmittelbar neben dem Konferenzzentrum zu liegen gekommen wäre. Zwei Nutzungen, die sich gegenseitig stärken, hätten damit zueinander gefunden. Zugleich wäre das Messegelände – immerhin ein Areal von 600 mal 200 Metern – als ein Wohnbaugebiet zur Verfügung gestanden, das in jeder Hinsicht dem Wohnen vor der UNO-City vorzuziehen ist. Die Windbelastung ist geringer, das Stadtzentrum näher, die Verkehrsanbindung besser und der Prater als Erholungsgebiet unmittelbar vor der Tür. Von dieser Lösung hätteauch die neue Wirtschaftsuniversität profitiert, die heute im Nordosten nicht von der undurchdringlichen Mauer des Messegeländes begrenzt wäre, sondern von einer lebendigen Wohnbebauung.
Dass diese Lösung – Hochhäuser im Bereich Praterstern/Lassallestraße, Messe vor der UNO-City und Wohnbebauung am bisherigen Messegelände – nicht weiter verfolgt wurde, nachdem die Wiener 1991 in einer Volksbefragung den Fehler des Jahrzehnts machten und sich gegen die Expo 95 entschieden, ist nicht leicht zu erklären. Ein Grund mag die Hochhausphobie gewesen sein: Man wollte die Hochhäuser in sicherer Distanz halten, jenseits der Donau, wo mit der UNO-City ja bereits ein erster Sündenfall begangen worden war. Für die Lassallestraße schwebten manchen Stadtplanern und Bezirksvertretern die Champs-Élysées vor, eine gewagte Analogie, der das heutige Erscheinungsbild der Straße, abgesehen von der Überbreite, nicht wirklich entspricht. Die wesentlichen Gründe für die Entscheidung lagen jedoch im wirtschaftlichen Bereich: Das Areal vor der UNO-City war im Besitz der Stadt, während der Nordbahnhof den ÖBB gehörte. Für Hans Mayr, den Wiener Finanzstadtrat und neben Helmut Zilk heimlichen Bürgermeister Wiens, war die Entscheidung klar: Warum sollten die ÖBB einen Widmungsgewinn einstreifen, der am anderen Standort der Stadt selbst zugute käme? Noch dazu versprach der Standort vor der UNO-City die Sanierung der dort unter der Oberfläche liegenden Mülldeponie und in weiterer Folge die Überplattung des gesamten Gebiets mit einer Betondecke, mit schönen Aufträgen für stadtnahe Unternehmen.
Diese Praxis, Stadtplanung über das Finanzressort zu betreiben, hat sich bis heute gehalten. Ein aktuelles Beispiel ist dieBebauung der sogenannten Hoerbiger-Gründe im 11. Bezirk, Standort eines Schweizer High-Tech-Unternehmes auf dem Gebiet der Automatisationstechnik mit Wurzeln in Wien. Als der Hoerbiger-Konzern 2012 über einen Neubau seines Wiener Werks nachzudenken begann, stand die Übersiedlung nach Bratislava im Raum. In den Verhandlungen konnte Wien ein Grundstück in der Seestadt Aspern anbieten, das ausreichend Expansionsmöglichkeiten und gute Verkehrsanbindung aufweist. Das scheint nicht ausgereicht zu haben, um Hoerbiger zu überzeugen. Erst eine neue, massiv verdichtete und auf Wohnnutzung veränderte Widmung des bestehenden Standorts gab offenbar den Ausschlag: Die Flächenwidmung ist eine dezente Förderung und fast so effektiv, wie Geld zu drucken.
Von der Idee, einen geladenen Architekturwettbewerb für sein neues Wiener Hauptquartier in der Seestadt durchzuführen, war das Unternehmen vor diesem Hintergrund wohl leicht zu überzeugen. Was sind – so wird man sich im Planungsressort gedacht haben – die großen Gewinne ohne die kleinen. Finanzstadträtin Renate Brauner ist ihr Erfolg, ein Hightech-Unternehmen in Wien gehalten zu haben, zu gönnen. Aber wer übernimmt die Verantwortung für die Kollateralschäden in Simmering: viel zu dichte Bebauung, unzureichende Freiräume, schlechte Wohnqualität? War das Widmungsgeschenk wirklich die Ultima Ratio in diesem Prozess? Spielt städtebauliche Qualität überhaupt eine Rolle im kollektiven Bewusstsein der Stadtregierung?
Das aktuellste Wiener Hochhauskonzept kann als therapeutischer Versuch gelesen werden, die Selbstheilungskräfte der Stadt durch kollektive Einübung ins städtebauliche Denken zu stärken. Das Konzept, das von Christoph Luchsinger, Professor für Städtebau an der TU Wien, und seinen Mitarbeitern im Dialog mit zahlreichen Akteuren im Magistrat und externen „Echogruppen“ erarbeitet wurde, baut auf den bisherigen auf, unterscheidet sich aber in einem wesentlichen Punkt: Es gliedert die Stadt in Bereiche, in denen je unterschiedliche Muster der Hochhausentwicklung Platzgreifen sollen. Die „Konsolidierte Stadt“ im historischen Zentrum, das „Urbane Komposit“ im Simmeringer Osten, die „Südlichen Terrassen“ auf den Ausläufern des Wienerbergs, die „Fluviale Stadtlandschaft“ an den Uferbereichen der Donau und schließlich die „Transdanubische Ausdehnung“ in die Fläche. Diese Eignungsbereiche nehmen nur einen Teil des Stadtgebiets ein; dazwischen gibt es Übergangszonen, in denen keine Hochhausbebauung stattfinden soll. Die Beschränkungen durch Welterbe und Sichtachsen bleiben wie im Konzept aus dem Jahr 2002 bestehen, ebenso die Forderung nach hochrangiger öffentlicher Verkehrsanbindung. Diese Festlegungen sind allgemein genug, um keine Anhaltspunkte für Spekulation zu bieten, aber doch so aussagekräftig, dass sie im Anlassfall konkrete Schlussfolgerungen erlauben.
Rechtlich verbindlich wird das neue Regelwerk genauso wenig sein wie der Stadtentwicklungsplan 2025, dessen Bestandteil es sein wird. Manche laufenden Projekte scheinen aber im Konzept bereits vorweggenommen. So wirkt das Projekt dreier Wohnhochhäuser neben den Gasometern in Simmering am Franzosengraben durchaus kompatibel mit dem Muster für das „Urbane Komposit“, das „poröse Sockelzonen“ vorsieht, die zur Vernetzung der stark fragmentierten Stadtstruktur beitragen sollen.
Der Teufel steckt freilich im Detail: Während im Konzept eine moderate Höhenentwicklung angedeutet ist, schieben sich die drei Türme im konkreten Projekt fast ungebremst in den Himmel. Wer hier das Maß vorgibt und mit anderen Projekten im Umkreis abstimmt, bleibt ungeklärt. Der in Luchsingers Text elaborierte Prozess in vier Phasen (Idee, Konzept, Entwurf und Realisierung) weist die Klärung dieser Frage der Phase zwei (Konzept) zu, in der ein „lokales Leitbild“, die Nutzungsvielfalt und der Mehrwert für die Umgebung festgelegt werden. Eine „argumentierte Höhenfestlegung laut Bereichsbeschreibung“ deutet darauf hin, dass die Höhe nicht gänzlich von Renditeüberlegungen abhängen sollte. Auch in der „Transdanubischen Ausdehnung“ ist die Realität dem Hochhauskonzept vorausgeeilt. Hier kann sich das Luchsinger-Konzept „Hochpunkte als Landmarks für ein kapillares Netzwerk von Zwischenzonen der heterogenen Siedlungsstrukturen“ vorstellen, also das Gegenteil der sonst üblichen Zusammenballung von Hochhäusern zu „Clustern“. Diesen Anspruch erfüllt etwa das Citygate-Hochhaus von Querkraft Architekten an der U-Bahn-Station Aderklaaer Straße, das auch typologisch innovativ ist, etwa mit gut belichteten Erschließungszonen und Gemeinschaftsflächen auf allen Geschoßen. Wie viele solche Türme der transdanubische Immobilienmarkt verträgt, wird sich zeigen. Wenn durch eine Mischung von frei finanzierten, geförderten und Sozialwohnungen eine Ghettobildung vermieden werden soll, müssen sich genug Käufer finden, die einen sehr fernen Fernblick aufs Stadtzentrum ebenso schätzen wie die Nachbarschaft von Rennbahnweg und Rinterzelt.
Mit dem neuen Hochhauskonzept könnte der Stadtplanung ein Schritt in Richtung eines systematischen, aus der Stadtstruktur abgeleiteten Umgangs mit dem Phänomen Hochhaus gelingen. Eine Prämisse dafür findet sich gleich zu Beginn des Erläuterungstextes: „Aus den topografischen, morphologischen, atmosphärischen, naturlandschaftlichen, funktionalen, sozialen und ökologischen Qualitäten Wiens ergibt sich: Wien benötigt Hochhäuser nur unter der Voraussetzung, dass diese außerordentliche Mehrwerte für die Allgemeinheit beisteuern.“ Dem wird man zustimmen, wobei die diffuse Begrifflichkeit des „Mehrwerts“ zu denken gibt. Die Vernichtung städtebaulicher Qualität lässt sich nicht damit rechtfertigen, dass ein Investor Leistungen für die öffentliche Hand übernimmt wie etwa die Errichtung einer Sporthalle. Der Mehrwert muss in erster Linie ein stadträumlicher und stadtgestalterischer sein. Die Abschöpfung zumindest eines Teils des Widmungsgewinns ist ein anderes Thema, das auf gesetzlicher Ebene so rasch wie möglich umgesetzt werden sollte.
Für das aktuelle Projekt eines Turms am Wiener Eislaufverein lässt sich aus dem neuen Hochhauskonzept keine Rechtfertigung ableiten. Ein nach allen Regeln der Moderationskunst eingefädeltes kooperatives Planungsverfahren mit angeschlossenem Architekturwettbewerb kann nichts daran ändern, dass hier kein Mehrwert für die Öffentlichkeit gegeben ist. Das Ergebnis wäre stattdessen eine nachhaltige Blamage für eine Stadt, die auf ihr historisches Erbe stolz ist.
Warum die Gefahr dennoch groß ist, dass es zu einer Realisierung kommt, zeigt eine einfache Rechnung: Der Marktwert der obersten sechs Geschoße des 18-geschoßigen Turms beträgt bei 600 Quadratmeter verkaufbarer Fläche pro Geschoß und einem vorsichtig geschätzten Preis von 25.000 Euro pro Quadratmeter 90 Millionen Euro. Da bleibt auch nach großzügigen Spenden an die Stadt einiges übrig. Wie weit die Stadt fähig ist, dem Druck standzuhalten, der durch die Verflechtung der Projektbetreiber mit den größten Boulevardmedien der Stadt zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Vielleicht zeigt die Einübung ins städtebauliche Denken im Rahmen des neuen Hochhauskonzepts ja Wirkung. Am Ende könnte ein neues Projekt für den Eislaufverein stehen, das der Besonderheit des Ortes gerecht wird.