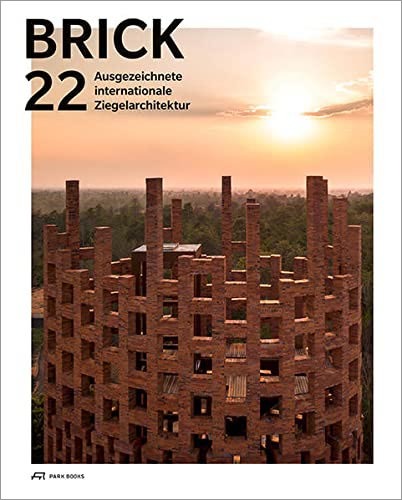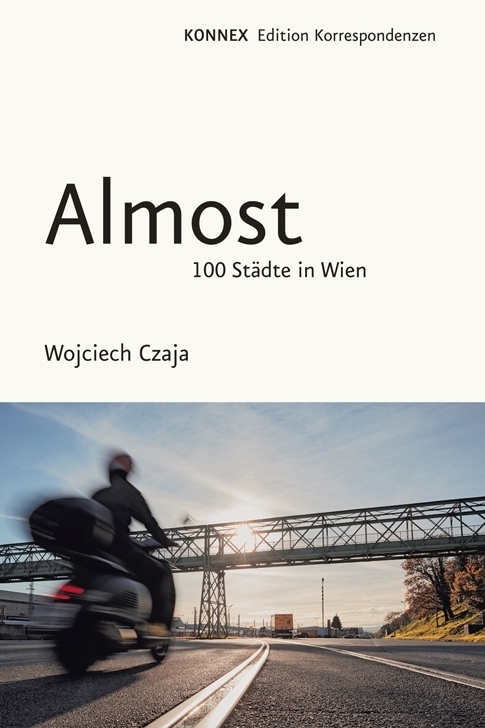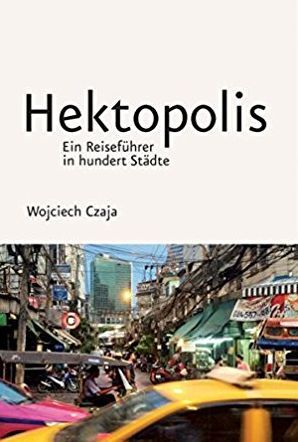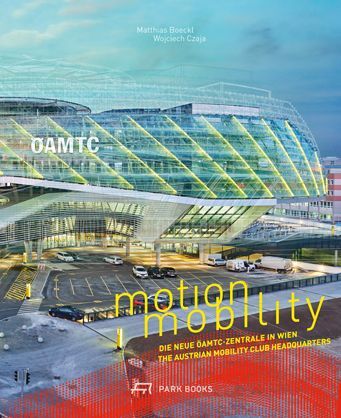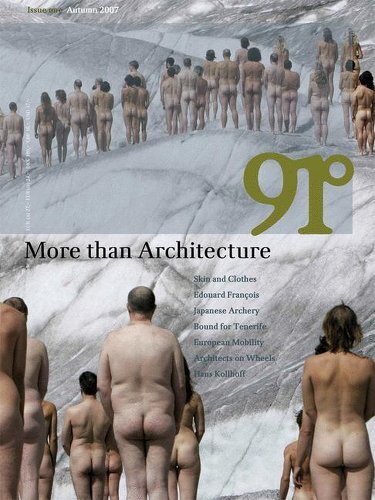Gustav, Monika, Emma
Der Kindergarten in Unterach am Attersee, einst schon von Klimt verewigt, wurde von Icomos Austria nun mit einem Architekturpreis ausgezeichnet. Zu Besuch in einem behutsam sanierten Holzdachboden-Kinderparadies.
Vor mehr als einem Jahrhundert bereits schrieb sich der Kindergarten in Unterach am Attersee, damals noch unter dem Namen „Kinderasyl mit Industrieschule“ bekannt, in die Geschichte ein. Gustav Klimt, der viele seiner Sommer am Attersee verbrachte, hielt auf zweien seiner quadratischen Landschaftsbilder, 110 x 110 Zentimeter im Format, das charakteristische gelbe Häuschen mit Satteldach fest – einmal in einem Panoramablick auf den ganzen Ort, einmal stark herangezoomt mit schönbrunnergelbem Kinderasyl am oberen Bildrand und einem kleinen Bootshaus im Vordergrund, Lust darauf machend, alsbaldig auf den See hinauszurudern.
„Das Komitee wurde 1896 gegründet, zwei Jahre später wurde das Haus eröffnet, in einer Zeit also, als Kindergärten in der Gesellschaft noch die große Ausnahme waren, und seit damals ist es durchgehend ohne Unterbrechung als Haus für Kinder im Betrieb“, sagt Victoria Breitenthaler, Leiterin des Kindergartens und der Krabbelstube in Unterach am Attersee. „Nicht nur, dass das Gebäude zweimal von Klimt verewigt wurde, jetzt wurde es auch noch wunderbar saniert und umgebaut und sogar mit einem Architekturpreis ausgezeichnet. Es ist schon eine Ehre, in so einem berühmten Bauwerk zu arbeiten.“
Wertschätzende Haltung
Die Rede ist vom Icomos Austria Best Practice Award 2025, der kürzlich in der Wiener Hofburg verliehen wurde. Icomos ist der International Council on Monuments and Sites, eine Beratungsinstanz für Bauten und Stätten unter Denkmalschutz, relevant vor allem für denkmalpflegerische Angelegenheiten im Unesco-Welterbe. Mit dem erstmals verliehenen Best Practice Award möchte man – unabhängig vom Denkmalschutz-Status – hervorragende Sanierungen und Revitalisierungen würdigen und auf diese Art und Weise darstellen, was im historischen Bestandsbau alles möglich ist.
„Wir haben in Österreich ein riesiges baukulturelles Erbe, und ein Teil davon steht erfreulicherweise unter Denkmalschutz“, sagt Dörte Kuhlmann, Generalsekretärin von Icomos Austria. „Aber noch erfreulicher ist, wie oft Planende, Gemeinden, Bauherren, Auftraggeberinnen und Grundstückseigentümer nicht denkmalgeschützter Häuser Verantwortung übernehmen und hier eine im wahrsten Sinne des Wortes wertschätzende Haltung einnehmen – und das, obwohl das Bauen im historischen Bestand oft teurer, langwieriger und voller Überraschungen ist.“
Monika und Emma, beide drei Jahre alt, der Award ist den beiden Mädels herzlich wurscht, tollen herum, spielen Fangen und Verstecken, laufen barfuß durch den Turnraum im zweiten Stock, auch jetzt im neblig kalten Dezember. Für die etwas wärmeren Monate gibt es in der Verlängerung von Turnraum und Speisesaal samt Einbauküche aus massivem, naturbelassenem Tannenholz, das auch heute noch, sieben Jahre nach Fertigstellung, einen angenehm holzigen Geruch verströmt, eine holzverkleidete Loggia, eine Art Balkon mit Blick auf den See, mit Holzboden, Holzgesperre und zwei Hängematten, in denen die Kids schwerelos über dem Attersee baumeln können.
Zu verdanken ist die behutsame Sanierung den beiden Architekturbüros Dunkelschwarz (Salzburg) und Hohengasser Wirnsberger Architekten (Kärnten), die sich der Bedeutung des Hauses für den Ort, für den See, für die gesamte Region bewusst waren und die Planung von Anfang so auslegten, als stünde das Haus unter Denkmalschutz. „Das Gebäude war ziemlich überformt, mit eigenartigen Einbauten und einer Eternit-Fassade aus den Siebzigerjahren“, erinnert sich Erhard Steiner, Partner bei Dunkelschwarz Architekten, „aber nichts, was man nicht leicht wieder in den ursprünglichen Zustand zurückführen könnte. Daher war für uns klar, dass wir zwar nicht jeden einzelnen Ziegel, wohl aber die Identität und das Erscheinungsbild von damals rekonstruieren möchten.“
Als Vorlage dafür dienten nicht nur die historischen Planunterlagen des Vöcklabrucker Baumeisters Franz Aichinger, datiert mit 20. März 1896, sondern auch die beiden Klimt-Gemälde, auf denen die Erscheinung des Hauses genau zu erkennen ist. „Auf der von Klimt verewigten Ansicht haben wir ganz bewusst kaum etwas verändert, auf der bildabgewandten Seite dafür haben wir – so behutsam wie möglich und unter Berücksichtigung traditionellen Holzbaus – eine Loggia eingeschnitten.“ Die baulichen und handwerklichen Details wie Tropfnasen und Opferbretter zeugen von einer hohen Kenntnis des Materials und sind im zeitgenössischen Holzbau-Österreich Seltenheit geworden.
„Genau diesen Ansatz, diese Detailliebe, diesen Respekt gegenüber der Bausubstanz wollten wir auszeichnen“, sagt die Münchner Architektin Anne Beer, die der zehnköpfigen Jury vorsaß und den Kindergarten aus insgesamt 67 Einreichungen mit dem ersten Preis prämierte. „Hier haben alle Beteiligten an einem Strang gezogen und Ortsbildschutz, Nutzungssensibilität, Kooperationsbereitschaft und handwerkliche Qualität in bester Weise miteinander kombiniert.“ Auf dem zweiten Platz landete übrigens das Haus Havanna in der Tabakfabrik Linz (Steinbauer und Kaltenbacher Architektur), auf Platz drei das Klösterle Imst von Studio Lois, das erst im November mit dem Österreichischen Staatspreis Architektur ausgezeichnet wurde.
Recht auf schöne Plätze
Monika und Emma scheint der Holzbau zu gefallen, sie rennen immer noch umher, lachen, singen, bleiben an einem der alten Sparren stehen, kriechen unter der alten, teils abgesägten Pfette hindurch. „Wir kriegen von den Kindern keine verbale Rückmeldung“, meint die Kindergartenleiterin am Ende des Besuchs, „sie drücken sich vielmehr in ihrem Verhalten aus. Sie wirken ruhig und geerdet, es herrscht eine warme, heimelige, fast schon familiäre Atmosphäre. Manchmal sind die Kinder so konzentriert, dass wir das Gefühl haben, die Hälfte der Gruppe sei uns irgendwo entwischt.“
Das Learning aus dem Icomos Austria Best Practice Award? „In Zeiten wie diesen verstehe ich jeden Druck, zu sparen und den Rotstift anzusetzen“, so Breitenthaler. „Und das ist überall legitim – bloß nicht bei den Kindern, denn sie sind diejenigen, die so ein Haus mit dem ganzen Körper spüren und später mal selbst bauen, finanzieren und entscheiden werden. Die „next generation“ hat das Recht, an einem schönen Platz lernen und wachsen zu dürfen.“