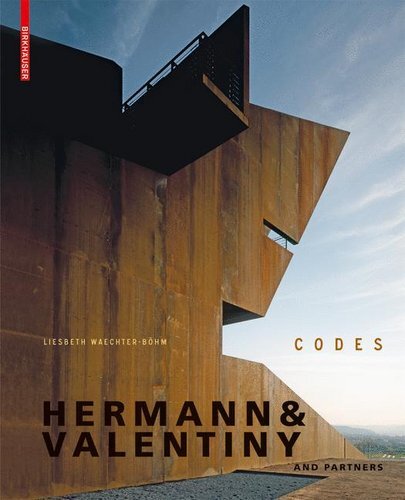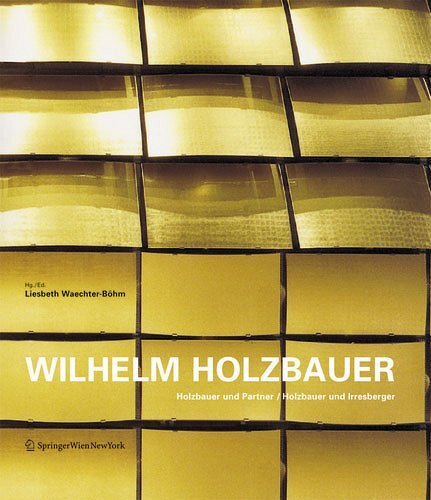Im Jahr 1977 fand die erste einer geplanten Reihe von Veranstaltungen am Linzer Donauufer statt: „Forum Metall“. Aus diesem Anlaß wurden 13 internationale und österreichische Künstler und Architekten eingeladen, Beiträge für diesen spezifischen Standort am Fluß zu erarbeiten; die ortsansässige Stahlindustrie wollte sich aktiv an deren Verwirklichung beteiligen. Bei dieser Gelegenheit erblickte unter anderem die Linzer „Nike“ das Licht der Welt: eine Kreation von Haus-Rucker-Co, die vom Dach des rechten der beiden symmetrischen, unter Hitler errichteten Brückenkopfgebäude, die den Hauptplatz an seiner Nordseite fassen, weit in den Straßenraum hinausragte. In dem Haus ist sinnigerweise die Linzer Kunsthochschule untergebracht. Was lag da näher, als mit der „Nike von Samothrake“ ein Stück klassisches, antikes Griechenland in die Gegenwart herüberzuholen.
Sicher ist: Ein solches Konzept wäre damals wohl niemand anderem in Österreich eingefallen. Und ebenso sicher ist, daß es auch niemand pointierter, schärfer hätte umsetzen können als eben die Haus-Rucker-Co. Sie hat praktisch ein fotografisches - graubraun eloxiertes - Abbild der antiken Nike auf 7,5 Meter vergrößert und in Form zweier spiegelbildlich verkehrter, aus silbrig schimmernden Aluminiumtafeln zusammengesetzter Paneele auf einem sieben Meter langen, schräg nach oben weisenden Stahlgitterträger montiert. Soweit, so signifikant.
Lassen wir offen, was in dieser Arbeit inhaltlich alles angesprochen ist. Worum es hier in erster Linie geht, ist die öffentliche/mediale Reaktion. Die Linzer Nike wurde schnell zum Stein des Anstoßes. Eine gewisse, nämlich die breite Öffentlichkeit - geschürt von den konservativen Medien - zeigte sich empört. Lautstarker Tenor: „Die Nike muß weg.“
Natürlich stand auch damals schon dieser breiten eine qualifizierte Öffentlichkeit gegenüber. Und die versuchte nach Kräften, sich ebenfalls bemerkbar zu machen. Speziell Heinz Baumüller (heute: Werkstatt Kollerschlag) organisierte in einer fast schon zukunftweisenden Aktion - dergleichen gab es seither öfters - Protestschreiben von Künstlern und Kunstvermittlern internationalen Ranges. Aber im Endeffekt hat alles nichts genützt. Ein Volksfest war’s und gleichzeitig ein Trauerspiel: Am 22. November 1979, knapp vor Mitternacht, wurde die Linzer Nike demontiert. Und in der Folge, auch das nicht untypisch für den österreichischen Kulturklimapegel, wurde sie exportiert: Nach Frankfurt, ans Museumsufer, wo sie vor dem Deutschen Architektur-Museum ein Zeichen setzen sollte, was ihr aber auch dort nicht vergönnt war.
So könnte man das Geschehen rund um die Linzer Nike unter die Eckdaten der schier unendlichen Geschichte jener glücklosen Beziehung zwischen Architektur und Kunst einreihen, wie sie sich in der österreichischen Nachkriegszeit so facettenreich entwickelt hat.
Das war vor und zwischen den Kriegen noch anders. Architektur, die etwas auf sich hielt, schmückte sich oft und gern mit Kunst. Eines der schönsten Beispiele für diese selbstverständliche Beziehung steht in der Wiener Innenstadt und stammt von Joz?e Plec?nik: Es ist das sogenannte Zacherl-Haus, errichtet 1903-1905, dessen graue Granitfassade in der Zone des Dachgesimses in einer Reihe riesiger Atlanten des Bildhauers Franz Metzner ihren monumentalen Abschluß findet. (Der Erzengel Michael, der heute die Fassade schmückt und nach einem Entwurf Plec?niks von dessen Freund Ferdinand Andri zunächst in Holz geschnitzt wurde, später in Kupfer getrieben, wurde erst 1909 angebracht.)
Ein anderes hervorragendes Beispiel für das Zusammenwirken von Architektur und Kunst befindet sich auf dem Gelände des psychiatrischen Krankenhauses in Wien und stammt von Otto Wagner. Es ist seine Kirche „Am Steinhof“, errichtet 1905-1907. Die Kirche ist gewissermaßen als secessionistisches Gesamtkunstwerk angelegt: Kolo Moser entwarf die Glasfenster, Rudolf Jettmar und Leopold Forstner fertigten die Altarmosaiken aus Email, Glas, Keramik und Marmor, die Heiligenstatuen auf den beiden Türmen stammen von Richard Luksch und die Engel der Eingangszone sind von Othmar Schimkowitz. (Letzterer schuf übrigens auch die vier Meter hohen Aluminiumgüsse der Engelsfiguren auf Wagners Postsparkasse, 1903-06, 1910-12.)
Architektur ohne Kunst war bei öffentlichen und bei Repräsentationsbauten praktisch undenkbar. Und in der Zwischenkriegszeit, als die Sozialdemokratie im „Roten Wien“ ihr gewaltiges Wohnbauprogramm realisierte, hielt die Kunst dann sogar in den neuen „Arbeiterpalästen“ Einzug. Bemerkenswert daran ist aber nicht einmal so sehr die Tatsache, daß es überhaupt Kunst gab; viel bemerkenswerter ist nämlich, welche Art von Kunst das war - eine letztlich höchst konservative, die selbst vor dem guten, alten Putto nicht zurückschreckte - siehe dazu: Otto Prutschers Lorens-Hof von 1927, wo an der Gebäudeecke über dem Erdgeschoßbereich ein Putto des Bildhauers Rudolf Schmidt überrascht; Skulpturengruppen, wie jene von Leopold Hohl über dem Eingang zum Gall-Hof von Heinrich Schopper und Alfred Chalusch, 1924, mit dem sinnreichen Titel „Kraft und Fruchtbarkeit“ waren nicht selten; und auf „Zierbrunnen“ stieß man in jedem größeren Hof. Da kam der künstlerischen Qualität der Plastiken eines Anton Hanak, etwa über dem Eingangsportal zum Klose-Hof von Josef Hoffmann (1924), schon eher der Rang einer Ausnahme zu.
Dieses Manko sollte die „Kunst am Bau“ im wesentlichen auch noch zumindest die ersten drei Nachkriegsjahrzehnte hindurch charakterisieren. Die sattsam bekannte „Eisbären-Zeit“, die vor jedem größeren Gemeindebau eine Tierplastik zur Folge hatte - bei kleineren tat es auch nur ein Mosaik -, währte noch bis in die siebziger Jahre hinein. Und zumindest im Wohnbaubereich der Bundeshauptstadt wurde sie auch dann nicht etwa durch Besseres abgelöst, sondern genau genommen durch (fast) gar nichts. Mit anderen Worten: Aus dem kommunalen Wohnbau hat sich die Kunst heute weitestgehend verabschiedet, sie wurde praktisch ersatzlos gestrichen.
Das ist beim Bundeshochbau nicht der Fall: Da gibt es das berüchtigte Kunst-Prozent und seit Mitte der achtziger Jahre auch einen Beirat „Kunst und Bau“, der über Verfahrensweise (Direktauftrag, geladener Wettbewerb, offener Wettbewerb) und Vergabe entscheidet. Das heißt: Schulen und Universitäten, Kasernen und Ämter werden seither mit Kunst ausgestattet, auch wenn es dabei nicht immer ganz reibungslos zugeht. Wenn nämlich ein Bau - wie etwa der Neubau der Technischen Universität in Wien - teurer ist als geplant, dann wird die Gefahr akut, daß sich automatisch das Kunst-Prozent verflüchtigt, zumindest aber empfindlich reduziert.
Doch die eigentliche Gretchenfrage in bezug auf das Thema „Kunst und/am Bau“ tut sich jenseits solcher Verfahrens- und Finanzierungsfragen auf: Sie ist inhaltlicher Natur und hat - siehe Einleitung - bis heute mit dem krassen Informationsdefizit zu tun, das sich zwischen der breiten und einer qualifizierteren Öffentlichkeit kluftartig auftut; sie hat mit dem entfremdeten Verhältnis zwischen Architekten und Künstlern zu tun und damit, daß Künstler von ihrer Ausbildung her auf die spezifischen Bedingungen einer Kunst im architektonischen oder stadträumlichen Kontext nicht vorbereitet sind; last not least betrifft sie sicher auch das aktuelle Anforderungsprofil und die geltende Durchführungspraxis, die beide weit hinter den tatsächlichen Entwicklungen im Kunstbereich hinterherhinken. Die verordnete Usance will nämlich nach wie vor, daß Kunstwerke fest mit dem Bau verbunden und daß sie pflegeleicht bzw. nach Möglichkeit wartungsfrei sein müssen. Da kann es schon vorkommen, daß eine minimalistische Stahlskulptur, die für die Rasenfläche vor einer Schule in Oberösterreich realisiert wurde, nicht an der knappen Million Schilling Kosten, sondern am Veto des Schulwarts scheitert, dem es zu umständlich ist, um das Objekt herumzumähen.
In der Steiermark, die als einziges österreichisches Bundesland ein eigenes Kunst-am-Bau-Büro unterhält und in diesem Bereich relativ konsequent und engagiert tätig ist, gibt es schon eine deutlich größere Bandbreite an Möglichkeiten. Sogar die Niederösterreicher und die Salzburger halten sich auf ihre „Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen Raum“ immerhin soviel zugute, daß sie sie in umfangreichen Bänden publizieren. Das wird auf Bundesebene vielleicht auch noch einmal der Fall sein, aber was Wien selbst anbelangt, sollte man ein solches Vorhaben getrost noch eine Weile vertagen. Nur als Beispiel: Bei der „künstlerischen Ausschmückung“ des riesigen Komplexes des Allgemeinen Krankenhauses etwa scheute man nicht davor zurück, Einheitsgrößen von Rahmen zu verwenden, für die Künstler dann eine passende Bildspende abliefern durften.
Aber Wien ist ja überhaupt ein eigenes - „anderes“ (Anm.: „Wien ist anders“ - heimischer Werbeslogan der Zilk-Ära) - Kapitel: Es hat seinen Friedensreich Hundertwasser, seinen Arik Brauer und seinen Karl Hodina (für Nicht-Wiener: ein Heurigensänger, der auch malt) und verfügt damit, nach dem Willen seines ehemaligen Bürgermeisters Helmut Zilk, über eine sehr individuell-symbiotische Lesart von Künstler-Architektur, die sich nach Wohnhäusern und Fernheizwerk inzwischen auch entlang der Autobahnen (Raststätten) ausbreitet und selbst vor Kirchen (Ernst Fuchs in der Steiermark) nicht halt macht. Diese ungebremste Karnevalisierung von Stadt und Land grassiert mittlerweile mit der Vehemenz einer seuchenartigen Immunschwäche und ist an Perfidie kaum noch zu überbieten: Denn alle diese Malerarchitekten - sie bauen natürlich zu Sonderkonditionen, die keinem Architekten je zugestanden würden - treten mit dem Anspruch auf, als könnten sie - wenn schon nicht die Kunst, so wenigstens das Bauen besser...
Dabei, und das muß einem doch zu denken geben, hat Österreich in den sechziger und siebziger Jahren eine wirklich spannende Hochblüte architektonisch/künstlerischer Konzepte erlebt. Das fing schon seinerzeit mit Hans Hollein und Walter Pichler an, die ja ein gutes Stück Weg gemeinsam gegangen sind und beide scharf an der Grenze zwischen Kunst und Architektur agierten - „Architektur“ war schließlich auch der Titel einer Gemeinschaftsausstellung der beiden in der Wiener „Galerie nächst St. Stephan“. Nicht von ungefähr entwirft Walter Pichler heute im burgenländischen St. Martin Häuser für seine Skulpturen und baut an seinem eigenen „ruralen“ Gesamtkunstwerk. Und nicht von ungefähr schuf Hollein noch Jahre nach Fertigstellung des Museums Abteiberg in Mönchengladbach mit der „Turnstunde“ (1984) eine Installation ganz und gar künstlerischer Provenienz.
In diesem Zusammenhang wäre auch noch ein anderer Vertreter dieser Künstler-Architekten-Generation zu nennen, der Österreich allerdings bald nach seinen ersten Bauerfahrungen - Mitte der sechziger Jahre - verlassen und dann, in New York, auf das Bauen jahrzehntelang verzichtet hat: Raimund Abraham. Ist es Architektur, was sein Bleistift auf dem Papier realisiert - er würde sagen, ja. Aber man kann sicher darüber diskutieren, wieweit diese Architektur nicht auch oder vor allem Kunst ist.
Zu einer geradezu hektischen Aktivitätsfülle im Berührungsbereich Architektur und Kunst kam es aber dann Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre, als die Architektengruppen wie Pop-Bands aus dem Boden schossen - Haus-Rucker-Co, Coop Himmelblau, Salz der Erde, Zünd up etc. - und das amüsierte Publikum mit pneumatischen Wohnräumen, die irgendwo aus den Fenstern hingen (Haus-Rucker-Co), vergnüglichen „Riesenbillards“ (Haus-Rucker-Co) und „Stadtfußbällen“ (Coop Himmelblau) unterhielten und möglicherweise auch provozierten. Das kreative Potential dieser Jahre war kaum noch zu überbieten und strahlte weit über die Landesgrenzen aus.
Dagegen hat sich im Kunstbereich im engen Sinn zur gleichen Zeit viel weniger getan, das über den Galerie- und Museumskontext hinaus öffentlich wirksam und sichtbar geworden wäre. Die vermutlich beste und signifikanteste Arbeit eines Künstlers im Architekturkontext stammt von dem Vorarlberger Gottfried Bechtold; sie wurde aber nicht in Österreich realisiert: Es ist sein „Betonporsche“ aus dem Jahr 1971, der seither auf dem Parkplatz der Universität Konstanz für Aufsehen sorgt und im übrigen 1996 sein 25jähriges Jubiläum feiert. Gottfried Bechtold aus Vorarlberg, Richard Kriesche aus Graz, Waltraud Cooper aus Linz - das sind schon einige der wichtigsten Künstler, die die Arbeit im architektonischen Kontext bzw. auch im öffentlichen Raum zu ihrem Anliegen gemacht haben. Sie mußten ziemlich lange durchhalten, bis sie größere Konzepte umsetzen konnten, und dabei kämpferische Strategien entwickeln, die weit über den Rahmen üblicher Durchsetzungsmuster hinausgehen.
Aber letztlich waren sie doch erfolgreich: Waltraud Cooper konnte in einem der neueren Grazer Universitätsbauten eine ihrer medialen Licht-Ton-Arbeiten realisieren und hat später auch den Wettbewerb für die wichtigste künstlerische Arbeit im Austria Center Vienna für sich entschieden - übrigens eine jener zahlreichen Gelegenheiten, bei denen man sich fragen muß, inwieweit die künstlerische Ambition zum Tragen kommen kann, wenn die architektonische derartig ausläßt.
Gottfried Bechtold hat im vergangenen Jahr im Kontext eines Schulbaus von Ernst Giselbrecht in Kaindorf/Steiermark eine der bemerkenswertesten und signifikantesten „Kunst und Bau“-Arbeiten seit Jahren realisiert: Einen weithin sichtbaren, hohen Leuchtturm, spitz wie eine Nadel, eine filigrane technische Skulptur, die sich auch auf dem Boden breit macht, bis ins Gebäudeinnere fortsetzt und dort, proportional zur schulischen Betriebsamkeit, für differenzierte Lichtsituationen sorgt. Das heißt, wenn die Schule geschlossen ist, strahlt der Leuchtturm am stärksten, ist die Schule in Betrieb, wird das äußere Licht quasi nach innen gesogen. Außerdem haben die Schüler über einen Terminal die Möglichkeit zu spontanen, zeitlich begrenzten Eingriffen (eine Möglichkeit, die allerdings mehr theoretisch existiert, weil sich der neue Schuldirektor mit der Arbeit von Bechtold nach wie vor nicht angefreundet hat und daher den Terminal gern unter Verschluß hält).
Die Probleme im Umgang mit „verordneter“ Kunst am Bau sind, wie man an solchen Beispielen sehen kann, noch lange nicht ausgeräumt. Alle Vorstöße in unbekanntes, unerprobtes Terrain müssen daher vorläufig punktuell bleiben. Das liegt teilweise durchaus auch am System:
Da werden Aufträge - zum Beispiel für Amtsgebäude - vergeben, kaum weiß man, wie; und dann wird ein sorgfältiges, minutiös durchgespieltes Verfahren in die Wege geleitet, um das bestmögliche Kunstkonzept zu erlangen. Daß architektonische Belanglosigkeit und forcierter zeitgenössischer Kunstanspruch nicht in Deckung zu bringen sind, sollte - oder könnte - man zumindest wissen.
Im architektonischen Kontext ist zwar heute längst auch eine jüngere und sehr professionelle Künstlergeneration am Werk, die in den letzten Jahren eine ganze Reihe interessanter Arbeiten realisiert hat. Aber die wirklich bedeutsamen Schöpfungen, in denen sich Kunst und Architektur vorsichtig berühren, verdanken sich nach wie vor öfter anderen, nicht-verordneten Umständen und Initiativen und sind schon von daher - aber nicht nur deswegen - singulär. Die Kraft, die Günther Domenigs „Steinhaus“ am Ossiacher See innewohnt, wird kein Nur-Architekt und kein Nur-Künstler seiner Arbeit so schnell einhauchen können: Eine solche Haus gewordene Skulptur - oder ist es umgekehrt? - verdankt sich nicht einfach einem Baukünstler im herkömmlichen Sinn, sie braucht den Künstler-Architekten. (A propos Künstler-Architekt: Daß sich Günther Domenig auch gerne als Objektkünstler versucht, hat er u.a. 1983 mit seinem Vogel „Nix-Nuz-Nix“ bewiesen. Das Objekt wurde ursprünglich für eine Bank entworfen und später von Domenig zurückgekauft.)
Ganz anders angelegt, aber von vergleichbarer Konzentration ist auch Cornelius Koligs „work in progress“, „Das Paradies“ im Kärntner Gailtal: Es hat 1980 mit der sogenannten Roten Grube begonnen und wurde im Lauf der Jahre zu einer architektonisch und konzeptionell komplexen Anlage, die sich immer weiter ausdehnt und verändert. Vom Aufbau her könnte man einen basilikalen Grundriß - zwei Türme, kapellenartige Zubauten - konstatieren, der aber durch die einfachen Materialien - unverputzte Hohlblocksteine, Sichtbeton, unbehandeltes Holz, Aluminium - aufgebrochen, ambivalent wird.
Geradezu konträr ist die Haltung eines Adolf Krischanitz. Er baut nicht etwa an seinem eigenen Gesamtkunstwerk, aber er arbeitet mit Künstlern seiner eigenen Wahl zusammen, wenn es um die Farbkonzepte seiner Bauten geht. Von den Einfamilienhäusern bis zu den Reihenhäusern in der Wiener Pilotengasse hat diese maßgeschneiderten farbigen Kleider zumeist Oskar Putz entworfen, zuletzt, beim Kindergarten „Neue Welt Schule“, stammte das Farbkonzept von dem in Wien lebenden Schweizer Künstler Helmut Federle. Es hat diese letzte Auffassung sicher nichts mit den Projekten eines Günther Domenig oder eines Cornelius Kolig zu tun - sie ist aber bemerkenswert, weil sie gewissermaßen eine deklariert zeitgenössische Lesart der tradierten Allianz zwischen Architekt und Künstler darstellt, wie sie früher einmal die Wiener Moderne so sehr geprägt hat.
Picasso is watching us: Robert Adrian X, seit langem in Wien lebender Kanadier, hat eine gigantische Vergrößerung von „Picassos Auge“ so auf einem Gebäude angebracht, daß jeder, der die Reichsbrücke Richtung Innenstadt überquert, in den Sog dieses suggestiven Blicks gerät. Bild gewordene Allmachtsphantasie eines Künstlers? Oder Ikone - aber wovon und für wen?
Vielleicht ist es dem österreichischen Biennale-Kommissär Peter Weibel im Sommer 1995 am besten gelungen, die neuen - medialen - Schnittstellen zwischen Architektur und Kunst sichtbar zu machen: „Mit dem Wandel des Bildes und seinem Wandern von der Malerei zu den Medien hat sich auch die Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur gewandelt: von der Malerei zu den Medien. Die dreidimensionale und die zweidimensionale Kunst ändern sich mit ihren Trägermedien, mit ihrer Technologie (...) Daher bilden die Medien heute die dominante Schnittstelle zwischen Architektur und Kunst, zwischen Baukunst und Bildkunst. Die technische Transformation des Bildes hat also auch die Gleichung zwischen Kunst und Architektur transformiert“ (Weibel).
In diesem Sinn war Österreichs Biennale-Pavillon in Venedig - mit seiner spektakulären Überformung des Hoffmann-Baus durch Coop Himmelblau und seinem nicht weniger spektakulären, flirrenden, weil medial vermittelten Bildinhalt (von Peter Kogler, Richard Kriesche, Constanze Ruhm, Peter Sandbichler, Eva Schlegel und Ruth Schnell) ein zukunftweisendes Statement für die von Peter Weibel apostrophierte „neue Gleichung zwischen Kunst und Architektur“.