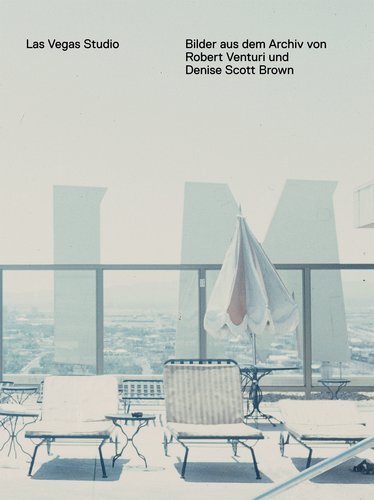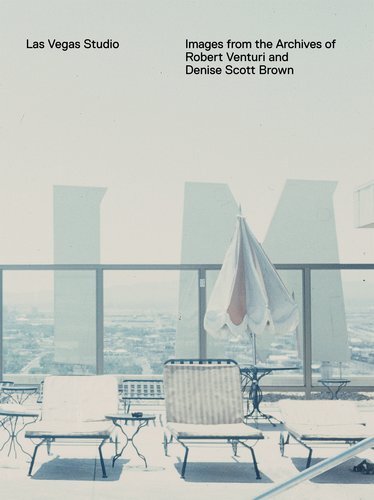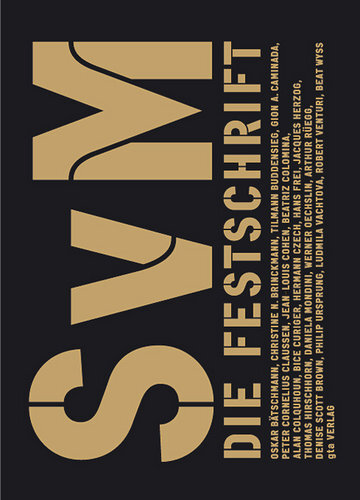Artikel
Eine Landmarke am Stadtrand
Das Bürohochhaus Obsidian als urbanes Zeichen Altstettens
In Zürich werden wieder Hochhäuser gebaut. Nachdem die Stimmberechtigten 1984 die gesamte Innenstadt mit einem Hochhausverbot belegt hatten, ist der Bautypus in jüngeren Jahren wieder in Mode gekommen. Doch erst im November 2001 präsentierte die Stadt ein neues Leitbild, in dem die Gebiete ausgewiesen werden, wo Bauten über 25 Meter Höhe zugelassen sind, die in Zürich als Hochhäuser gelten. Das soeben erstellte 52 Meter hohe Bürogebäude Obsidian an der Hohlstrasse beim Bahnhof Altstetten ist das erste Hochhaus, das nach den neuen Richtlinien entstand. Es handelt sich um einen architektonisch höchst ansprechenden und städtebaulich bedeutungsvollen Neubau. Bauherrschaft ist die Anlagestiftung Pensimo, Zürich, gebaut wurde von der St. Galler Generalunternehmung BPM AG, geplant haben die Architekten Baumschlager Eberle Anstalt, Vaduz, Hauptmieter ist die international tätige Helbling-Gruppe.
Der gesamte Baukörper ist mit einer Glashaut überzogen. Sie verkörpert Leichtigkeit und, durch ihre dunkle, bisweilen schwarz oder grün wirkende Tönung, zurückhaltende Eleganz. Im Grundriss besteht der Bau aus zwei ineinander geschobenen Rechtecken, deren Situierung sich aus der Lage des Bauplatzes zwischen der Hohlstrasse und den Bahngleisen ableitet. Darüber erheben sich ein sechsgeschossiger Gebäudeteil, der die Traufhöhe der benachbarten Bürohäuser aufnimmt und sich den Gegebenheiten des Quartiers anpasst, sowie der eigentliche Turm mit seinen fünfzehn Geschossen. Diese sind an der Höhe der metallgerahmten Glas-Paneelen ablesbar. Dieser Raster erstreckt sich gleichmässig vom Erdgeschoss über die gesamte Aussenfassade und wird lediglich von drei Eingangszonen aus hellem Beton unterbrochen. Die zweigeschossigen Torrahmen ergeben in Farbe und Materialität einen reizvollen Kontrast zur Hülle. Die Einfahrt zur Tiefgarage ist unauffällig vor den niedrigen Gebäudeteil gelegt. Indem der Neubau gegenüber der Hohlstrasse um einige Meter zurückversetzt ist, nimmt er den Verlauf der bestehenden Bauten auf und ermöglicht eine durchgehende Baumbepflanzung entlang der Strasse, die in einem kleinen Park (Vogt Landschaftsarchitekten) auf der Westseite ihren Abschluss findet.
Im Innern setzten die Architekten auf Flexibilität. Die Stahlbetonskelett-Konstruktion ermöglicht völlig freie Grundrisse und damit unterschiedliche Formen von Nutzungen. Unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit wurde nicht nur Wert auf eine effiziente Energienutzung gelegt, sondern auch versucht, die Räume möglichst wenig zu differenzieren, um künftigen Nutzungen oder neuen Arbeitsformen nicht im Wege zu stehen. Auf sichtbares Hightech wurde verzichtet. Die raumhohen Holzfenster der inneren Fassadenschicht verbreiten geradezu Wohnlichkeit. Die Fenster lassen sich individuell öffnen und dürften zu einem angenehmen Klima zusätzlich beitragen. Durch die gläserne Hülle eröffnet sich besonders in den oberen Stockwerken ein spektakulärer Blick ins Limmattal und Richtung Innenstadt. - Für das Gebiet um den Bahnhof Altstetten bedeutet der Neubau eine wichtige Aufwertung. Nachdem das Quartier in den vergangenen Jahrzehnten von eher gesichtslosen Bauten geprägt gewesen war, scheint es aus seinem Dornröschenschlaf erwacht zu sein. In der Tat ist die Lage des Neubaus neben dem Bahnhof und neben dem Autobahnanschluss gerade für Geschäftssitze und Büros äusserst attraktiv. Das Hochhaus Obsidian ist nur das neuste und markanteste Zeichen dafür, dass verschiedene Firmen Altstetten als geeigneten Standort für ihren Firmensitz entdeckt haben, was den architektonischen Druck auf die benachbarten Parzellen erhöhen dürfte. Zudem wird das Hochhaus über die Grenzen des Quartiers hinaus wahrgenommen; es bildet eine weithin sichtbare Landmarke und repräsentiert das moderne Zürich, das zurzeit vor allem mit Zürich Nord und Zürich West von sich reden macht - mehr und mehr auch mit Altstetten.
Rationalität und Expressivität
Dialog zwischen Architektur und Skulptur in Riehen
Unter dem Titel «ArchiSkulptur» präsentiert die Fondation Beyeler in Riehen Skulptur im Dialog mit Architektur. Die breit angelegte Ausstellung macht deutlich, dass die Wechselbeziehungen zwischen den Gattungen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts für beide Seiten fruchtbar, aber auch wegweisend für heutige Entwicklungen waren.
In seinem Urteil zum griechischen Tempel war der Architekturhistoriker Nikolaus Pevsner unzweideutig: Er sei der nie wieder erreichte Gipfelpunkt der Architektur, soweit sie je ihre Erfüllung in plastisch-körperhafter Schönheit gesucht habe. Die Wahlverwandtschaft zwischen den beiden Disziplinen Architektur und Skulptur scheint damit von allem Anfang an zu bestehen. Und vermutlich hat Markus Brüderlin sich des Diktums Pevsners erinnert, als er seiner gegenwärtigen Ausstellung in der Fondation Beyeler emblematisch ein Modell des Parthenons voranstellte. Die Schau in Riehen bei Basel hat zum Ziel, den Kreuzbestäubungen zwischen moderner Architektur und Skulptur auf den Grund zu gehen und damit die Fruchtbarkeit des gattungsübergreifenden Dialogs für beide Seiten zu demonstrieren. Es fällt schwer, sich der suggestiven Kraft des Ausstellungsauftakts zu entziehen.
Einleuchtende Gegenüberstellungen
Auch im weiteren Verlauf der Schau wird der Besucher in Sachen Inszenierung und Qualität der Exponate nicht enttäuscht. Der an nicht weniger als 180 Objekten von über 100 Künstlern und Architekten vorbeiführende Parcours folgt einer chronologischen Ordnung, wobei schwerpunktmässig die klassische Moderne sowie die jüngere Vergangenheit bis hin zur Gegenwart hervorgehoben werden. Eine Binnengliederung erfährt der historische Längsschnitt durch die Unterteilung des gesammelten Materials in zehn Kapitel. Eingestreute Rückblenden und Vorgriffe helfen dabei, die Konstanz zentraler Motive und Themen über die Zeitläufe und Gattungsgrenzen hinweg zu illustrieren. Das erste Kapitel rollt die Vorgeschichte der zeitgenössischen «ArchiSkulptur» in «Klassik», Gotik und Barock auf, ohne dabei den Brückenschlag in die Moderne zu unterlassen. So erscheinen Malewitschs suprematistische «Architekona» oder ein Hochhausentwurf von Oswald Mathias Ungers neben Etienne-Louis Boullées Kenotaph für Newton, eine Plastik von Antoine Pevsner neben dem Modell der Kathedrale von Reims oder Henri Matisses Figurine «La serpentine» neben Borrominis Sant'Ivo della Sapienza mit ihrer gewundenen Laternenspitze, die freilich auch auf Gaudí oder Tatlins berühmtes «Denkmal der III. Internationale» vorausweist.
Damit ist die Überleitung ins 20. Jahrhundert mehrfach angekündigt. Das Kapitel zu Kubismus, De Stijl und Bauhaus steht unter dem Stichwort der «Eroberung des Raumes», während die anschliessende Sektion die gleichzeitige Entdeckung plastischer Qualitäten durch die expressionistische Architektur aufzeigt. Anhand dieser Gegenüberstellung von Rationalität und Expressivität offenbart die Ausstellung zwei grundlegende künstlerische Haltungen und suggeriert zugleich, dass sich der Widerstreit zwischen Geometrik und Organik gleichsam als roter Faden durch die Geschichte des Austauschs zwischen den Disziplinen zieht. In der Tat wird der Dualismus beim Rundgang immer wieder sichtbar; so etwa bei der als Exkurs eingeschobenen Gegenüberstellung des Goetheanums von Rudolf Steiner und Ludwig Wittgensteins Haus Stonborough, der - auf der Ebene der Plastik - die Kontrastierung von Beuys und LeWitt entspricht.
Breiter Platz wird der Dekade zwischen 1950 und 1960 eingeräumt, zumal die Ausstellung hier einen besonders ergiebigen Dialog ausmacht, ganz im Sinne von Carola Giedion-Welcker, die für die Epoche ein eigentliches «Sculptural Age» ausgerufen hatte. Die Gegenüberstellung des Modells von Le Corbusiers Wallfahrtskirche in Ronchamp mit einer Liegenden von Henry Moore setzt die These ebenso bildwirksam um wie der Vergleich einer Skulptur von Fritz Wotruba mit der stereometrischen Körperhaftigkeit seiner gemeinsam mit Fritz Gerhard Mayr entworfenen Wiener Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit. In weiteren Kapiteln zeichnet die Ausstellung die «Architektonisierung» der Skulptur durch ihr Ausgreifen in den Stadtraum unter dem Begriff der Installation nach (Dan Graham) oder zeigt die Spuren auf, die die Minimal Art in der Architektur der jüngeren Vergangenheit hinterlassen hat (Donald Judd - Herzog & de Meuron).
Dass selbst im Städtebau mit skulpturalen Modi der Formfindung experimentiert wird, belegt ein Blick auf die urbanen Utopien der sechziger Jahre. Arata Isozakis «Clusters in the Air» etwa zeugen von einem Nachdenken über Struktur, das Zoltan Kemenys geschichteten Metallplastiken vergleichbar scheint. Einen Ausblick in die Zukunft bietet das letzte Kapitel, das die beiden aktuellen architektonischen Konzepte des Blobs (mit Beispielen von Greg Lynn) und der Box (anhand von Jean Nouvels Monolith der Expo 02) einander gegenüberstellt und ihre formale Verwandtschaft mit Themen der zeitgenössischen Plastik betont. Als Synthese der beiden Positionen bietet sich ein virtueller Kunstraum von Peter Kogler an, der gleichsam die Grenzen zwischen Architektur und Skulptur verwischt. Das Pendant im realen Raum bildet eine Auftragsarbeit von Herzog & de Meuron, die im Museumspark Aufstellung gefunden hat.
Es liegt in der Natur der Dinge, dass die durch die Ausstellung forcierte Betonung der formalen Gemeinsamkeiten von Architektur und Skulptur zu einer Ausblendung der funktionalen Zusammenhänge und Eigengesetzlichkeiten beider Disziplinen führt. Immer wieder ertappt sich der Betrachter bei besonders überzeugenden Vergleichen dabei, die Frage nach «Architektur» oder «Skulptur» zu vergessen, zumal diese bei verschiedenen zeitgenössischen Arbeiten gar nicht mehr eindeutig zu beantworten ist. Indessen ist es müssig, die fehlende Differenzierung zu beklagen, zielt die Ausstellung mit ihrer dezidiert formalistischen Fragestellung doch ganz bewusst auf eine Ergänzung der «offiziellen» Geschichte der beiden Disziplinen ab. Die für das Verständnis der eigenständigen Entwicklungen moderner Architektur und Plastik unerlässlichen Hintergrundinformationen werden denn auch in den Katalogtexten stichwortartig nachgeliefert.
Weite Assoziationsräume
Dagegen muss das Projekt auf seinen Anspruch hin befragt werden, die Disziplinen in ein fruchtbares Zwiegespräch treten zu lassen. Es ist eine Stärke der Ausstellung, dass sie sich nicht auf paarige Vergleiche beschränkt und dass sie es unterlässt, stringente Beweisketten der gegenseitigen «Beeinflussung» zu konstruieren. Stattdessen fasst sie Kunstwerke und Architekturmodelle jeweils in Gruppen zusammen, was dem Betrachter weite Assoziationsräume eröffnet und ihn dazu auffordert, eigene Querbezüge und Analogien herzustellen. Einzelne Vergleiche mögen Opfer einer gewissen Beliebigkeit sein. Wenn etwa die Skulpturen Henry Moores in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen als Gesprächspartner für Architekturen herangezogen werden, so wirkt die Erkenntnis eines beidseitigen Anthropomorphismus alles andere als überraschend (dafür aber bisweilen fragwürdig).
Die methodischen Fallstricke werden dabei in der Ausstellung durchaus mitreflektiert. So ist die Gegenüberstellung von Originalskulpturen und - notabene - verkleinerten Architekturrepräsentationen in Form von Modellen keineswegs unproblematisch. Indem die Ausstellungsmacher in einem Vergleich von Hans Arps grossem «Schalenbaum» mit einem Miniaturmodell von Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum die realen Grössenverhältnisse in drastischer Weise auf den Kopf stellen, scheinen sie das eigene Vorgehen gleichsam zu ironisieren. Das ist klug und, auch hier, ein optischer Genuss.
verknüpfte Publikationen
- ArchiSkulptur
Bilder einer Stadt im Bau
Eine Fotoausstellung zeigt das „neue Zürich“
Zürich ist noch längst nicht gebaut. Gerade in den ehemaligen Industriequartieren im Norden und im Westen der Stadt sind in den letzten Jahren ganze neue Stadtquartiere entstanden. Diese Areale sind nur die besonders sichtbaren Zeichen dafür, dass an den Rändern Zürichs ein regelrechter Um- und Ausbau der Stadt im Gange ist. Mit der baulichen Entwicklung geht unweigerlich die Veränderung des Bildes einher, das die Einwohner von ihrer Stadt haben: Altvertrautes verschwindet, während grossflächige Neuplanungen den Massstab des Gewohnten sprengen.
Individuelle Blickwinkel
Diese Ausgangslage hat das Architekturforum Zürich zu einer Ausstellung angeregt, welche die Entwicklungen mittels einer fotografischen Bestandesaufnahme festhalten soll. Nicht um die objektive Dokumentation der Bautätigkeit sollte es dabei gehen, sondern vielmehr um die Spuren, welche diese in der Wahrnehmung der Bevölkerung hinterlassen hat. Die Kuratoren der Ausstellung haben deshalb in einem öffentlichen Wettbewerb die Bewohner aufgefordert, ihre eigenen Bilder zum „neuen Zürich“ beizusteuern.
Die über 150 eingegangenen Beiträge werden nun im Architekturforum präsentiert. Ergänzt werden sie durch die professionellen Aufnahmen dreier Fotografen, die den Auftrag zu einem Fotoessay zum gleichen Thema erhielten. Die Bilder von Joël Tettamanti, Derek Li Wan Po und Walter Mair zeugen, wie auch die Wettbewerbs-Einsendungen, von sehr individuellen Blickwinkeln, tragen aber zu einem umfassenden Bild von Zürich im Jahr 2004 bei. Herzstück der Ausstellung ist eine Bilderwand, auf der sämtliche Eingänge des Wettbewerbs gezeigt werden. Der Bilderbogen präsentiert unter Verzicht auf thematische Gliederungen ein faszinierendes und facettenreiches Bild Zürichs. Immer wieder geraten die spektakulären Neubauplanungen oder die neuen Stadtparks in den Blick, die Architektur und Landschaft in ganz neuer Weise miteinander verbinden. Die Bilder von Baustellen halten fest, dass der Stadtumbau in Zürich keineswegs abgeschlossen ist.
Verlust und Gewinn
Die Aufnahmen belegen, dass mit den grossen städtebaulichen Operationen immer auch Identität verloren zu gehen droht, zugleich aber neue Begegnungsfelder eröffnet werden. Entsprechend folgt eine grössere Bildgruppe dieser Spur. Sie rückt den Menschen in der Stadt ins Bild und damit den Lebensraum, der, je nach Sichtweise, durch die Bautätigkeit bedroht ist oder aber erst neu entsteht. Die von einer Jury bestimmten fünf Siegerfotos stellen einen guten Querschnitt durch die thematischen Schwerpunkte der Einsendungen dar. Von den Aufnahmen von Philipp Rohner, Christine Moser, Daniel Strolz, Raymond Vogel und Erika Heller wurden zur Ausstellung Postkarten gedruckt, denen man hoffentlich schon bald an möglichst vielen Zürcher Kiosken begegnen wird.
[ Architekturforum Zürich, Neumarkt 15. Bis 13. November. Die Jury präsentiert ihre Überlegungen an der Langen Nacht der Museen am 4. September. ]
Mehr Vision als Architektur
Das Werk von Moser und Nussbaumer
Spätestens mit dem preisgekrönten MFO-Park in Oerlikon sind Moser und Roger Nussbaumer, die verantwortlichen Architekten der Zürcher Zweigstelle des Architekturbüros Burckhardt und Partner, hierzulande auf den Plan getreten. Weitere Bauten haben ihrer Arbeit im Grossraum Zürich zu Sichtbarkeit verholfen, so etwa das Bürogebäude der Credit Suisse in Horgen oder die Umnutzung des ehemaligen Kesselhauses der Firma Terlinden in Küsnacht. Internationales Aufsehen erregte das Team mit dem Gewinn eines Wettbewerbs für ein Stadion in Peking, das im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Jahr 2008 gebaut werden soll. Zur Arbeit von Moser und Nussbaumer ist nun unter dem Titel „Vision und Architektur“ eine deutsch und englisch verfasste Dokumentation erschienen.
Der Hauptteil des aufwendig gestylten und durchwegs farbigen Buches wird durch die visuelle Präsentation der einzelnen Arbeiten in Form von Fotografien, Renderings, Plänen und Skizzen eingenommen, ergänzt jeweils um einen Kurzkommentar. Im Weiteren führen einige Aufsätze sowie ein Interview in die Arbeit des Duos ein. Der Bilderbogen ist in zwei Sektionen gegliedert, wobei die Vision gebliebenen Entwürfe - es handelt sich vor allem um städtebauliche Planungen und öffentliche Bauten - den eigentlichen Realisierungen vorangestellt sind. Bei Letzteren sticht die Überzahl der Geschäftsbauten ins Auge, deren clean anmutende Glashaut-Ästhetik an Theo Hotz anknüpft, bei dem beide Architekten - zum Teil langjährig - als Mitarbeiter tätig waren.
Insgesamt vermittelt der Band mit seiner opulenten optischen Ausstattung und seinen spektakulären, den Massstab des Kontexts sprengenden Architekturvisionen eher den Eindruck einer PR-Operation als einer sachlichen Dokumentation. Weniger (Bild- )Rhetorik hätte der Sache wohl besser getan.
[ Moser Nussbaumer. Vision und Architektur. Hrsg. Othmar Humm, Heinz von Arx. Birkhäuser, Basel 2004. 173 S., Fr. 78.-. ]
verknüpfte Publikationen
- Moser Nussbaumer
Calatrava - New York, Athen, Seefeld
Der 1951 in Valencia geborene Architekt Santiago Calatrava macht mit Bauten rund um den Globus von sich reden. Für Schlagzeilen sorgte der Spanier mit Zürcher Wohnsitz jüngst etwa als Sieger im Wettbewerb für den neuen Umsteigebahnhof am Ground Zero in New York oder mit dem Glasdach der Superlative über dem Olympiastadion in Athen. In Santa Cruz, der Hauptstadt Teneriffas, erstellte er kürzlich das Auditorio de Tenerife, ein aufsehenerregendes Konzertgebäude. In Valencia entstand eine Kunst- und Wissenschaftsstadt, ein aus vier Grossbauten bestehender Komplex. In Zürich ist Calatrava nicht nur im Hochschulquartier aktiv: Gegenwärtig sind im Seefeld an der Wildbachstrasse 57/59 (Ecke Münchhaldenstrasse) zwei Neubauten in Planung. Vorgesehen sind eine Büronutzung in den unteren Geschossen und Wohnungen in den oberen Etagen. Die beiden einander zugewandten Volumen werden je über einen dreieckigen Grundriss verfügen. Sie sollen sich über fünf gegen oben abgetreppte Obergeschosse sowie ein zusätzliches Dachgeschoss erstrecken. In der Schweiz hat Calatrava in den letzten Jahren neben dem Bahnhof Stadelhofen noch in St. Gallen die Wartehalle am Bohl sowie die Polizeiwache im Klosterbezirk entworfen. Im Aargauer Dorf Würenlingen baute er zudem eine Reihenhaussiedlung.
Schwebende Bibliothek
Santiago Calatravas spektakulärer Umbau an der Zürcher Rämistrasse
An der Hauptfassade des Universitätsgebäudes Rämistrasse 74/76 in Zürich sind zwar wenig Veränderungen zu sehen. Im Innenhof aber hat Architekt Santiago Calatrava mit seiner eingebauten Bibliothek für einen spektakulären architektonischen Akzent im Universitätsviertel gesorgt. Der Einbau liegt nur an acht Punkten auf und scheint fast zu schweben. Das Gebäude dient neu dem Rechtswissenschaftlichen Institut als Sitz.
Die Universität, also der Kanton Zürich, ist im Hochschulquartier in den letzten Jahren prominent als Bauherrin in Erscheinung getreten. Seit einigen Jahren ist die - inzwischen fortgeschrittene - Sanierung von Karl Mosers Kollegiengebäude im Gange, während der neue unterirdische Hörsaal vor dem Hauptgebäude von Annette Gigon und Mike Guyer im letzten Jahr in Betrieb genommen werden konnte. Dessen leuchtendes Farbkonzept von Adrian Schiess stiess ebenso auf den Beifall der Fachwelt wie die Gestaltung des Vorplatzes durch Guido Hager.
Unweit davon wird bis Ende Monat ein weiteres Prestigeobjekt bezogen, mit dem die hiesige Hochschule im Wettbewerb um die Gunst der Studierenden und Lehrkräfte wird auftrumpfen können: Stararchitekt Santiago Calatrava hat mit dem Um- und Ausbau der Liegenschaft an der Rämistrasse 74/76 einen spektakulären architektonischen Akzent gesetzt. An der Adresse wird erstmals das gesamte Rechtswissenschaftliche Institut (RWI) unter einem Dach gebündelt. Bisher waren die rund 40 Lehrstühle des Instituts über 8 Standorte verteilt.
Inszenierte Institutsbibliothek
Der Bau wurde zwischen 1905 und 1909 durch Kantonsbaumeister Hermann Fietz d. Ä. errichtet. Herzstück von Calatravas Eingriffen ist die zentrale, spektakulär inszenierte Institutsbibliothek. Während an der Hauptfassade zur Rämistrasse praktisch keine Veränderungen auszumachen sind, hat der Architekt den vormals offenen Innenhof der vierflügligen Anlage mit einer längsovalen Glaskuppel überdeckt. In den neuen Innenraum hat Calatrava eine sechsgeschossige Konstruktion gestellt, deren umlaufende linsenförmige Galerien das Oberlicht bis auf Erdgeschossniveau einfallen lassen. Dadurch, dass der Einbau nur gerade an acht Punkten aufliegt, bleibt die Struktur des alten Innenhofs weitgehend erhalten und deutlich ablesbar, womit einer Anforderung der Denkmalpflege Rechnung getragen werden konnte. Entstanden ist eine weiträumige, durch keinerlei Stützen blockierte Halle, über welcher der Bibliothekskoloss gleichsam zu schweben scheint.
Die Wahl der Materialien - weisser Naturstein für den Fussboden im Erdgeschoss und in den Erschliessungszonen sowie helles Holz für die übrigen Böden und die Brüstungen der Galerien - trägt zum Eindruck eines offenen und eleganten Innenraums bei. Dabei wurde sorgsam auf die Vermeidung von Halleffekten geachtet, die in einer Bibliothek keineswegs begrüsst würden.
10 Jahre Warten auf die Baubewilligung
Zum Bauprogramm gehörten neben der Bibliothek auch die Aufstockung der Flachdachbauten im hinteren Teil der Anlage sowie die Sanierung des Altbaus, die noch bis Ende nächsten Jahres andauern wird. Calatrava hatte zwar bereits 1989 einen Direktauftrag für den Umbau des Gebäudes vom damaligen Kantonsbaumeister erhalten - zu einer Zeit, als er mit dem neuen Bahnhof Stadelhofen gerade zum Shootingstar der Schweizer Architektur avanciert war. Dennoch mussten zehn Jahre ins Land ziehen, bevor 1999 das jetzt realisierte Projekt bewilligt wurde. Damit ist nun nicht nur der Raumbedarf des Instituts längerfristig gedeckt; auch konnte die Bibliothek - sie ist landesweit die zweitgrösste ihrer Art - mit 5000 Laufmetern Bücherregalen zur angemessenen Grösse ausgebaut werden. Durch die Schaffung von 500 Arbeitsplätzen wird zudem die unbefriedigende Situation der Studierenden wesentlich verbessert. Der Kreditrahmen von insgesamt rund 65 Millionen Franken wurde nicht überschritten.
Kontrast zwischen Alt und Neu
Nicht zuletzt lebt der Umbau von der Inszenierung des Kontrasts zwischen Alt und Neu: Während zwar die Korridore im Altbau auf die ursprüngliche Höhe rückgebaut wurden und dadurch an Offenheit gewinnen, ist ihre Wirkung nach wie vor eher düster. Umso deutlicher setzt sich davon der helle, durch die ehemaligen Fensteröffnungen einsehbare Bibliotheksraum ab; ein Kontrast, der dadurch verstärkt wird, dass der Zugang zur neuen Bibliothek nicht direkt von der Rämistrasse erfolgt, sondern rückseitig zur Schönleinstrasse liegt. Den Besuchern ist es überlassen, entweder um das Gebäude zum Bibliothekseingang herumzugehen oder aber bei der Rämistrasse einzutreten und die internen seitlichen Korridore zur neuen Eingangshalle zu benützen, wo sich Garderobe und Schliesskästen befinden.
So reizvoll diese Kontrastierung von Alt und Neu optisch sein mag, so sehr ist sie aber vom städtebaulichen Standpunkt und aus der Sicht der Benutzer zu hinterfragen: Der Haupteingang der Bibliothek ist in den für Nichteingeweihte schwer auffindbaren Hinterhof an der Schönleinstrasse verbannt. Dennoch vermag dieser Aspekt den bleibenden Eindruck des Bibliothekseinbaus kaum zu schmälern.
Der Meister von Ulm
Eine Monographie über Max Bill als Architekt
Als Hauptvertreter der konkreten Kunst braucht Max Bill zumindest in der Schweiz nicht weiter vorgestellt zu werden. Oft vergessen geht jedoch, dass der Künstler sich im Zürcher Telefonbuch offiziell als Architekt bezeichnete und dass er ein beträchtliches architektonisches OEuvre aufweisen kann, in dem die Ulmer Hochschule für Gestaltung oder die Bauten für die Expo 64 in Lausanne lediglich die prominentesten Beispiele darstellen. Die verbreitete Unkenntnis von Bills architektonischem Schaffen hängt zweifellos damit zusammen, dass eine umfassende Werkmonographie zur Architektur des 1994 Verstorbenen nach wie vor auf sich warten lässt.
Umfassender Überblick
Diese Lücke wenigstens partiell zu füllen, ist das erklärte Ziel der von der Zürcher Kunsthistorikerin Karin Gimmi herausgegebenen Doppelnummer der spanischen Zeitschrift „2G“. Zwar kann und will auch der vorliegende, optisch sehr ansprechend aufgemachte Band keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben; unter den zahlreichen vorgestellten Projekten und umgesetzten Bauten findet sich jedoch eine Reihe bisher nicht veröffentlichter Werke, die besonders das Interesse jener Leser wecken dürften, die mit Bills Arbeiten schon einigermassen vertraut sind. Neben der erstmaligen Präsentation verschiedener Projekte ist es ein wichtiges Verdienst der zweisprachigen, in Spanisch und Englisch erschienenen Publikation, das (zu) wenig bekannte architektonische Werk einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Dass die bis heute umfassendste Überblicksdarstellung zu Bills Architektur in einem spanischen Verlag erscheint, ist wohl als glücklicher Zufall der Rezeption zu werten, konnte doch die Ausstellung „Suiza constructiva“ von 2003 im Madrider Centro de Arte Reina Sofía ein reges Interesse an der konkreten und konstruktiven Kunst der Schweiz belegen.
Den Hauptteil der Zeitschrift nimmt das chronologisch geordnete, kommentierte und reich mit Skizzen, Plänen sowie historischen und zeitgenössischen Fotografien bebilderte Werkverzeichnis ein. Es beginnt mit zwei Skizzen für die Schweizerische Landesbibliothek in Bern aus dem Jahr 1927 - Bill weilte zu diesem Zeitpunkt vorübergehend am Bauhaus in Dessau, eine für den jungen Schweizer zeitlebens prägende Erfahrung - und führt mit den späten Pavillonskulpturen bis zum Todesjahr des Künstlerarchitekten, ja gar darüber hinaus. Damit wird praktisch der gesamte Zeitraum von Bills produktiver Phase abgedeckt. Unter den historischen Abbildungen finden sich einige bisher nie gesehene Fundstücke, während die aktuellen Aufnahmen Georg Aernis die Architektur von Bill im Sinne fotografischer Essays schön ins Bild fassen, was insbesondere auch für die sensible Annäherung des Fotografen an die Pavillonskulpturen gilt.
Zwischen Urhütte und Vorfertigung
Eingeleitet wird der Band von vier Aufsätzen ausgewiesener Bill-Kenner, die den theoretischen und historischen Hintergrund zum Werk des Zürchers unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten. Stanislaus von Moos betrachtet Bills Verwurzelung in der architektonischen Kultur der Nachkriegszeit unter dem Aspekt einer Suche nach der „Urhütte“ und zeigt die vielfältigen Bezüge zwischen Bills Architektur und seiner Skulptur, aber auch zu wichtigen künstlerischen Tendenzen der Zeit auf (Stichwort Minimal Art). Sodann befragt Hans Frei Bills Werk als „Transversale“ zwischen den Polen von Funktionalität und Ästhetik und ordnet es im Kontext des philosophischen Pragmatismus ein. Karin Gimmi nimmt sich des Ausstellungskünstlers Bill an und interpretiert einige von ihm gestaltete Ausstellungen als Spielfelder für städtebauliche Aufgaben - eine Domäne, die dem Architekten praktisch zeitlebens verschlossen blieb. Arthur Rüegg schliesslich zeichnet an drei ausgewählten Bauten die Genese einer Ästhetik der Vorfertigung nach und skizziert damit eine Differenz zwischen Architektur und blosser Konstruktion. Ergänzt werden diese theoretischen Positionen und der Werkkatalog durch einen Beitrag Jakob Bills zu den Pavillonskulpturen seines Vaters, den erwähnten Fotoessay Aernis zum gleichen Thema, eine Biografie sowie eine Auswahl an programmatischen Texten von Max Bill selbst. Vergebens sucht man hingegen nach einem aktuellen Literaturverzeichnis, das vom kunstwissenschaftlichen Standpunkt aus gerade im Wissen um den Forschungsstand und im Sinne des an die Publikation selbst gestellten Anspruchs wünschenswert gewesen wäre.
Mit den gesetzten thematischen Schwerpunkten verfolgen die Herausgeberin und die Autoren der einzelnen Textbeiträge eine betont weite Auffassung von Architektur, indem sie bisweilen die verschiedenen Facetten Bills als Grafiker, Ausstellungsmacher oder Bildhauer in den Vordergrund rücken. Dieses Vorgehen mag auf den ersten Blick diskutabel erscheinen; es wird jedoch gerechtfertigt dadurch, dass der Architekt Max Bill kaum verstanden werden kann ohne die Kenntnis seiner anderen künstlerischen Aktivitäten, ja dass diese, wie die Autoren in ihren Beiträgen überzeugend darlegen, ohne das Selbstverständnis Bills als Architekt in dieser Form kaum möglich gewesen wären. Erinnert sei hier nur an die eminent architektonische Dimension der Pavillonskulpturen. Somit resümiert der Band wichtige Forschungsergebnisse und stellt neue Erkenntnisse zur Diskussion, ohne aber durch den Anspruch an Wissenschaftlichkeit den optischen Genuss ausser acht zu lassen.
[ Max Bill Arquitecto/Architect (2G, Nr. 29/30). Hrsg. Karin Gimmi. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004. 276 S., Fr. 86.-. ]
Bauen für die Bahn
Ein Blick auf die zeitgenössische Schweizer Bahnhofsarchitektur
Die Wertschätzung für gutes Design und anspruchsvolle Architektur hat bei den SBB Tradition. Unter dem Label «Rail City» versucht nun die Bahn, gestalterische Qualität mit kommerziellen Interessen zu verbinden. Dass hochwertige Architektur ohne grosse Budgets möglich ist, belegt das Beispiel der Bahnhofhalle von Worb.
Ihr neuestes Aushängeschild haben die SBB im vergangenen Herbst mit der Eröffnung des neuen Zuger Bahnhofs erhalten. Das Werk von Hornberger Architekten aus Zürich ersetzte nach dreijähriger Bauzeit das alte Aufnahmegebäude von 1897, über dessen Abbruch man bereits seit den fünfziger Jahren nachdachte. Nach mehreren gescheiterten Urnengängen zu Projekten, die mit dem Bahnhofsbau zugleich die Ersetzung der angrenzenden Wohnblöcke durch Neubauten sowie einen zentralen Busbahnhof vorgesehen hatten, erhielt ein redimensionierter Vorschlag Ende der neunziger Jahre endlich grünes Licht.
Zug und Zürich
Entstanden ist ein Kompromiss zwischen Vision und Realität, der sich dennoch sehen lässt. Formal prägend ist die Lage zwischen den Gleissträngen der Luzerner- und der Gotthardlinie, die in einem spitzen Winkel zusammenlaufen. Im Dreieck dazwischen befand sich bereits das alte Aufnahmegebäude. Auch die beiden Schenkel des Neubaus folgen dem Verlauf der Gleise, um im Zwischenraum eine grosszügige verglaste Bahnhofshalle aufzuspannen, die zum zentralen architektonischen Ereignis wird. Hier laufen auch die Wegführungen vom wiederum auf das Stadtniveau abgesenkten Bahnhofsplatz und die neue unterirdische Querverbindung zwischen Grafenau- und Metalliquartier zusammen, wobei die Anbindung dieser benachbarten Areale - nicht zuletzt aufgrund der Redimensionierung des ursprünglichen Projekts - nicht zur vollen Befriedigung gelang.
Städtebaulich zu begrüssen ist dagegen die wiederhergestellte Lesbarkeit der erhöhten Lage der Gleise über der Stadt, indem die Perrons konsequent über Treppen erschlossen werden. Die Fassade des neuen Bahnhofs wird durch den Kontrast zwischen der zentralen, lichten Glashalle und den pylonenartig sie rahmenden, massiven Sichtbetonflächen geprägt, die ihrerseits die Kopfenden der beiden Gebäudeflügel bilden. Durch diese Konfiguration entsteht zum Bahnhofplatz eine Torsituation urbanen Massstabs. Wenn die Architektur selbst insgesamt wenig bildhafte Prägnanz schafft, so bildet sie doch eine angemessene Kulisse für die Hauptattraktion des Neubaus, die grossartige Lichtinstallation des Amerikaners James Turrell. Der Künstler hat in die umlaufenden Galerien der Obergeschosse der Halle Lichtbänder aus verdeckten Fluoreszenzröhren eingelassen, deren wechselnde Farben von den sandgestrahlten Glasbrüstungen der Galerien und den weissen Deckenuntersichten reflektiert werden und so den Raum in eine auch von aussen sichtbare Lichtskulptur verwandeln. Die Architektur dient als visueller Resonanzraum für ein zauberhaftes Farbenschauspiel.
Bereits seit dem Sommer 2002 besitzt der Zürcher Hauptbahnhof im provisorischen Bahnhof Sihlpost - er soll dereinst durch den unterirdischen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse abgelöst werden - ein einprägsames Beispiel für Raumgestaltung mittels Farbe und Licht. Die Architekten Knapkiewicz & Fickert haben die Gleise mit einer niedrigen, ingenieurmässigen Flachdachkonstruktion überdeckt, um nicht mit den Flügeldächern entlang der Perronhalle in Konkurrenz zu treten, die sie in Arbeitsgemeinschaft mit Meili & Peter entworfen hatten. Aus dem Dach ragen drei Laternen mit farbigen Seitenwänden aus gewellten Kunststoffpaneelen hervor, die eine optische Balance zur niedrigen Halle bilden und durch ihre Materialität zugleich den provisorischen Charakter des Baus unterstreichen. Von der Stadt her sichtbar, rufen diese Farbkuben die Lage des Bahnhofs zeichenhaft in Erinnerung.
Durch die transluziden Seitenwände dringt gelb und grün gefiltertes Tageslicht ins Innere der Halle, wodurch der überdachte Aussenraum in eine farbige, freundliche Atmosphäre getaucht wird, deren Intensität abhängig von Lichteinfall und Wetterlage ständig wechselt. Die Kuben sind an strategischen Orten auf das Dach gesetzt, um bald imaginäre Platzsituationen zu definieren, bald den Treppenaufgang von der Unterführung her zu bezeichnen, mit welcher der Bahnhof Sihlpost zur Perronhalle des Hauptbahnhofes hin erschlossen wird. Den von der Unterführung her kommenden Reisenden leuchtet das grün eingefärbte Licht entgegen und markiert als eine Art immaterieller Wegweiser den Aufgang. Mit dem jüngst abgeschlossenen Umbau des Shop-Ville durch die Winterthurer Architekten Arnold und Vrendli Amsler verfügt der Hauptbahnhof zudem über ein weiteres Anschauungsbeispiel dafür, wie mit Licht Raum gestaltet werden kann.
Basler Höhenwege
Der Bahnhof Basel SBB zählt zu jenen sieben grossen Bahnhöfen, welche die Bahn neuerdings als «Rail City» vermarktet. Das Label bezeichnet den Versuch, aus der für kommerzielle Nutzung attraktiven Zentrumslage der Bahnhöfe Kapital zu schlagen: Der Bahnhof ist auch ein Shopping- Center. Dass dieser Spagat zwischen Kommerz und Komfort für den Reisenden zu bewerkstelligen ist, beweist die 2003 in Basel eröffnete Passerelle über den Gleisen (NZZ 3. 10. 03). Der schmale Reiterbau der Architektengemeinschaft Cruz & Ortiz aus Sevilla und Giraudi & Wettstein aus Lugano ist ein Hybride - er gewährleistet über Treppen den Zugang zu den Perrons, verbindet als Fussgängerbrücke das Gundeldingerquartier mit dem Centralbahnhofplatz und der Innenstadt und ist als Einkaufsstrasse ein Höhenweg der alten Gleishalle entlang. Durch das markant gefaltete Dach scheint die Passerelle den Umriss eines Gebirgspanoramas in den Himmel zu zeichnen.
Die unverwechselbare Form der Passerelle wird zum weithin sichtbaren Zeichen. Vor allem städtebaulich ist die Passerelle von grosser Qualität, indem sie zwei durch die Eisenbahn voneinander getrennte Stadtteile verbindet. Allerdings wird die lineare Wegführung durch einen Knick vor der Rampe zum Gundeldingerquartier, wo die Passerelle in einem Kopfbau ihren Abschluss findet, unnötig verunklärt. In gerader Fortsetzung der Passage befindet sich statt der Verbindung zur Stadt der Eingang in ein Ladengeschäft - hier muss die lineare Logik des Baus der Vermarktung des Bahnhofs als Einkaufszentrum doch noch Tribut zollen. Dafür erreicht der Bau am anderen Ende eine Klärung der Situation, indem die denkmalgeschützte Empfangshalle des Bahnhofs nun als grosszügiges Foyer dient. Die Materialisierung der Passerelle lebt vom dunklen Steinboden, von den Wänden aus Metall und Glas sowie der Wärme der Akustikplatten an der Faltendecke. Gleichwohl sind nicht alle Details gleichermassen gelungen: Während der gezackte Verlauf des Daches als raffiniertes Spiel mit der Vorgabe der Bogenstellungen der Perronhalle gelesen werden darf, wirken die in die Passerelle hineingestellten rektangulären Pavillons als formale Fremdkörper, die den Blick auf die Gleise teilweise versperren. Dennoch haben die Architekten mit der Passerelle mehr als nur einen Ort des Transits geschaffen.
Bern und Worb
Anders als in Basel führt der Weg der Ankommenden in Bern zunächst nicht ans Licht, sondern in den Untergrund, auch wenn die 2002 neu installierte indirekte Beleuchtung den ungünstigen Eindruck abzumildern vermag. Diesen düsteren Verhältnissen antwortet das neu gestaltete Hauptgebäude an der Oberfläche mit einer Architektur der Leichtigkeit und Transparenz. Nach der Renovation der überdachten Bahnhofshalle durch Frank Geiser im Jahr 1999, die einen ersten Akzent auf Tageslicht und Helligkeit setzte, lag es in den folgenden Jahren am Atelier 5, dem Bahnhof ein neues Gesicht zu verleihen. Der erste wesentliche Eingriff lag in der Schaffung eines deutlich lesbaren Haupteingangs zum Bahnhofplatz hin, durch den die Bahnhofshalle an die Stadt angebunden wird. Die Neugestaltung der Eingangssituation ging Hand in Hand mit dem Bau einer voll verglasten Fassade, die - ähnlich wie in Zug - zur Stadt hin Offenheit signalisiert, hier aber um das ganze Gebäude herumläuft.
An der Stirnseite des Baus am Bahnhofplatz kontrastiert die gläserne Immaterialität der Obergeschosse mit dem mittig angeordneten Haupteingang, der sich über zwei Etagen erstreckt und als dunkler Schlund die Reisenden förmlich in die Bahnhofshalle zu saugen scheint. Die abgerundeten Ecken der Glasfassade verkörpern Dynamik und erscheinen als späte Reverenz an Frank Lloyd Wrights Johnson Building in Racine, Wisconsin. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofplatzes haben die Architekten das Ensemble durch den Bau der hohen, ebenfalls lichten Nordhalle ergänzt, die der Abfolge Bahnhofplatz - Haupthalle eine quer gelagerte Achse entgegensetzt, die die Neuengasse mit dem Postautobahnhof verbindet, aber auch durchlässig zu allen Ebenen des Bahnhofgebäudes ist. Die Halle wirkt aufgrund ihrer Proportionen wie ein gläserner Korridor, signalisiert aber das Bestreben der SBB, mit ihren Bahnhöfen städtebaulich sensible Lösungen zu ermöglichen und zugleich mit einer Ästhetik der Transparenz eine moderne Firmenkultur zu verkörpern.
Noch hat der Bahnhof Bern sein endgültiges Aussehen nicht erhalten, ist doch die Planung für einen neuen Westzugang in vollem Gange. Für diesen haben Beat Mathys und Ursula Stücheli vom Berner Architekturbüro Smarch eine Serie von gewellten Perrondächern entworfen. Verdienste im Bereich grösserer Infrastrukturbauten hat Smarch bereits mit dem Bau des Bahnhofs Worb des RBS (Regionalverkehr Bern-Solothurn) erworben, der Ende 2002 fertiggestellt wurde. Fernab von den grossen Bahnhofprojekten der SBB haben die Architekten zusammen mit dem renommierten Ingenieurbüro Conzett, Bronzini und Gartmann aus Chur geschickt die Funktion einer Endstation mit der einer Einstellhalle und einer Parkgarage im Obergeschoss verbunden und in ein starkes architektonisches Bild gefasst.
Der Bau befindet sich zwischen dem alten Stationsgebäude und der Güterstrasse, deren Biegung er im Grundriss aufnimmt. Der lang gezogene Hallenbau von 130 Metern Länge wird von einer Reihe von Chromstahlstützen getragen und von einem Holzdach bedeckt. Die Fassade besteht zu beiden Längsseiten aus reflektierenden Chromstahlbändern, die zwischen die Stützen eingespannt sind - eine Materialisierung, mit der Smarch an Jean Prouvés Metallarchitektur anknüpft. Die Bänder vermögen den Bau gerade aufs Nötigste zu bekleiden, klaffen doch zwischen den Metallbahnen schmale Schlitze, die von aussen den Blick ins Innere freigeben, dort aber bei entsprechender Sonneneinstrahlung für ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten sorgen.
Mit ihrer grundsätzlichen Frage nach dem Sinn und dem Wesen einer Wand, die die Architekten mit dieser Fassade implizit stellen, liefern sie auch ein Stück gebauter Architekturtheorie: Der Verweis auf Gottfried Sempers Bekleidungstheorie scheint ebenso berechtigt wie der Hinweis auf die Obsession der Disziplin mit der Urhütte aus Stützen und geflochtenen Wänden als architektonischem Urbild überhaupt. Mit dem Kopf des Bahnhofs und seinem dramatisch vorkragenden Dach scheint Smarch dagegen Jean Nouvels Luzerner KKL zu zitieren, eine Assoziation, welche vom Ausblick im Obergeschoss bestätigt wird. Die mit hellen Metallplatten verkleidete Dachuntersicht schneidet ähnlich wie in Luzern bildhaft ein streifenartiges Panorama aus dem Gesichtsfeld aus. Hier oben erst erhält der Reisende das Gefühl, wirklich angekommen zu sein.
Orte, Menschen, Architektur
Giancarlo De Carlo im Centre Pompidou
Selten nur stehen ein Architekt und eine Stadt in derart enger Beziehung wie Giancarlo De Carlo und Urbino. In rund 50 Jahren hat der 1919 geborene Italiener das Gesicht der Universitätsstadt mit Bauten an der Peripherie und im historischen Zentrum nachhaltig geprägt. Aus der Maxime der behutsamen Intervention entwickelt er seine Methode des „reading“, das Architektur als Resultat einer topologischen, historischen und sozialen Lektüre des Orts begreift. De Carlos Dissens innerhalb der CIAM und seine Mitgliedschaft bei Team X ab 1959 sind damit vorgezeichnet. Seiner Bedeutung entsprechend, gehört die erste Hälfte der Pariser Ausstellung dem Fall Urbino. Anhand von Exponaten und Interviews wird De Carlo als Architekt, Lehrer, Publizist und Aktivist präsentiert. Im zweiten Teil weitet sich der Blick auf das übrige Werk, wobei den Siedlungen Matteotti bei Terni sowie Mazzorbo besonderes Gewicht zufällt. Hier realisiert De Carlo seine Idee der Partizipation, die den zukünftigen Bewohnern Mitsprache beim Entwurf einräumt: Architektur, verstanden als Reflexion auf den Ort und die Bedürfnisse der Menschen.
[ Bis 14. Juni; anschliessend in Genf (Fondation Braillard Architectes), Brighton und Rom. Katalog: Des lieux, des hommes. Hrsg. John McKean und Giancarlo De Carlo. Axel-Menges-Verlag, Stuttgart 2004. 240 S., EUR 39.90. ]
Das verdrängte Gedächtnis der Postmoderne
Die architekturgeschichtliche Bedeutung von Robert Venturis „Entdeckung“ Roms
Das Werk des 1925 geborenen amerikanischen Architekten Robert Venturi gilt - seinen eigenen Reserven zum Trotz - als wesentlicher Beitrag zur Genese der Postmoderne. Wenn die Forschung Venturis Kritik an einem als totalitär empfundenen Modernismus bisher vornehmlich vor dem amerikanischen Hintergrund interpretiert hat, so wurde übersehen, dass die Beschäftigung mit der europäischen Architektur deutliche Spuren in seiner intellektuellen Biografie hinterlassen hat. So wirft Venturis mutmassliche Konfrontation mit dem zeitgenössischen Bauen in Rom die Frage auf, wo die Geburtsstunde postmoderner Architektur angesetzt werden darf.
Der Name des amerikanischen Architekten und Theoretikers Robert Venturi wird in den Überblicksdarstellungen zur jüngeren Architekturgeschichte oft und gern mit dem Label der Postmoderne in Verbindung gebracht. Als Belege für die Richtigkeit dieser These werden mit Vorliebe Venturis frühe Bauten in Philadelphia angeführt, allen voran das Mother's House genannte Vanna Venturi House (1959-64) und das Guild House (1960-66). Fast noch grösseres Gewicht kommt dabei den beiden frühen Schriften aus der Feder Venturis und seiner Partner zu: „Complexity and Contradiction in Architecture“ von 1966 sowie „Learning from Las Vegas“, das sechs Jahre später eine Theorie des Städtebaus nachlieferte. Da hilft es wenig, dass Venturi sich in jüngster Zeit vehement von der Postmoderne distanziert und seine angebliche Vaterschaft dieser architektonischen Bewegung bestreitet. Man muss ihm die Reaktion nachsehen, ist postmoderne Architektur doch aus der Mode gekommen und das Kürzel „PoMo“ nachgerade zum Synonym schlechten Geschmacks geworden.
Anfänge der Postmoderne
Dabei hatte in den siebziger Jahren alles nach einem Aufbruch ausgesehen, als Autoren wie Charles Jencks unter dem Eindruck einer Reihe von (vornehmlich amerikanischen) Neubauten euphorisch den Beginn einer neuen Epoche in der Architektur verkündeten, die Schluss machen sollte mit der Tabula-rasa-Haltung der Avantgarde und stattdessen für eine Re-Inthronisierung von Tradition und historischem Bewusstsein plädierte. Jencks' Theorie der Postmoderne ging von einer hybriden, das heisst doppelt codierten Architektur aus: Sie verfügte über ein elitäres und ein populäres Register, appellierte also gleichzeitig an das Architekturverständnis der avantgardistischen Elite und der breiten Masse. Diese Theorie liess sich mühelos an einem Bau wie dem Guild House demonstrieren, an dem sich Allusionen sowohl an konventionelle Formeln des sozialen Wohnungsbaus als auch an die Palazzo-Architektur eines Palladio manifestieren.
Zwar stand auch Jencks der Position Venturis und seiner Partnerin Denise Scott Brown ambivalent gegenüber, liessen ihre Bauten seiner Meinung nach doch jenen „radikalen Inklusivismus“ vermissen, den er für die (wahre) postmoderne Architektur als grundlegend erachtete. Dennoch sah er im North Penn Visiting Nurses Association Headquarters (1961) das „erste Anti-Monument des Postmodernismus“. Während sich in der Folge die Geschichte der architektonischen Postmoderne mehr oder weniger entlang der von Jencks gesetzten Leitplanken fortschrieb, rückte „Complexity and Contradiction in Architecture“ zusehends in die Rolle eines Manifests der Postmoderne. Insbesondere die darin geäusserte Kritik am Dogmatismus des späten Modernismus der Nachkriegszeit und Venturis Transformation des Mies'schen Leitspruchs „Less is more“ in das kämpferische „Less is a bore“ - die er im Übrigen späterhin reumütig zurücknahm - schienen diese Interpretation zu rechtfertigen.
Venturi in Rom
Bei einem Blick auf die Rezeption ist augenfällig, dass Venturis Revision des Modernismus praktisch ausschliesslich vor dem amerikanischen Hintergrund interpretiert wurde. So galt (und gilt) sein Beitrag als Opposition zum strukturellen Expressionismus der amerikanischen Nachkriegsmoderne. Dabei ging jedoch vergessen, dass sich Venturis Position keineswegs auf die (aneignende oder ablehnende) Auseinandersetzung mit der amerikanischen architektonischen Kultur der Nachkriegszeit reduzieren lässt. Bereits Charles Jencks erblickte in Venturis „Historismus“ eine Parallele zur italienischen Architektur der fünfziger und sechziger Jahre, unterliess es jedoch, zwischen diesen beiden ein kausales Verhältnis herzustellen. Mit Blick auf Venturis Biografie lässt sich die These indessen radikalisieren, indem in der Tat ein direkter Zusammenhang zwischen der italienischen Architektur der fünfziger Jahre und Venturi belegt werden kann.
Anlass dazu gibt der Umstand, dass der Absolvent der Princeton University 1954 einen zweijährigen Aufenthalt an der American Academy in Rome (AAR) antrat. Schon darin äussert sich eine zum Modernismus kritische Gesinnung, hatte doch Le Corbusier 1922 in „Vers une architecture“ verlauten lassen: „Roms Lehre ist für die Weisen (. . .). Nach Rom Architekturstudenten zu schicken, heisst sie für ihr ganzes Leben zu ruinieren.“ Davon liess sich Venturi indessen nicht abschrecken - ganz im Gegenteil. Bereits im Rahmen einer Europareise im Jahr 1948 hatte sich ihm die Entdeckung Roms als unvergessliches Erlebnis so sehr eingeprägt, dass er bis heute den Tag seiner Ankunft mit einem jährlich wiederkehrenden Erinnerungsbesuch feiert!
Uneingestandene Erbschaften
Aus seiner Begeisterung für Rom hat Venturi nie ein Hehl gemacht. Bereits seine 1950 in Princeton abgelieferte Master's Thesis bezieht sich in diversen Beispielen auf die historische Architektur Roms, wobei der junge Architekt eine Affinität zum Barock mit seinen geschlossenen Platzkonzeptionen bewies. „Complexity and Contradiction in Architecture“ sodann lässt sich, obwohl in einem Abstand von zehn Jahren nach der Rückkehr aus Rom verfasst, als Verarbeitung der dort gewonnenen Eindrücke verstehen. Durch die Erläuterung historischer Beispiele zielt das Buch darauf ab, überzeitlich gültige kompositorische Regeln zu formulieren, die für das Bauen in der Gegenwart - Venturis eigene Architektur - relevant sind. Der Rekurs auf die Architekturgeschichte dient so als Strategie der Legitimation der eigenen ästhetischen Präferenzen.
Wie aber verhält es sich mit der behaupteten Beschäftigung Venturis mit der zeitgenössischen italienischen Architektur? Obwohl die Erinnerung den Architekten in diesem Punkt im Stich lässt, ist davon auszugehen, dass er sich sehr wohl für das Schaffen seiner italienischen Kollegen interessierte. Sowohl die Jahresberichte der AAR als auch die Korrespondenz Venturis mit seinen Eltern lassen diesen Schluss zweifelsfrei zu. Einen ersten Anknüpfungspunkt boten die Städtebauseminare des Istituto Nazionale di Urbanistica, zu denen auch die Stipendiaten der AAR eingeladen wurden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen hatte Venturi die Möglichkeit, Einblick in die aktuellen Probleme der italienischen Architektur jener Jahre zu gewinnen und, seinen rudimentären Italienischkenntnissen zum Trotz, Bekanntschaft mit ihren wichtigsten Vertretern zu schliessen.
Von besonderer Bedeutung war indessen die Begegnung Venturis mit Ernesto Rogers. Der Mailänder Architekt betreute im akademischen Jahr 1954/55 die Stipendiaten der AAR bei der Ausarbeitung eines Projekts für neue Ateliers, die im Park des Sitzes der Institution situiert werden sollten. Venturis Aufzeichnungen belegen, dass sich als Folge dieser Begegnung ein freundschaftliches Verhältnis entspann. Sein Projekt wurde 1955 der Öffentlichkeit präsentiert. Rogers auf der anderen Seite machte seinen Einfluss auf die jungen amerikanischen Kollegen auch insofern geltend, als er ihnen im Rahmen von Exkursionen die neuere italienische Architektur näherbrachte.
Die Begegnung mit Ernesto Rogers wäre vielleicht nicht weiter bemerkenswert, müsste man den Mailänder Architekten nicht als eine der zentralen Figuren in der italienischen Architekturdiskussion der fünfziger Jahre bezeichnen. Als Herausgeber der einflussreichen Zeitschrift „Casabella Continuità“ wurde ihm ab 1953 beträchtliches Gehör zuteil. Noch in den dreissiger Jahren hatte „Casabella“ als Sprachrohr des Razionalismo gedient, und auch die frühen Bauten von Rogers (beziehungsweise BBPR) lassen sich in diesen Kontext einordnen. Obwohl das Epitheton „Continuità“ - es wird dem Zeitschriftentitel mit der Neulancierung beigefügt - dem Modernismus seine Reverenz zu erweisen scheint, lässt sich in Rogers' Leitartikeln die Genese einer zunehmend eigenständigen Position beobachten, die auf Distanz geht zum rationalistischen Erbe. Wichtig werden in der Argumentation nun Stichworte wie Tradition und historisches Bewusstsein. Der radikale Bruch der Moderne mit der Vergangenheit ist für Rogers problematisch geworden.
Zentral in der Beweisführung des Mailänders ist die Kritik am modernen Formalismus, dem er einen erweiterten Funktionalismusbegriff entgegensetzt. Demgemäss hat der funktional gestaltete Bau nicht nur, nach „moderner“ Manier, seine Konstruktion und sein (Raum-)Programm zum Ausdruck zu bringen, sondern - und das ist neu - zugleich seinen Ort im städtischen und historischen Kontext zu reflektieren. Gebautes Manifest dieser Kritik an den Dogmen des Modernismus ist die Torre Velasca von BBPR in Mailand (1958), die aufgrund ihrer formalen Reflexion des Kontexts Anlass zur Polemik aus dem Ausland bot. Als Wortführer unter den Kritikern figurierte Reyner Banham, der den Italienern lauthals den „Rückzug von der modernen Architektur“ vorwarf. Nach Rogers' Auffassung freilich hatten er und seine Kollegen nicht mit der Moderne gebrochen, sondern mit dem Funktionalismus erst richtig Ernst gemacht. Die historisch und kontextuell sensible Architektur sollte sich formal an einer „funktionalen“ Analyse der Gegebenheiten des gebauten Umfelds orientieren. Im Falle der Torre Velasca bestand der Bezugsrahmen etwa in den gotischen Formen der Mailänder Altstadt und im regionalen Bautypus des Geschlechterturms. Damit wurde der Universalitätsanspruch des International Style in Frage gestellt. Die Debatte um kontextualistisches Bauen der folgenden Jahrzehnte scheint somit bei Rogers vorweggenommen.
Damit ist der Verweis auf das architektonische Denken Venturis gemacht. Wie bei den Italienern ist für Venturi der Bezug auf Ort, Tradition und Architekturgeschichte von eminenter Bedeutung. In Kenntnis von Venturis Bekanntschaft mit Rogers liegt zumindest der Verdacht auf der Hand, dass diese grosse ideelle Nähe mehr als nur auf Zufall beruht. Obwohl Venturis Interesse am kontextuell sensiblen Bauen bereits für die Studienzeit verbürgt ist, darf man spekulieren, dass er im italienischen Umfeld eine Bestätigung seiner eigenen Überzeugungen fand, mehr noch: dass er sich die Überlegungen der Italiener zu eigen machte, um zu Hause für eine Relativierung eines Modernismus zu werben, dessen formale Verpflichtung auf die Industrieästhetik er als totalitär empfand. Jencks' These einer ideellen Verwandtschaft der italienischen Forschungen der fünfziger Jahre mit der Venturi-Schule erhält durch Venturis Biografie entscheidenden Auftrieb.
Pragmatismus und Utopie
Nicht nur Venturis „Kontextualismus“ ist indessen in der italienischen Architektur der fünfziger Jahre vorweggenommen. Gleiches lässt sich auch von seinem Interesse am „American vernacular“ behaupten. Dieses zeigt sich in „Learning from Las Vegas“, wo das „Commercial vernacular“ der amerikanischen Geschäftsstadt zum Ausgangspunkt der Theorie der „dekorierten Schuppen“ wird, aber auch in diversen Wohnhäusern der Venturis, die sich an traditionellen amerikanischen Bautypen orientieren und diese - mit den von der Pop-Art erprobten Mechanismen - gleichsam verfremden. So berufen sich die Trubek and Wislocki Houses explizit auf die anonyme Holzarchitektur von Nantucket Island.
Der Bezug auf volkstümliche Architekturformen erfreute sich unter dem Etikett des Neorealismo auch in der italienischen Nachkriegszeit grosser Beliebtheit. Seine Hauptvertreter - zu erwähnen sind etwa Mario Ridolfi und Ludovico Quaroni - verfolgten den Ansatz, um den vom Lande ankommenden Flüchtigen in den rapide expandierenden Vorstädten die pittoreske Illusion eines intakten Dorflebens zu gewähren. Bekanntes Beispiel ist das Römer Tiburtino-Quartier (1949-54). Monotonie und Wiederholung, als negative Charakteristika des Modernismus gebrandmarkt, werden hier zugunsten eines Eindrucks von Spontaneität und informeller Organisation vermieden. Gemeinsam ist Venturi und dem Neorealismo eine grundsätzliche Orientierung des Entwurfs an der real gebauten Umwelt - der ländlichen italienischen Architektur auf der einen Seite, dem „American vernacular“ auf der anderen. Während aber im Fall des Neorealismo von einer regressiven Utopie die Rede sein muss, versagt sich Venturi jeder Teleologie. Ausgangspunkt des Entwurfs ist keine wie auch immer geartete Idealvorstellung (etwa des intakten Dorflebens), sondern die spezifische, radikal sachbezogene Analyse der realen Gegebenheiten. Es stehen sich ein utopischer und ein pragmatischer Realismus gegenüber.
Eingestandene Erbschaften
Im Unterschied zu diesen Spekulationen zum ideellen Zusammenhang zwischen Venturis architektonischem Denken und den Themen der italienischen Architektur der fünfziger Jahre ist die Bedeutung des Werks Luigi Morettis für Venturi unbestritten. Das gilt insbesondere für die in „Complexity and Contradiction in Architecture“ explizit erwähnte Casa del Girasole (1947-50) in Rom, der die etwas frühere Casa Astrea (1947-49) jedoch kaum nachsteht. In der Tat lassen sich wichtige Merkmale der beiden frühen Hauptwerke Venturis, des Vanna Venturi House und des Guild House, als direkte Auseinandersetzung mit der Casa del Girasole lesen. Themen wie die Axialsymmetrie (in Auf- und Grundriss), die Zweiteilung der Fassade - Dualität als architektonisches Thema wird in Venturis Publikation explizit behandelt -, die historischen Allusionen sowie die Behandlung der Fassade in Form eines zweidimensionalen Screens (im Sinne eines Bildes über Architektur) sind Merkmale der Werke beider Architekten, die späterhin zu Merkmalen postmoderner Architektur schlechthin erklärt wurden. Venturis für die Postmoderne konstitutiven Frühwerke wären, so ist zu schliessen, ohne Morettis Exempel undenkbar. Mehr noch: Venturi als einen der einflussreichsten Vertreter der Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hätte es ohne die Kenntnis der italienischen Architektur der fünfziger Jahre und ohne Luigi Moretti in dieser Form wohl nicht gegeben.
Genealogie der Postmoderne
Das führt abschliessend zurück zur Frage nach der Genealogie der Postmoderne. Wenn deren Apologeten insbesondere Venturis Frühwerk zum Kanon postmoderner Architektur zählen, muss aufgrund der aufgezeigten ideellen und formalen Korrespondenzen ein erheblicher Teil der italienischen Architektur der fünfziger Jahre in die Vorgeschichte der Postmoderne integriert werden. Will man aber die künstlerische Postmoderne - etwa mit Frederic Jameson - als Symptom eines grundlegenden gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Paradigmenwechsels verstehen, so ist diese Ausweitung problematisch, erfüllt doch die zur Diskussion stehende Dekade zentrale Voraussetzungen dafür nicht.
Mithin darf die Debatte um die architektonische Postmoderne nicht als abgeschlossen betrachtet werden, da sich die Theorie unter diesem Aspekt als defizitär erweist. Bei einem zukünftigen Definitionsversuch wäre in einem nächsten Schritt der Paradigmenwechsel einer Auffassung von Architektur als Raumkunst hin zu einer solchen als symbolisches Kommunikationssystem zu untersuchen, wie ihn die Venturis in „Learning from Las Vegas“ vollziehen. So könnte es gelingen, die Theorie der postmodernen Architektur in ein übergreifendes kulturtheoretisches Modell einzubinden.