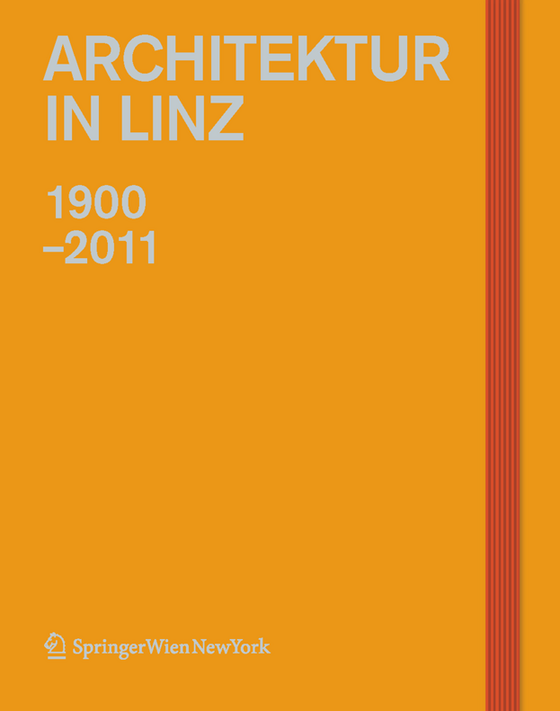Wien-Donaustadt: Wo alte und neue Österreicher zusammenleben
Mit seinem integrativen Konzept überzeugte das Wohnprojekt „Assemblage Niklas Eslarn“ in Wien-Donaustadt bei einem Bauträgerwettbewerb: In den 31 geförderten Mietwohnungen leben nun je zur Hälfte alte und neue Österreicher, gebaut wurde teils mit Lehm und Stroh.
Räume für Menschen“ (RfM): ein schöner Name für ein Architekturbüro. Jutta Wörtl-Gössler und Uli Machold arbeiten interdisziplinär und bauen ökologisch, gern auch mit Lehm und Stroh. Kurz vor Eröffnung des Baugruppenprojekts „Assemblage Niklas Eslarn“ herrscht in ihrem Büro rege Geschäftigkeit. Lange Stoffbahnen legen sich über die Schreibtische, von Bewohner:innen bedruckt, die der exponierten Westfassade als Sonnen- und Sichtschutz dienen werden und Teil sind des dreiteiligen Kunstprojekts „Assemblage familiar: stories from/form home“, das von der Kunst im Öffentlichen Raum (KÖR) gefördert wurde.
Die Baugruppe, die Mitte des Jahres dort ihre 31 geförderten Mietwohnungen, davon 16 Smart mit Superförderung, bezogen hat, besteht etwa zur einen Hälfte aus Österreicher:innen, zur anderen aus Asylwerbenden, anfangs mit Bleiberecht, inzwischen eingebürgert. „Es ist ein Modellprojekt der Integration“, erklärt Susan Kraupp. Sie ist das Mastermind hinter SK Stadtplanung & Architektur, ihre Mutter stammt aus dem Iran und war dort Architektin. „Asylberechtigte haben großen Bedarf an Wohnraum, finden aber selten Zugang zum sozialen Wohnbau.“ Viel öfter kommen sie in überteuerten Unterkünften unter, die einen unschlagbaren Vorteil haben: Sie sind rasch verfügbar, beziehbar, und man muss nicht erst zwei Jahre einen Hauptwohnsitz in Wien gehabt haben.
Begonnen hat alles Ende 2019 mit einem Bauträgerwettbewerb der Gemeinde Wien für Baugruppen. Wörtl-Gössler hatte zehn Jahre in der Gebietsbetreuung gearbeitet und weiß, dass Integration am besten über gemeinsame Interessen funktioniert. Sie hatte die Idee mit der integrativen Baugruppe und suchte eine Partnerin für den Bewerb, Kraupp war sofort Feuer und Flamme. Die algerische Journalistin Rachida Toubal arbeitete damals am Berufsförderungsinstitut BFI und vermittelte interessierte Asylwerbende mit Wohnbedarf, die Architektinnen trieben integrationsbereite, wohnungssuchende Österreicher:innen auf.
Vom Baby bis zur 80-Jährigen
Die Gemeinnützige Familienhäuser-, Bau- und Wohnungsgenossenschaft Gartenheim nahm mit dem Projekt am Wettbewerb teil, das integrative Konzept überzeugte. Die Baugruppe ist sehr divers, vom Baby bis zur 80-Jährigen sind alle Altersklassen und viele Herkünfte vertreten: Österreich, Afghanistan, Pakistan, Syrien, Gaza, Somalia, Türkei, Ukraine. Zum Großteil leben Jungfamilien hier, vereinzelt Singles, Berufe gibt es viele. Die Wohnungsgrößen variieren von 30 bis 120 m², einige Familien haben bis zu fünf Kinder. Die Soziologin Andrea Schaffar moderierte die Gruppenfindung.
Der Bauplatz liegt etwas östlich von der Seestadt Aspern in einem Einfamilienhausgebiet, im Osten bildet eine dreigeschoßige Siedlung sein Gegenüber, im Süden grenzt die Niklas-Eslarn-Straße an einen Wald mit dem „Himmelteich“. Dieser Wald wird sicher nie verbaut. Susan Kraupp entwickelte den Städtebau, sie teilte das Grundstück an zwei Wegachsen in neun gleichwertige Felder auf und ordnete die Bebauung an den Rändern rund um das Gemeinschaftshaus in der Mitte an, das von einem Freiraum umgeben ist und eine Art Dorfplatz bildet. Die umgebenden Felder sind paritätisch auf beide Architekturbüros aufgeteilt.
Brandtest erfolgreich absolviert
RfM Architektur setzte geradlinige Holzriegel an den westlichen und nördlichen Rand des Grundstücks. Die 16 modular aufgebauten, durchgesteckten Wohnungen haben neun unterschiedliche Grundrisse, vier davon sind Maisonetten, eine Typologie, die derzeit sehr selten anzutreffen ist. Zwischenwände und Decken sind aus Massivholz, die tragenden Außenwände mit Einblasstroh gedämmt und mit Lehm verputzt, der in einem Workshop gemeinsam aufgebracht wurde. Diese Wandkonstruktion ist generell ein Experiment, im sozialen Wohnbau erst recht. Sie wurde vom Klima- und Energiefonds gefördert, sonst wäre sie nicht finanzierbar gewesen.
Die Projektgruppe setzte ein Modul einem Brandtest aus: 78 Minuten hielt es dem Feuer stand. „Es gibt keine bessere Gegend für Jungfamilien“, sagt die Mutter, die mit ihren zwei Kindern eine Maisonette bewohnt. Sie riecht nach Holz und Erde, die Massivholzdecke blieb unverputzt, der Lehm ockerfarben, die Außenwände sind 45 cm breit. Genug, um alle Fensterrahmen als Sitznischen zu gestalten. Vier Meter Spannweite zwischen den Wänden sind für Holz ideal, einzig die große Wohnküche erfordert einen Deckenträger aus weißem Stahl.
Susan Kraupp entwarf plastisch ausformulierte Punkthäuser aus Ziegelit, Leichtbeton, dem recycelter Ziegelsplitt beigemischt wurde. Das gibt ihm eine rötliche Farbe, die durch Pigmente verstärkt wird. Kraupp entwickelte ihre Baukörper aus der Grundform eines Würfels von elf mal elf Metern. Die eingeschoßigen Wohnungen sind in jeder Ebene leicht gegeneinander verdreht. Einige Häuser dehnen sich über das Grundmaß hinaus, in die drei größeren ist in der Mitte wie ein Keil das Stiegenhaus eingeschoben. Das erzeugt trapezförmige Räume und verschiedene Balkone, beim kleinsten Bau sitzt das Stiegenhaus an der östlichen Außenwand.
Offenes Bücherregal für Sprachaustausch
Ursprünglich hatte Kraupp monolithisch aus Dämmbeton bauen wollen, das war nicht leistbar. Ihre Wohnungen sind introvertierter, haben kleinere Fenster, mehr Wandflächen, auf Wunsch abgetrennte Küchen und große Wohnzimmer, die von zwei Seiten belichtet sind. Hier finden die riesigen Sitzgarnituren, die der sprichwörtlichen orientalischen Gastfreundschaft huldigen, leicht Platz. „Der Wohnbereich war der Bewohnerschaft sehr wichtig, die anderen Zimmer durften durchaus kleiner sein“, sagt Kraupp.
Während der Errichtung der Wohnanlage stiegen die Baupreise eklatant. War sie bei der Ausschreibung mit sechs Mio. Euro budgetiert, stiegen die Kosten auf zwölf Mio. Die Gartenheim und die Architektinnen sparten durch Umplanungen Kosten, zuletzt waren es neun Mio. Euro. Schluck- und Saugbrunnen, Bauteilaktivierung, Holz, Lehm und das zweite Kunstprojekt – ein Spielhaus von Gelatin, an dessen Fassadenrelief die Baugruppe mitgearbeitet hatte –, blieben. Und am wichtigsten: der Grünraum, gestaltet von Idealice, und das Gemeinschaftshaus. Dort liegt Spielzeug und findet sich das dritte Kunstprojekt: Clegg & Guttmann installierten an der Rückwand „the open multi-language library“, ein Buchregal, das sich mit Büchern in vielen Sprachen füllen soll. Im Süden öffnet sich das Haus zum Platz und führt eine Außentreppe auf die Terrasse auf dem Dach. Kraupp: „Immer, wenn man vorbeigeht, ist jemand da. Hier wird getratscht, gefeiert, gegessen und gespielt. Es ist wirklich ein lebendiger Ort geworden.“