
WienerBerg Dojo
Wien (A) - 2003
mit Michael Loudon, Walter Hans Michl
Architekturzentrum Wien
Studium der Architektur an der ETH; Baupraxis. 1977-85 Assistent bei Prof. A.M.Vogt und Doktorat in Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Lebte seit 1985 in Wien und arbeitete auf dem Gebiet der Architektur als Entwerfer, Historiker, Kritiker, Kurator und Austellungsmacher.
Seit 1989 gemeinsames Atelier mit Architekt Walter Hans Michl in Wien: Möbeldesign, Bau- und Wettbewerbsprojekte, Wettbewerbsorganisationen, Juryteilnahmen, städtebauliche Konzepte.
Bauten: Stadthaus in Wien-Neubau, Kirchenzentrum St.Benedikt in Wien-Simmering. Konzept und wissenschaftliche Leitung für die Steirische Landesausstellung 1995, „Holzzeit“ und Initiierung der „Murauer Werkstätten“ (mit Franziska Ullmann, Wien).
Buchpublikationen u.a. über Adolf Krischanitz, Gustav Peichl, Boris Podrecca. Regelmäßige Architekturkritik im Spectrum (Die Presse, Wien) sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen.
Eine Fassade, die in warmem Rot leuchtet, Fenster, die auch einem Liegenden den Blick ins Freie gewähren. Keine Spur von Klinik oder Kälte: das Landespensionistenheim in Stockerau.
Östlich des Ortskerns von Stockerau befand sich bis vor kurzem das alte Landespensionistenheim in einem sechsgeschoßigen Bau aus den späten 1960er-Jahren. Bauphysikalisch und vor allem betrieblich war er nicht mehr zeitgemäß, und ansehnlich ist er auch nicht. Man wird ihn demnächst abbrechen und den Grund neu bebauen. Neben dem Altbau entstand in den vergangenen zwei Jahren ein neues Landespensionistenheim, dessen Fassade in einem warmen Rotton freundlich leuchtet. Als Zweites fallen die halbrunden Stirnseiten des Zimmertrakts auf, wo Bewohnerinnen und Bewohner in großen Loggien, gut beschattet und betreut, frische Luft genießen können. Denn es gilt zu bedenken, dass nicht wenige der Hochbetagten sich - wenn überhaupt - nur mehr im Rollstuhl bewegen können.
Betriebsökonomische Studien legten in den vergangenen Jahren optimale Bettenzahlen für die Pflegestationen fest, die sich jeweils auf einer Ebene befinden müssen. Dies bestimmte die Ausdehnung des dreigeschoßigen Zimmertrakts, der im Süden und im Norden über die genannten halbrunden Loggien verfügt, die wie gestapelte Achterdecks eines Ausflugschiffes wirken. Die Zimmer liegen beidseitig an einem Mittelgang und sind nach Osten oder Westen gerichtet. Große Kastenfenster mit niedrigen Brüstungen bieten selbst Liegenden einen Blick nach draußen.
An der Westseite des Zimmertrakts stößt ein gedrungener Quertrakt auf den Langbau. Er enthält die vielen allgemeinen Räume für Aufenthalt, Haarpflege, Café und dergleichen. Die Hauskapelle befindet sich hier, aber auch der Servicebereich mit der Küche, die Eingangshalle und die Verwaltung. An der Gelenkstelle springen die Geschoßdecken zurück, sodass das von Süden eindringende Licht bis tief in die hohen Hallen gelangen kann. Ein weit auskragendes Dach schützt vor der harten Sommersonne.
Bei der architektonischen Gestaltung eines Pensionisten- oder Pflegeheims gilt es immer zu bedenken, dass drei ziemlich verschiedene Nutzergruppen zu berücksichtigen sind: die alten Menschen, das Betreuungspersonal und die Angehörigen, Freunde und Bekannten, die zu Besuch kommen. Bewohnerinnen und Bewohner, die sich noch selbst bewegen, sollen sich unschwer orientieren können und räumlich abwechslungsreiche Allgemeinbereiche vorfinden. Sollten sie jedoch bereits immobil sein, ist ihnen ein freundliches Zimmer zu wünschen.
Das Betreuungspersonal wird sich in vielen Fällen für eine längere Dauer im Gebäude aufhalten als die meisten Bewohner. Praktische Arbeitsverhältnisse und angenehme Aufenthaltsbereiche und -räume sind das eine. Ein positiver Gesamtcharakter des Gebäudes, der eine Identifikation mit dem Arbeitsort fördert, ist jedoch mit Sicherheit ebenso wichtig, weil dies die Qualität der Arbeitsleistung positiv beeinflusst. Gewiss gibt es andere und gewichtigere Faktoren, aber die sind in der Regel meist leichter veränderbar als die Architektur des Hauses.
Wer seine Angehörigen, Freunde oder Bekannten besuchen kommt, möchte wohnliche Bereiche vorfinden, wo er dem besuchten Menschen nahe sein und ein, zwei angenehme Stunden verbringen kann, im Gespräch oder in stillem Beisammensein. Dazu kann ein eher privater oder eher öffentlicher Rahmen sinnvoll sein. Jedenfalls ist es gut, wenn man aus einem Angebot wählen kann. So kommen viele verschiedene und anspruchsvolle Forderungen an die Architektur eines Pensionistenheims zusammen, die nicht immer glücklich erfüllt werden. Nicht selten greift ein kalter Klinikcharakter Platz, den man sich auch im Spitalsbereich eigentlich nicht wünscht.
Ganz anders im vorliegenden Fall von Stockerau. Architekt Johannes Zieser ist es gelungen, eine positive Atmosphäre zu schaffen, in der man sich in jeder der drei Benützerrollen wohl fühlen kann. Gewiss wird diese Stimmung weder Altersgebrechen oder Alltagssorgen noch subjektive Ängste wegzaubern, aber positive raumgestalterische Voraussetzungen sind jedenfalls eine gute Ausgangslage.
Der Tagesaufenthaltsbereich zeichnet sich durch doppelte, teils dreifache Raumhöhe aus, mit Galerien und mancherlei Sichtbeziehungen, die einen guten Überblick erlauben. Die große Glaswand trennt klimatisch und bietet dennoch einen intensiven Bezug zum Außenraum. Die Materialien: Parkettböden in warmfarbigem Holz, Natursteinverkleidungen von Mauern in ockerfärbigem Stein - das Muster erinnert an die 1950er-Jahre, an die sich wohl nicht wenige Bewohner erinnern werden. Schlanke runde Stützen tragen die Galerie, über der ein Glasdach noch einmal Licht in den großen Binnenraum einlässt.
Am überraschendsten ist jedoch, dass der Trakt mit den Zimmern aus Holz errichtet wurde, das an den Decken der Gänge und in den Zimmern zu sehen ist und die positive Raumwirkung mitbestimmt. Die Deckenplatten und Wandscheiben bestehen aus Brettsperrholz. Das sind kreuzweise zu großen Tafeln verleimte Brettschichten. Ihre Größe wird nur durch die Transportfähigkeit begrenzt. Diese massiven Holzwerkstoff-Elemente werden konstruktiv und statisch wirksam eingesetzt. Architektonisch erscheinen sie flächig, was bisher die Domäne des Stahlbetons war oder in Holz durch Verkleidung erreicht werden musste. Der Rohbau gleicht dem anderer Massivbauweisen, hat aber neben dem geringeren Gewicht den Vorteil der schnellen und trockenen Montage sowie der werkseitigen Vorfertigung.
Der Aufbau der Außenwände beginnt außen mit hinterlüfteten, rot lackierten Sperrholztafeln, deren Horizontalfugen gegen eindringenden Schlagregen sorgsam mit einem Wetterschenkel versehen sind. Zementgebundene Spanplatten schützen die Dämmung und sichern gegen Brandüberschlag. Hinter der Dämmung steht das tragende Brettsperrholz, innenseitig wurde es mit einer brandhemmenden Schicht versehen und dann mit Gipskarton verkleidet.
Damit ist das Bauwerk auch bautechnisch äußerst interessant und nützt die Möglichkeiten des modernen Holzbaus. Dabei werden auch die anderen Materialien je nach ihren Eigenschaften sinnvoll eingesetzt. Wir finden Stahlbeton, Holz und Holzwerkstoffe, Stahl und Glas, die zusammen die jeweils angemessene Stimmung erzeugen. Denn nicht eines allein vermag sämtliche Ansprüche zu erfüllen. Erst im Zusammenspiel der richtigen Kombination und Konstellation wird daraus Architektur.
Der Fußgängersteg Rapperswil-Hurden
Der Raum über dem Zürichsee ist weit. Ungewohnt weit in dem stark hügeligen, von Gletschern und Flüssen modellierten und von den Menschen dicht überbauten Gebiet zwischen Alpen und Jura, dem schweizerischen »Mittelland«. Nur die Seen bieten sich darin als offene, ebene Räume an. Der seit einigen Jahren bestehende Holzsteg zwischen der Stadt Rapperswil und dem ehemaligen Fischerdorf Hurden verbindet daher nicht nur zwei gegenüberliegende Ufer, sondern führt hinaus in diese besondere Weite zwischen Wasser und Himmel. Gewiss kann sich der Mensch mit einem Boot ebenfalls in diesen Raum hinaus begeben, aber das ist nicht dasselbe wie zu Fuß, etwa einen Meter über der Wasserfläche auf einem 2,40 Meter breiten Weg dahin zu gehen, zu schlendern oder zügig zu wandern, wie es gerade gefällt. Ganze 841 Meter ist er lang, der Steg, und fünf Mal ändert er mit einem Knick mehr oder weniger stark die Richtung, ohne aber das Ziel, eine Landzunge auf der anderen Seeseite, aus dem Blickfeld zu lassen.
Über die Funktion als Weg hinaus ist der Holzsteg raumbildendes, architektonisches Element, denn an einer Seite begleitet eine schulterhohe Geländerwand aus Eichenstaffeln, dem gleichen Material wie die Gehfläche, die schmale, langgezogene Plattform über dem Wasser. Die Geländerwand schneidet den Raum, teilt ihn viel stärker als der Steg allein dies vermöchte, schirmt aber zugleich, bietet räumlichen Halt in der Weite. Da kann die andere Seite getrost offen bleiben und bloß mit fünf dünnen horizontalen Drähten gesichert sein, die minimale Raumbildung ist da und wirkt beruhigend.
Man geht zirka zehn Minuten auf dem Steg. Das ist lang genug, dass die einfache, extrem reduzierte Raumbildung ihre subtile Wirkung entfalten kann und sich als solche im Gedächtnis festschreibt, einen Ort über dem Wasser schafft, dessen Geheimnis sich beim Begehen erschließt. Aber dieser Ort, das ist nicht bloß ein fünf Jahre alter Steg, das ist viel mehr. Das ist ein Seeübergang, der in die Prähistorie zurück- reicht, eine Tiefe von Jahrtausenden, was für uns Menschen an die Ewigkeit grenzt. Eine eiszeitliche Endmoräne des Linthgletschers bildet hier eine ausgedehnte Untiefe, die teils kaum einen halben Meter unter Wasser verläuft. Man darf annehmen, dass hier eine großflächige Furt bestand, die seit der Eiszeit ein vergleichsweise gefahrloses Überqueren des Gewässers erlaubte – problemloser als durch die schnell fließende Limmat unterhalb, oder die sumpfige Linthebene oberhalb des Zürichsees. Weiter dürfte der Weg dann beim heutigen Konstanz über den Rhein geführt haben und als Nord-Südachse frühen Wanderungs- und Handelsbewegungen gedient haben. Es erstaunt daher wenig, dass eine frühbronzezeitliche Inselsiedlung schon vor 3500 Jahren eine Stegverbindung zum Nordufer aufwies. Wobei die seit dem späten Neolithikum bestehende, relativ dichte Besiedelung der günstigen Uferzonen archäologisch belegt ist. Damals wurde der See mit Einbäumen befahren, in keltischer und römischer Zeit dann mit größeren Schiffen, schriftliche Quellen über regelmäßigen Fährbetrieb datieren aus dem 9. Jahrhundert.
Die Stadt Rapperswil gehörte von 1354 bis 1464 zum damaligen Österreich. Erzherzog Rudolf IV. ließ 1358 eine 1850 Schritt lange Brücke auf Pfahljochen errichten, um über einen eigenen, mit Wagen befahrbaren Übergang zu verfügen und damit die zur Eidgenossenschaft gestoßene Stadt Zürich mit ihrer Brücke über die Limmat zu konkurrenzieren. Über 500 Jahre lang wurde der Übergang regelmäßig erneuert, bis 1878 im Zuge des Eisenbahnbaus ein moderner Seedamm für Schiene und Straße eröffnet und die Holzbrücke abgebrochen wurde. Neben dem Handels- und Lokalverkehr diente der uralte Übergang den Pilgern auf ihren Reisen durch Europa, etwa auf das Südufer und von dort zum nahen Kloster Einsiedeln; als Teil des schweizerischen Jakobsweges weist er aber auch nach dem fernen Santiago de Compostela. Wir verstehen daher, dass dieser Weg über den Steg nicht irgendein Weg war und ist.
Als der zunehmende Automobilverkehr auf dem Seedamm den Fußgängern die Wanderfreude verdross, engagierte sich ab 1975 eine lokale Initiative, wieder einen Steg zu errichten. Da sie nach ein paar Jahren ins Stocken geriet, bot das Millennium den Anlass zu erneuter Anstrengung: Für die Baukosten von zirka 2 Mio Euro wurden Spenden gesammelt, verschiedene, zum Bau erforderliche Bewilligungen eingeholt – die Flachwasserzonen und Inseln stehen unter Naturschutz – und die Planung aktualisiert. Die Bauingenieure Bruno Huber und Walter Bieler (Holzbau) sowie der Architekt Reto Zindel entwickelten das Konzept und eine langlebige Konstruktion. Vom Splint befreite Eichenpfähle von 30, 45 und 70 Zentimeter Stärke und bis zu 16 Metern Länge wurden paarweise mit 7,50 Meter Abstand in den Seegrund gerammt. Metallene Kappen schützen die bewitterten Stirnflächen. Darauf ist jeweils ein mittels Schwert am stärkeren Pfahl eingespanntes Stahlprofil befestigt. Auf diesen Querträgern liegt ein Rost aus schmalen Eichenbalken, der als Gehfläche dient, wobei dank alternierenden Versatzes statische Durchlaufwirkung erzielt wird.
Minimierte Kontaktflächen und Dimensionen sowie ausreichende Durchlüftung sorgen für ein rasches Trocknen nach Regen- und Schneefällen. U-förmige Stahlprofilbügel halten die schmalen Balken in der Schar und dienen seitlich als Geländerpfosten. Die längs gerichteten Tragelemente, durch deren Fugen der Blick auf den Wasserspiegel fällt, lassen das Gehen auf dem Steg anders empfinden, als wenn sie quer liegen würden. Da die Fasern in Gehrichtung verlaufen, wird die Oberfläche von den Schuhsohlen mehr poliert als aufgeraut, was zu einer stets glatten und frischen Oberfläche führt. Die seitliche Holzbrüstung ist ähnlich wie die Gehfläche ausgeführt, wobei die Hölzer in Brett- und Lattendimensionen sich da und dort leicht gebogen haben und nun ein lebendiges expressives Bild abgeben. Das Geh- und Raumerlebnis ist einmalig. Selbst bei Schneeregen ist man fast enttäuscht, wenn der Weg auf dem Steg schon zu Ende ist – immerhin: in Gegenrichtung ist es um kein Haar schlechter.
Jede Bauepoche blickt in der Regel verächtlich auf ihre Vorgängerin. Oft legt sie auch Hand an, meist zum Schaden der Gebäude. Jetzt geht es Roland Rainers ORF-Bauten auf dem Küniglberg an die Außenhaut. Zeit, die Spirale zu durchbrechen!
Würde man heute den Strebepfeilern und dem Chormauerwerk einer regional bedeutenden go tischen Kirche eine Außendämmung verpassen? Wohl kaum. Dennoch sei daran erinnert, dass die Bezeichnung „stile gotico“ im Italien der aufkommenden Renaissance abschätzig gemeint war, dass die heute selbstverständlich und positiv besetzte Benennung der Baukunst einer hochmittelalterlichen Epoche zuerst ein Schimpfwort war. Dasselbe gilt für die Begriffe „Barock“ oder auch „Zopf“, die den frühen Neoklassizisten dazu dienten, die Formenvielfalt und Schwelgerei der vorangegangenen eineinhalb Jahrhunderte zu diffamieren.
Wer sich aber heute weder von der geschmäcklerischen noch von der Partei nehmenden Seite den Phasen der Architektur- und Baugeschichte nähert, wird in jedem Abschnitt herausragende, geglückte und weniger geglückte Bauwerke finden, und je tiefer man in das Wissen über das Bauen und die Architektur eindringt, desto mehr wird man die Bauwerke und die gewonnene Erkenntnis genießen können. Ob dies nun Gotik, Barock, Historismus oder die noch billig zu schmähende Nachkriegsmoderne sei. Denn es ist nicht der vordergründige Effekt, der das Wesen von Architektur ausmacht.
Wäre es da nicht an der Zeit, diesen Mechanismus zu durchschauen, der Auftraggeber und Architekten die jeweiligen Vorgänger schlecht machen lässt und für die Qualitäten im Schaffen der Vätergeneration blind ist. Interessanterweise sind es dann die Enkel, die den Arbeiten ihrer „Großväter“ - neuerdings auch von „Großmüttern“ - Sentiment entgegenbringen - und nebenbei die Bauten von „Vätern“ und „Müttern“ scheußlich finden, ihrerseits wieder „das Kind mit dem Bad ausschütten“ und dieses beliebteste Muster der Moderne weiterführen.
Müssen wir diese wertevernichtende, alles andere als nachhaltige Spiralbewegung als „anthropologische Konstante“ hinnehmen? Vielleicht ja, wenn Architekturgeschichte nur als oberflächliche Stillehre unterrichtet wird, um hernach wie Rechnen geprüft zu werden. Jedoch nein, wenn Architekturgeschichte, falls sie denn überhaupt noch gelehrt wird, zum Wesen der Baukunst einer Epoche hinführt, wenn dabei die Eigenheiten und Qualitäten erläutert werden und mit den darauf folgenden Epochen genau so verfahren wird. Jedenfalls könnte dann öfter der verbreiteten Maxime von Luigi Snozzi: „Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung, zerstöre mit Verstand“ nachgelebt werden. Dabei liegt das Gewicht auf dem Wort „Verstand“. Wir sollen also zuerst verstehen lernen, um eingreifen zu können.
Seit einigen Monaten soll es den Bauten für den ORF von Roland Rainer auf dem Küniglberg an die Außenhaut gehen. Man erprobt eine Außendämmung des Stahlbetonskeletts, wie das Bild zeigt. Wie wenn es sich um einen beliebigen massiven Wohnbau aus den 1960er-Jahren handeln würde, wird Styropor außen draufgepappt. Doch versuchen wir zu verstehen, bevor wir loslegen: Roland Rainer hat ein rationales System mit vorgefertigten Betonelementen entwickelt, bei dem die nackte Konstruktion architekturwirksam sein sollte und auch ist. Er zelebriert das Fügen der Teile, die jedoch nicht plump pragmatisch geformt sind, sondern eine technisch begründbare Plastizität aufweisen, die sich im Spiel von Licht und Schatten zeigt. Tragwerk und Konstruktion sind nicht bloß dienend und hinter irgendwelchen Überzügen und Oberflächen verborgen, sondern sind integraler Teil der Architektur. Das gilt nicht immer und überall, aber am Küniglberg schon. Rainers rationale Haltung zeigt sich jenen, die verstehen wollen, auch am später an der Südseite hinzugefügten Stahlbau, wo die Konstruktion ebenso architekturrelevant ist - aber für Beton wäre die begrenzte Zahl zu fertigender Elemente nicht wirtschaftlich gewesen.
Ein Skelettbau ist bauphysikalisch nicht dasselbe wie ein Massivbau. Bevor daher die Bauabteilung des ORF Styroporplatten und Klebemörtel aufbringen lässt, wäre beispielsweise vorgängig ein Konzeptwettbewerb unter Bauphysikern nicht ganz abwegig gewesen, denn die großen Volumen mit einem günstigen Volumen-Oberflächen-Verhältnis, der hohe Anteil an Metallfensterflächen, die Probleme des Dampfdurchgangs und so weiter hätten ganz andere und gewiss auch hinsichtlich Kosten für Ausführung und Betrieb optimale Resultate erbringen können. Denn die Bastelei mit dem Styropor ist jedenfalls arbeitsaufwendig. Zudem werden Karbonatisierung und Schäden an der Armierung - bei Bauten aus dieser Zeit üblich, aber behebbar - überdeckt und einer Kontrolle entzogen.
Ohne professionellen Bauphysikern vorgreifen zu wollen, sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen eines ingenieurwissenschaftlichen Gesamtkonzepts zur wärmetechnischen Sanierung auch eine Innendämmung mit Kalzium-Silikatplatten möglich wäre, die den feinsinnigen architektonischen Ausdruck nicht verplumpt und damit verständnislos zerstören würde. Bei der Sanierung des „Hauserhofes“ in Linz werden Kalzium-Silikatplatten als Innendämmung verwendet, eine innen liegende Dampfsperre kann entfallen, da etwa entstehendes Kondenswasser kontrolliert wieder an den Raum abgegeben würde.
Aber lassen wir die technischen Details den Spezialisten und konzentrieren wir uns auf die Architektur, die bei Roland Rainer eine wichtige technische Komponente enthält, die im Tragwerk, in dessen Plastizität und in der Rationalität der Gedankenführung ausgedrückt ist. Soll das nun unter Styropor und Stuck verschwinden? Denn im Umgang mit bestehender Architektur gilt eine weitere Maxime, die sich aus jener von Luigi Snozzi ableiten lässt: Wer Hand an ein historisches Bauwerk legt, sollte seinem vorangegangenen Architekten zumindest das Wasser reichen können.
Ein Ort mit wissenschaftlicher Tradition, revitalisiert als Galerie der Forschung: die ehemalige Alte Universität Wien. Ihre rationale Eleganz verdankt sie dem Architekten Rudolf Prohazka.
Einen Begegnungsort zu schaffen für wissenschaftlich Forschende und zugleich einen Ort der Ver mittlung neuester Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit hatte die Österreichische Akademie der Wissenschaften im Sinn, als sie 1998 einen Architektenwettbewerb mit internationaler Beteiligung durchführte. Vor Jahren galt das für die „Galerie der Forschung“ vorgesehene Haus in der Bäckerstraße 20 als Geheimtipp unter Wiener Besonderheiten. Zu Bürozeiten war es möglich, durch den meist offenen Eingang und das Stiegenhaus zum zweiten Stock vorzudringen, um durch eine unversperrte Türe in einen riesigen Saal zu gelangen. Der war allerdings gänzlich mit einem Metallgerüst angefüllt, das die Plattform zur Restaurierung des Deckenfreskos trug. Da war zuerst die Überraschung, nach dem wenig ansprechenden Stiegenhaus auf den mächtigen Saal zu stoßen, dann die paradoxe Situation, diesen mit einem dreidimensionalen Gitter angefüllt vorzufinden.
Die übrigen Geschoße waren zwar nicht ähnlich dicht, aber ebenfalls reichlich verbaut. Und im Untergrund stießen Archäologen auf mittelalterliche Strukturen. Städtebaulich fiel das große Haus nicht besonders auf, weil es nicht über eine Schaufassade verfügte, obwohl es dreiseitig, aber nur auf kurze Distanz, freisteht. Ein Ansatz zu einer Schaufassade bestand zur Wollzeile hin, wo die Riemergasse auf einen kleinen Straßenhof trifft. Die Chance, vor dieser Südfassade einen Platz frei zu bekommen, war allerdings im engen Wien der Barockzeit und bis heute gering. Weiters liegt die Bäckerstraße höher als die Wollzeile, sodass man zwar von Ersterer eben hineingeht, sich zu Letzterer jedoch in Halbhochlage befindet.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut, war das Haus, das im Erdgeschoß die Aula der Universität, im ersten Obergeschoß Hörsäle und darüber den Theatersaal enthielt, durch zwei begehbare Schwibbogen über die Bäckerstraße mit dem Jesuitenkolleg verbunden. 1733 bis 1736 wurde der Theatersaal restauriert, und Anton Hertzog, ein Schüler des Andrea Pozzo, malte das heute von zahlreichen kleinen Schäden beeinträchtigte Deckenfresko. Nachdem die Kaiserin 1761 den Jesuiten das Theaterspiel untersagte, diente der Saal verschiedenen Zwecken, nicht zuletzt als naturwissenschaftliches Museum.
Die Baustruktur des Hauses ist rational, wobei man - die damalige Bautechnik berücksichtigend - nahezu von einem Skelettbau sprechen kann. Dieser Sachverhalt wurde von Architekt Rudolf Prohazka erkannt und in seinem Umbaukonzept präzisiert. In einem ersten Schritt stärkte er das rationale Konzept, indem er wilde, über die Jahrhunderte entstandene Einbauten entfernte und die reine Struktur hervorhob. Im Erdgeschoß wird sie nordseitig, entlang der Bäckerstraße durch einen langen Gang, an der westlichen Stirnseite vom Stiegenhaus und im Hauptkörper von drei Achsen mit jeweils zwei kräftigen Pfeilern bestimmt. Zwischen Letzteren sind vier Achsen mit zwei vergleichsweise schlanken Säulen eingefügt. Zusammen mit den in Pfeiler aufgelösten Außenmauern tragen sie ein Kreuzgratgewölbe. Die Säulenbasen mussten teils unterfangen werden, da der Boden zuvor verschiedene Niveaus aufwies - für ein öffentliches Gebäude heute ein Unding. Und in den Öffnungen der Südseite wurden die Brüstungen entfernt. Damit kommt die Großzügigkeit der Alten Aula bestens zur Geltung. Die Säulen scheinen eher zu hängen als zu tragen, vor allem fließt der Raum um sie herum, während die Pfeiler diesen zwar zonieren, aber nicht abschließen.
Im Geschoß darüber entfallen die Säulen. Die Korbbogentonnen überspannen locker zehn Meter, Stichkappen verbinden quer dazu. Hier und in der Aula sind die Räume für Ausstellungszwecke vorbereitet. Dem rationalen Tragsystem ist ein Versorgungsnetz überlagert, das Energieträger sowie Anschlüsse für Informationstechnologie über Bodensteckdosen und Lichtschienen so weit verteilt, dass für künftige, wechselnde Ausstellungsverhältnisse vorgesorgt ist.
Im obersten Geschoß befindet sich der gut 800 Quadratmeter messende Theatersaal der Jesuiten. Die 20 Meter Breite überspannt ein hoher Dachstuhl aus Holz, an dem die flache Decke mit dem Fresko hängt. Daher befindet sich der Saal zuoberst, was jedoch heute eine dritte Fluchttreppe bedingte, die in einem Grundstückzwickel an der Südseite Platz fand.
Das siegreiche Wettbewerbsprojekt Prohazkas sah den Vortragssaal unter der breiten Freitreppe im Straßenhof vor. Das knappe Budget ließ das aber nicht zu. Rudolf Prohazka, löste die schwierige Aufgabe laut der bewilligenden Denkmalamtsvertreterin mit einer „Königsidee“. Nun lässt sich im Theatersaal eine 70 Zentimeter starke, über die gesamte Breite und bis knapp unter das Fresko reichende Wand auf zwei seitlichen Zahnstangen mechanisch verschieben. Damit lassen sich unterschiedlich große Vortrags- und Veranstaltungsräume unterteilen. Die Wand ist raumakustisch wirksam und enthält hinter einem Chromstahlgewebe Scheinwerfer und weitere Ausrüstung. Selbst die Übersetzerkabinen lassen sich darin integrieren. Damit wurde in der 350 Jahre alten Baustruktur sehr viel modernste Technik untergebracht. Diese und auch das komplett neu errichtete Stiegenhaus samt Aufzug an der Stirnseite zum Platz vor der Jesuitenkirche sind in einer zurückhaltenden zeitgenössischen Formensprache ausgeführt, die mit dem rationalen Bestand harmoniert, weil beide strukturell verwandt sind.
Zur visuellen Kommunikation mit dem urbanen Umfeld sind drei bis zum zweiten Stock reichende, schmale Plasmadisplays bündig in die Fassade eingelassen. Sie wirken in die Bäckerstraße, zur Postgasse sowie in die Riemergasse hinein und lassen sich mit beliebigen Inhalten bespielen. Ein frei vor der Südfassade aufziehbarer Screen dient als Projektionsfläche. Damit erhält das ruhig und unaufdringlich wirkende Haus ein markantes Signal zur Stadt, ohne dass die historische Substanz angetastet wird.
Der Dialog notwendiger Erneuerungsmaßnahmen und zeitgenössischer Gestaltung mit der vorhandenen Struktur erfolgt auf großer Bandbreite. Weil er zugleich äußerst diszipliniert betrieben wurde, erweist sich der Umbau architektonisch gelungen, auch wenn die Ausstellungseinrichtungen noch nicht feststehen.
Ein Pionierwerk der 1970er-Jahre, das seinesgleichen sucht: die Wohnanlage „Wohnen morgen“ in Hollabrunn. In die Jahre gekommen - und doch ein Lehrstück über Architektur.
Nieselregen ist kaum die ideale Witterung, einen 30 Jahre alten Wohnbau zu besichtigen. Aber wenn er solche Begleitumstände aushält, muss etwas dran sein. Der Gegenstand der Anschauung in Hollabrunn, die Wohnanlage „Wohnen morgen“ mit 70 Einheiten, ist ein singuläres Wohnbauprojekt seiner Zeit in Niederösterreich. Die Anlage wurde 1971 bis 1976 nach dem Gewinn eines programmatischen Wettbewerbs von Ottokar Uhl und Jos Weber mit Beteiligung der späteren Bewohner geplant und errichtet. Eine begleitende Forschungsarbeit untersuchte einerseits den Einsatz vorgefertigter Elemente und andererseits den Partizipationsprozess, einen der ersten seiner Art in Österreich. Nicht dass für jeden Wohnbau dieser Aufwand getrieben werden könnte und müsste; aber als ein Angelpunkt in der Geschichte des Wohnbaus in Österreich sollten die dabei gemachten Erfahrungen zum Programm hiesiger Architekturschulen gehören.
Die Architekten arbeiteten dabei nicht isoliert, sondern stützten sich auf Konzepte aus den Niederlanden, wo Hermann Hertzberger, Aldo van Eyck und andere mit „strukturaler Architektur“ international auf sich aufmerksam machten. Als Basis diente das System S.A.R. der „Stichting Architecten Research“, zu Deutsch „Stiftung Architekten Forschung“, einer Initiative des Bundes Niederländischer Architekten sowie von neun Architekturbüros, die eine breite Anwendung industrieller Fertigungsverfahren zugleich mit einer individuellen Ausprägung anstrebten (siehe auch den Beitrag Bernhard Stegers in dem Sammelband über Ottokar Uhl, Anton Pustet Verlag).
Wie damals üblich, begann man bei der Planung mit einem Raster und einem Modulmaß. Ein Basismodul von zehn Zentimetern ergab verdreifacht 30 Zentimeter. Aufgeteilt in zehn und 20 Zentimeter führte dies zu einem „Bandraster“, der die Möglichkeiten für die tragenden und trennenden Bauelemente festlegte - allerdings immer mit ausreichend Varianz. Denn ein starrer Raster kann leicht in den Irrsinn kippen. Ausgehend von diesem feinmaschigen Planungsnetz wurden in der Gebäudetiefe parallele „Zonen“ festgelegt, die sich von den Raumgrößen herleiteten. Auch hier wurde differenziert in Kernzonen und „Margen“, die der einen oder der anderen Kernzone, zwecks planerische Elastizität, zugeordnet werden konnten.
In der anderen Richtung legten konstruktive Elemente von der Art unterbrochener Mauerscheiben „Sektoren“ und Raumbegrenzungen fest. Als weiteres Ziel galt es, Rohbaustruktur und Ausbau klar zu trennen, um bei der Planung, aber auch später, bei einer Erneuerung, Veränderungen zu erleichtern, ohne die Tragstruktur antasten zu müssen. Mittlerweile steht die Historisierung dieser speziellen Strömung der Nachkriegsmoderne an, die industrialisiertes Bauen, Ökonomie und unterschiedliche Benutzerwünsche unter einen Hut bringen wollte. Weil ihnen dies noch zu wenig war, strebten die Architekten nach einer Demokratisierung des Planungsprozesses unter dem Stichwort „Partizipation“. Die vom Architektengenius gestaltete Form trat hingegen hinter diese Ansprüche zurück. Das sind, kurz zusammengefasst, die Prämissen, unter denen wir uns historisch-kritisch der Wohnanlage in Hollabrunn nähern wollen.
Was zuerst auffällt, ist die kräftige Tragstruktur aus Betonelementen - sie enthalten einen Zuschlag aus Blähton, um den Wärmedurchgang zu reduzieren. An den Stirnseiten der langen Trakte ist dieses Skelett mit Zementsteinwänden ausgefacht, während an den Längsseiten vorgefertigte Wand- und Fensterelemente in Leichtbauweise abwechseln. Die Primärstruktur des tragenden Skeletts gewinnt dabei eine städtebauliche Dimension. So wie sich im Mittelalter Wohn- und Gewerbenutzungen parasitär in den Großstrukturen römischer Amphitheater einnisteten, reihen sich hier die entsprechend den Nutzerwünschen innerhalb eines Sektors vorspringenden Terrassen oder Räume zufällig nebeneinander. Die Spannung zwischen Tragstruktur und Füllung wird zum architektonischen Ausdruck.
Nach 30 Jahren ist die Bepflanzung herangewachsen. Da und dort überwuchert wilder Wein die massiven Pfeiler und Träger - im Winter bloß als Rankennetz, der sommerliche Blättermantel lässt sich leicht dazudenken. Damit haben die Bewohner die Struktur nicht bloß mit ihren Außenwänden, sondern auch mit ihrer Bepflanzung interpretiert. Unterschiedliche Farben, teils auch Materialien, kommen dazu. Und wieder folgt das Prinzip nicht einem von einer einzigen Hand festgelegten Gesamtbild.
Im Erdgeschoß durchzieht je eine zentrale Ganghalle die drei langen Gebäudetrakte. Sie ist nur für die Bewohner zugänglich, und dient diesen als öffentliche Zone im Sinne des Binnenstädtebaus. Sie ist breit genug, dass hier Fahrräder und Kinderwagen stehen können. Der Kork an der Decke - als Wärmedämmung und mit schalldämpfender Wirkung - sieht noch überraschend gut aus.
Während die Leichtbetonelemente der Tragstruktur eher archaische Dimensionen aufweisen - was architektonisch durchaus positiv zu beurteilen ist -, sind die ebenfalls aus Elementen gefügten Treppen im Inneren erstaunlich schlank. Die Platten der Absätze sind für heutige Verhältnisse ungewohnt dünn, ebenso die plissierten Läufe. Und nochmals entsteht eine architektonisch-proportionale Spannung, diesmal zwischen den Elementen der Primärstruktur und jenen der Treppen. Freilich kommt da und dort die - damals übliche - geringe Überdeckung der Verteilarmierung zum Vorschein. An einigen Stellen rostet sie und führt zu Abplatzungen. Nicht dass solche kleinen Schäden auf die leichte Schulter zu nehmen wären, aber nach 30 Jahren stehen andere Fassaden ebenfalls zur Reparatur an, manche sogar früher.
Es sind jedoch nicht bautechnische Probleme, die zuvorderst nach Erneuerung rufen, sondern ein absehbarer Generationenwechsel in den Wohnungen und eine voraussichtliche wärmetechnische Gebäudesanierung, die demnächst zu Veränderungen führen könnten. Deshalb muss klar festgehalten werden, dass wir vor einem Pionierwerk stehen, wofür sich in Niederösterreich und selbst darüber hinaus wenig Vergleichbares finden wird. Und auch wenn die exakt arbeitenden Kunsthistoriker mit ihrer Beurteilung noch nicht in den 1970er-Jahren angelangt sind, werden weder eine genossenschaftliche Bauabteilung noch ein beliebiger planender Baumeister den vom Bauwerk gestellten Ansprüchen genügen und die nötige Denkarbeit für Pflege und Erneuerung leisten können. Denn die Erneuerung eines Pionierwerks ist ebenso sehr Pionierarbeit, wofür nur architektonisch wie bautechnisch höchst qualifizierte Fachleute infrage kommen. Alles andere wäre, gemessen an der aktuellen Initiative zur architektonischen Verbesserung des Wohnbaus in Niederösterreich, reine Schildbürgerei.
Respektvolle Distanz statt harter Kontraste: Wie sich Helmut Dietrich und Much Untertrifaller mit Augenmaß einem Monumentalbau annähern. Die neue Halle F im Wiener Stadthallen-Komplex.
Die Wiener Stadthalle gilt zu Recht als herausragendes Monumental bauwerk, das in der Wiederauf bauzeit der 1950er-Jahre als einsame Ausnahme neu errichtet wurde. Roland Rainer hatte mit seinem Entwurf nicht bloß ein sehr großes Gebäude im Sinne eines linear vergrößerten Hauses vorgeschlagen; vielmehr gelang ihm eine Großform, die dem riesigen Volumen maßstäblich gerecht wird und als städtebauliche Figur zu den Nachbarbauten etwa zwei Häusergrößen Abstand hält. Zugleich wahrte der zeichenhafte, an beiden Seiten expressiv hochgezogene und aufgestelzte Baukörper vorsichtige Distanz, indem er hinter Märzpark und niedrigem Foyerbau eher zurückhaltend in Erscheinung tritt. Eine zusätzliche Betonung des monumentalen Charakters vermied der Architekt. Und er wird nach den Jahren martialischer Massenaufmärsche und totalitärer Großveranstaltungen wohl gewusst haben, warum. Dennoch blieb die städtebauliche Beziehung zum Verkehrsknoten Urban-Loritz-Platz seltsam ungeklärt. Denn nicht wenige Besucher streben jeweils durch die vom Märzpark gebildete Entspannungszone - einen wichtigen Vorbereich solcher Anlagen der Massenkultur - zum Stadthallenkomplex. Aber gerade in dieser Richtung war die städtebauliche Wirkung schwach.
Mit der neuen Halle F, von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller, nach gewonnenem Wettbewerb an eben dieser Schlüsselstelle errichtet, wird die Eckposition angemessen markiert, werden angrenzende Straßen- und Platzräume definiert und wird der Dialog mit dem beachtlichen Bestand gesucht und klug geführt. Die östliche, zum Gürtel gerichtete Stirnseite kragt etwa zwölf Meter aus. Das ist einerseits städtebaulich als Empfangsgeste zu deuten, andererseits liegt die vordere Kante in der Flucht der Querachse vor der Stadthalle, die von der Moerlinggasse und - auf der anderen Seite - von der Zinckgasse gebildet wird. Damit erhält der in der Hütteldorfer Straße vor dem Möbelhaus ausgeweitete Straßenraum einen klaren, straßenparallelen Abschluss und mit der Pausenterrasse vor dem Südfoyer ein urbanes Element.
Die verglaste Eingangswand unter der Auskragung, wo sich die Türen zum Eingangsfoyer reihen, folgt hingegen der Flucht der niedrigen Eingangsfront zur großen Halle. Damit werden zwei parallele städtebauliche Kanten mit dem neuen Gebäude sorgfältig und präzis in Beziehung gebracht. Die auch als Medienwand gestaltbare Stirnseite ist geschlossen, die schräg zurückweichenden Flanken hingegen sind vollflächig verglast. Dahinter befinden sich die Pausenfoyers. Während nun die südexponierte Seite parallel zur Hütteldorfer Straße verläuft und sich damit dem Stadtgefüge unterordnet, sodass das Bauwerk hier eher Stadtreparatur betreibt, ist die symmetrisch angeordnete Nordseite in dieser Hinsicht frei. Die Nähe zu den schrägen Tribünenstützen und den weiteren Schrägen an der großen Halle führt hier zu einem interessanten Dialog windschief im Raum verlaufender Kanten und Linien.
Dabei überlässt der Neubau der älteren Halle hinsichtlich Höhe und Instrumentierung den Vorrang. Die Lautstärke der Architektursprache ist zurückgenommen, und die glatten Aluminiumtafeln der Fassade halten ausreichend Distanz zum profilierten Blech an der großen Halle. Am Tag spiegelt sich deren sonnenbeschienene Südfassade in der Glaswand, die im Schatten liegt. Nachts öffnet sich das beleuchtete Pausenfoyer und dialogisiert mit dem Raum unter den hochgezogenen Rängen des Rainer-Baus.
Helmut Dietrich und Much Untertrifaller zeigen, wie in dieser spannungsreichen Situation nicht etwa harte Kontraste, sondern kalkulierte Annäherung bei den Volumen und respektvolle Distanz in den Details zum optimalen Resultat führen. Der Sachverhalt ist auf dem Foto von Bruno Klomfar gut erkennbar.
Das Innere ist übersichtlich strukturiert, mit kurzen Wegen und direkten Zugängen. Im keilförmigen Raum unter den Zuschauerrampen wird man in die Foyerhalle hineingezogen. Zwei breite Treppen führen an beiden Seiten hinauf zu den Pausenfoyers, deren ansteigender Boden mit den Sitzreihen im Saal korrespondiert, sodass keine Stufen anfallen. Boden und Wände sind mit Robinienholz belegt, einem robusten Material von dunkel-warmer Anmutung. Über die hohen Glaswände wirken die Pausenfoyers offen und sind abends von außen einsehbar wie riesige Schaufenster. Das Geschehen im Inneren wird den Vorbeigehenden gezeigt und belebt damit den öffentlichen Raum.
Der Saal selbst ist ganz in hellem Rot gehalten, eine starke Farbe, die bereits ohne Publikum Erwartungsspannung erzeugt. Es gibt hier keinen Balkon. Damit ist eine Trennung der Zuschauermasse vermieden. Gerade dass die Sitzreihen einmal durch einen breiten Querweg unterbrochen werden, der, „Catwalk“ genannt, zugleich einen ausgelagerten Teil der breiten Bühne bildet. Zuhinterst befindet sich leicht erhöht ein VIP-Bereich, von dem kurze Treppchen in die hinter der Saalrückwand befindlichen VIP-Lounges führen, mit einer Bar und bequemen Sitzzonen. Der Zuschauerraum ist somit ähnlich wie ein Segment aus einem Fußballstadion organisiert.
Zu beiden Seiten und hinter der Bühne schließt der Backstage-Bereich an, dessen Ebenen durch Treppen, wie im Bild versehen mit hellgrüner Wandfarbe, verbunden sind. Das angenehme, zum Saalrot komplementäre Grün verdanken Auftretende und Bühnenarbeiter der Einsicht, dass der Sichtbeton dann doch zu unansehnlich war. In diesem Fall wohl ein Glück, da dies in solchen Räumen eher mit radikalem Sparen als etwa mit jenem glatt geschalten Beton von Tadao Ando in Verbindung gebracht wird. In den Ecken des hinten breiteren Gebäudes befinden sich ein kleinerer und ein größerer Saal, für Proben, aber auch für Bankette, beispielsweise bei Kongressen. Sie sind daher auch von den Pausenfoyers her zugänglich. Darüber liegt noch ein Geschoß mit Büros.
Die Anlieferung erfolgt klarerweise von der Rückseite, und von den Laderampen sind es nur wenige Meter bis zur Bühne. Diese bietet alles, was in einer heutigen Veranstaltungshalle gefordert ist; für Konzerte, Revuen, Tanz bis zu Zirkus, aber ebenso Modeschauen und Tagungen. Darauf abgestimmt ist die Akustik, die mit Beschallungsanlagen auf kurze Nachhallzeiten ausgelegt ist. Sie sorgt für eine gute Sprachverständlichkeit und lässt den Toningenieuren freie Hand.
Der rational und dicht gepackte Komplex steckt in einem geometrisch exakt geformten Volumen, das auch in der Dachaufsicht nicht an Klarheit einbüßt. Damit ist das Bauwerk durchaus zeitgenössisch, aber nicht in einer aufdringlichen Art. Und trotz der attraktiven städtebaulichen Lage gesteht es der ein halbes Jahrhundert älteren Halle von Roland Rainer die Hauptrolle zu. Ein sehr guter Zweiter kann sich das leisten.
Was ist ein Architekt? Was soll er sein? Heilsbringer, Zyniker, Machtmensch mit Soutane? Es wird Zeit, das Gespür für Realität und Verantwortung zu schärfen.
Herr Architekt, sind Sie Gott?", eröffnete kürzlich ein Journalist sein Gespräch mit dem international erfolgreichen Baukünstler. Als am Rande prinzipiell Betroffener fragt man sich natürlich, was für ein Bild vom Wesen eines Architekten im Kopf des Journalisten existieren muss. Denn er fragte nicht: „Halten Sie sich für Gott?“, auch nicht: „Sind Sie ein Gott?“, sondern absolut: „Sind Sie Gott?“. Gewiss, die Frage war hintersinnig zugespitzt, um mit einem starken Einstieg zu beginnen. Doch schoss er damit über das Ziel hinaus, und der Architekt - bekannt dafür, dass er auch auf dumme Fragen intelligente Antworten zu geben weiß - parierte: „Was soll diese Frage?“ und hätte das Gespräch abgebrochen, wenn seitens des Journalisten nicht zivile Vernunft eingekehrt wäre.
Doch lösen wir uns von diesem Disput und kommen zurück zum Bild des Architekten, das zwar ein gutes Stück weit Projektion sein mag, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern ebenso Selbstbild ist, genauer, das Produkt bewusster oder unbewusster Selbststilisierung sein dürfte. Dass diese Problematik nicht besonders neu ist, führt uns Ibsen anhand seines „Baumeister Solness“ vor. Und zahlreiche Architektenlebensläufe belegen es, seit sie - mit Beginn der Renaissance - historisch fassbar werden.
Es sind nicht nur die komplexe Aufgabe, die fachliche Kompetenz, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen, in ihren Disziplinen ebenso kompetenten Spezialisten und Handwerkern sowie nicht zuletzt das Gewicht der gesammelten Erfahrung, die an den Architektenberuf den hohen Anspruch stellen und die das gesellschaftliche Ansehen bescheren, das beim leisesten Nichtgenügen in pauschale Verurteilung umschlägt. Eine entscheidende Komponente bildet die Bereitschaft, große Aufgaben anzugehen, bis in die Details vorauszudenken und in der Folge auch zu bewältigen, denn ein Scheitern unterwegs wird sich keine Bauherrschaft leisten wollen.
Als Schlüsselfigur im Projektierungs- und Ausführungsprozess für ein anspruchsvolles Bauwerk gelangt der Architekt - und auch die Architektin - in eine faktische Machtposition, die zu verneinen entweder naiv oder unehrlich wäre. Die überzogene, eingangs kolportierte Gretchenfrage des Journalisten hätte daher nicht nach der unbeantwortbaren Selbstpositionierung im religiösen Überbau zielen sollen, sondern offener und direkter lauten: „Wie halten Sie es mit der Macht, Herr Architekt, und wie verhalten Sie sich zu anderen Mächtigen?“ Damit würde die Frage nach der Wahrnehmung der in einer Demokratie selbstverständlichen gesellschaftlichen Verantwortung der Macht gestellt, denn hier scheint einiges an Konfliktpotenzial zu liegen.
Noch Le Corbusier, dem man alles Mögliche nachsagt, sehnte sich nach einem Herrscher vom Schlage des königlichen Ministers Jean-Baptiste Colbert (1619 bis 1683), weil er sich für seine radikalen, durchaus totalitär anmutenden Großprojekte von neofeudalen Verhältnissen größere Realisierungschancen erhoffte. Es erstaunt daher wenig, dass er sich nicht zu schade war, zu diesem Zweck monatelang bei der Regierung in Vichy zu antichambrieren.
Es mag eine Binsenwahrheit sein, aber Macht macht transparent. Nicht nur zeigt sich der Charakter eines Menschen selten deutlicher als im Umgang mit Untergebenen und Abhängigen sowie umgekehrt im Verhalten gegenüber vermeintlich und wirklich Mächtigen. Vielmehr wird sich der Ruf der gesamten Berufsgruppe daran messen, wie frei und unabhängig, aber zugleich wie verantwortungsbewusst in Hinblick auf Aufgabe und Gesellschaft seine Mitglieder zu handeln und auch auf unlautere Optionen zu verzichten wissen. Denn nicht nur in der Politik, auch in der Architektur heiligt der Zweck die Mittel nicht.
Die gesellschaftliche Verantwortung der Architekten betonte bereits Vitruv, und seither wurde sie immer wieder beschworen. Aus dem Dienst an der und für die Gesellschaft, erbracht von Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen, wird jedoch mit zunehmender äußerer und innerer Idealisierung eine abgehobene Angelegenheit. In der Folge legten sich nicht wenige Architekten den äußeren Habitus eines über der Gesellschaft schwebenden Heilsbringers zu. Oft genug glauben sie bald selber daran und verlieren jede Bodenhaftung, was dann in mehr als widersprüchlichem Verhalten zum Ausdruck kommt, sodass man sich jeweils fragt: „Ja merken die das denn nicht?“
Manchen der medial und auch anderswie umschmeichelten Großarchitekten möchte man deshalb eine/n Studierende/n der Architektur aus dem ersten Semester einen halben Schritt dahinterstellen, die ihm - wie einst den Cäsaren - immer wieder zuflüstern müssten: „Bedenke, dass du sterblich bist.“
Das angemaßte Image des Heilsbringers hat sich seine eigenen äußerlichen Zeichen geschaffen, das sich in priesterlichem Gehabe und schwarzer Kleidung ausdrückt und mittlerweile selbst von planenden Baumeistern nachgeahmt wird. Wäre es da nicht an der Zeit, sich nicht etwa eine neuartige Soutane einfallen zu lassen, sondern sich schlicht normal zu kleiden? Um das Gespür für gesellschaftliche Realitäten wiederzugewinnen, gälte es, ohne berufliche Hintergedanken, ausreichend Beziehungen hinein in einen Alltag zu entwickeln, der nicht bloß mit Architektur zu tun hat, und sich auf ein Aktivitätsfeld zu trauen, auf dem keine Machtpositionen einzunehmen, zu gewinnen oder zu verteidigen sind.
Was die Architektur betrifft, sollte der ehrliche Wettbewerb im Vordergrund stehen. Er dient nicht bloß dazu, eine optimale Lösung für eine bestimmte Bauaufgabe in einem konkreten städtebaulichen Kontext zu finden. Jungen Berufsleuten bietet er die Chance, sich mit Aufgaben projektierend zu befassen, für die sie nicht so schnell einen Auftrag erhalten werden. Die Teilnahme an Wettbewerben dient daher wesentlich der Selbst- und Weiterbildung. Dass das auf die Dauer für ein kleines Büro nicht finanzierbar ist und in größeren diese Nebenbedeutung meist verpufft, ist eine Krux, wofür zurzeit weder Vergaberichtlinien noch eine Wettbewerbsordnung einen Ausweg anbieten.
Ältere Berufsleute könnten die Teilnahme an Wettbewerben als Möglichkeit zur Selbstkontrolle sehen, wenn sie denn bereit sind, nach einem für sie negativen Juryentscheid genügend Distanz zu finden, und den eigenen Fehlern gegenüber nicht blind bleiben. Eine sorgfältige und gerechte Beurteilung durch die jurierenden Kollegen allerdings vorausgesetzt.
In der alltäglichen Berufspraxis gilt es hingegen, sich die Fähigkeit und das Engagement für das Große wie für das Kleine zu bewahren, die Frage der Angemessenheit immer wieder aufs Neue zu stellen und sich bewusst zu bleiben, dass ein Zyniker nicht zugleich ein guter Architekt sein kann.
Keine theatralischen Kontraste von Alt und Neu, stattdessen das rechte Maß aus Nähe und subtiler Distanz: das erneuerte Palais Epstein, eine Arbeit der Wiener Architekten Georg Töpfer und Alexander van der Donk.
Das Grundstück galt als das teuerste an der Ringstraße, denn seine Position mit Blick auf die Hofburg und zwischen den Flächen, die für die Hofmuseen sowie für das Parlamentsgebäude vorgesehen waren, war prominent. Die ursprüngliche Absicht, an dieser Stelle das Adelscasino zu errichten, wurde aufgegeben, weil der Preis zu hoch war. In der Folge erwarb der geadelte Prager Industrielle und Bankier Gustav Epstein (1827 bis 1879) die prestigeträchtige Parzelle, um darauf ein Palais für sich und seine Familie zu errichten, in dessen Erdgeschoß seine Privatbank ihren Sitz haben sollte.
Mit dem Entwurf beauftragte er Theophil Hansen (1813 bis 1891), jenen Architekten, der bereits mit dem Heinrichhof (gegenüber der Oper, im Krieg zerstört), dem Palais Todesco (mit Ludwig Förster) sowie dem Palais für Erzherzog Wilhelm am Parkring hervorgetreten war, und dessen Musikverein-Gebäude sich 1868 gerade in Bau befand. Theophil Hansen, der an der Ringstraße noch das Parlament, die Börse und - hinter dem Schillerplatz - die Akademie der bildenden Künste errichten sollte, war einer der bekanntesten Architekten seiner Zeit. Er beherrschte mit seinem Atelier die Spielarten des Historismus ebenso wie die aktuelle Bautechnik, war aber auch in vornehmer Innenraumgestaltung versiert. Die Bauausführung oblag dem jungen Otto Wagner. Das Haus war 1871 fertig gestellt, die Inneneinrichtung zog sich zum Teil etwas länger hin.
Trotz dieser kumulierten Superlative konnte sich Epstein seines prächtigen Hauses nicht lange erfreuen. Der Börsenkrach von 1873 ruinierte seine Privatbank, er verlor das Vermögen und musste ausziehen. 1883 kaufte die englische Gasgesellschaft das Gebäude. 1902 gelangte es an den Staat, wurde Sitz des Verwaltungsgerichtshofs, später des Landesschulrats, in der Folge des Reichsbauamts Wien, danach der sowjetischen Kommandantur und von 1955 bis 2001 wieder des Stadtschulrats. In der Geschichte des Hauses spiegelt sich einiges an österreichischer Geschichte, was bei dieser begehrten Lage nicht verwundert.
Hansen hatte den Grundriss für das Palais gemäß damaliger Praxis äußerst rational organisiert. Die repräsentativen Räume liegen an der langen Front zum Ring, weitere Haupträume an den kürzeren Seiten zu Bellariastraße und Schmerlingplatz. In seiner Mitte befindet sich ein von Beginn an mit Glas überdeckter Hof, dessen Fassaden reichhaltig ausgestaltet sind. Zu beiden Seiten schließen Treppenhäuser an, wobei die prächtige Feststiege zur Linken bis in den zweiten Stock hinaufführt, während die halbkreisförmige Nebenstiege ins oberste Geschoß reicht. Um diesen Kern herum zieht sich ringförmig ein Erschließungsgang, von dem aus alle Zimmer bis auf jene an den beiden Ecken zugänglich sind.
Die Fassaden gliederte Hansen recht zurückhaltend und verzichtete auf Risalite, wie sie bei der Wende zum Neobarock beliebt wurden. Die Ecken sind bloß mit einer breiteren Fensterachse und verdoppelten Pilastern leicht hervorgehoben. Die Mittelachse wird nicht betont, nur über dem Eingang und den angrenzenden Fenstern springt ein von vier Karyatiden getragener Balkon vor, der im Piano nobile vom Tanzsaal her betreten werden kann. Interessant und von den üblichen Fassadengliederungen dieser Zeit abweichend ist die Gleichbehandlung von erstem und zweitem Geschoß, was offenbar damit zusammenhängt, dass das zweite Obergeschoß für Epsteins Kinder vorgesehen war. Das erklärt auch, warum die Feststiege bis dort hinaufführt. Jedenfalls wirkt die Fassade stark beruhigt, aber deswegen nicht weniger edel. Offenbar klassisch bürgerliches Understatement, die Prachtentfaltung findet im Inneren statt.
Über die Jahrzehnte wurde aber vieles übertüncht und demontiert, glücklicherweise fanden sich einzelne Teile dann auf dem Dachboden wieder. Eine eigene Frage wäre, wer mit welchem Kulturverständnis übertünchen ließ und wer die handwerklich und mechanisch anspruchsvollen Schiebetüren nicht einfach vernichten wollte. Und eine weitere, warum sich derartige Vorgänge an hochwertigen Bauwerken mit konstanter Regelmäßigkeit wiederholen.
1998 erfolgte der Präsidialbeschluss über die Nutzung als Abgeordnetenhaus. Die das Projekt leitende Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) schrieb 2002 einen internationalen Wettbewerb aus, den die Wiener Architekten Georg Töpfer und Alexander van der Donk gewannen. Ihr Konzept nützte die oben erläuterte rationale Struktur, die zwischen Feuermauer und Gang noch einen schmalen Dienstteil enthielt. Den Gang öffneten sie im Erdgeschoß in beide Richtungen: zur Anlieferung und als neuen Eingang an der Parlamentsseite. Den alten Dienstteil entfernten sie vollständig und vermochten hier auf engstem Raum die notwendigen Vertikalerschließungen wie Aufzüge, Nottreppe, Luft- und Installationsschächte sowie die Toiletten unterzubringen. Eine weitere starke Veränderung betraf das Dachgeschoß. Hinter der Blicke abschirmenden Firstbalustrade ist unter einem flachen Glasdach eine vielgliedrige Bürozone eingeschoben. Dachtragwerk und beschattende Lamellen sind geschickt integriert, sodass in der Gegenrichtung der Blick zum Himmel frei wird.
Als weitere Spezialität sind „Negativgaupen“ in die Dachfläche geschnitten. Sie erlauben den Ausblick auf Türme und Dächer der Innenstadt, sind aber von außen kaum bemerkbar. Ertrag dieser Bemühungen ist die weitgehend störungsfreie Bewahrung der hochwertigen historischen Substanz, die nach aufwendigen Analysen durch Spezialisten des Denkmalamts unter den später aufgetragenen Schichten, die in keiner Weise an die Qualität der ursprünglichen Oberflächen heranreichen, hervorgeholt und in behutsamer Handarbeit gesichert und aufgefrischt werden konnte. Gemalte Holzmaserung oder Stuckmarmor galten lange Zeit als „Fälschungen“ und wurden verächtlich gemacht. Heute ist das Verständnis dafür wieder gewachsen, und im Kontext lässt sich nun das Zusammenwirken von Farben, Mustern, Kunst- und Naturmaterialien zu einem Gesamtkunstwerk gut nachzuvollziehen.
Ein Blick auf die Lebensläufe der beiden in den frühen 1960er-Jahren geborenen Architekten - von praxisfernen Schreibern gern mit dem einsamen Komparativ „jünger“ bezeichnet - zeigt, dass sie nicht zuletzt erfahrene Berufsleute sind. Nach dem Studium an der von Persönlichkeiten wie Ernst Hiesmayr, Hans Puchhammer und Anton Schweighofer geprägten Technischen Universität Wien arbeiteten sie mehrere Jahre in anspruchsvollen Architekturbüros, sich das praktische Rüstzeug und die nötige Erfahrung aneignend. Deshalb mussten sie gegen den starken Bestand des Palais Epstein nicht verzweifelt ankämpfen, sondern fühlten sich in die denkmalpflegerische Arbeit ein, fanden bei neuen Elementen das richtige Maß für strukturelle Nähe und subtile Distanz und erzielten so die nachhaltigere Lösung der gestellten Aufgabe als mit theatralischen Gegensätzen, die sich abnützen und bald lächerlich wirken.
Was sich von keinem Katheder aus lehren lässt: das Erlebnis nicht entfremdeter, nützlicher Arbeit. Architekturstudenten aus Linz und Wien planen und bauen für Bedürftige in Südafrika und im Senegal.
Problemlösungskompetenz in der Überflussgesellschaft, Teamfähigkeit unter den Bedingungen des Starprinzips und Praxisbezug in einer zunehmend medial geprägten und automatisierten Welt: Wie sollen sich Studierende der Architektur diese für das spätere Berufsleben wesentlichen Kenntnisse und Erfahrungen aneignen, wenn bloß Geniekult, Individualitätswahn und oft zynische Arroganz den Lehrbetrieb bestimmen? Den Anstoß zu einem Semesterprojekt der anderen Art gab im vorigen Jahr Christoph Chorherr mit seinem Unternehmen für soziale und nachhaltige Architektur (sarch). Nach einer Zusammenarbeit mit Lehrenden und Studierenden der Technischen Universität Wien kontaktierte er Roland Gnaiger, Leiter der Studienrichtung Architektur an der Kunstuniversität Linz. Dieser war selber überrascht, wie viele Studierende sich in der Folge für das Thema interessierten.
In viereinhalb Monaten Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeit errichteten zwei Dutzend angehende Architektinnen und Architekten unter Anleitung von Lotte Schreiber, Richard Steger, Anna Heringer und Sigi Atteneder sowie unterstützt von Oskar Pankratz (Solararchitektur) und Martin Rauch (Lehmbau) für das Behindertenheim Tebago in der Township Orange Farm bei Johannesburg zwei Häuser mit je etwa 70 Quadratmeter Nutzfläche sowie eine Gartenhalle und gestalteten auch die umgebenden Außenflächen. Begeisterung und Einsatzfreude stießen auf eine Aufgabe, die im vergleichsweise reichen Mitteleuropa in Vergessenheit geraten zu sein scheint: das Bauen aus purer Notwendigkeit, die Lösung der Behausungsfrage auf unterster Stufe. Dabei konnten primäre Erfahrungen gemacht und fundamentale Erkenntnisse gesammelt und vermittelt werden, wie sie weder Zeichentisch noch Bildschirm bieten.
Wenn der Mangel den Kapitaleinsatz begrenzt und die Materialwahl drastisch einschränkt, sind praktische Problemlösungskompetenz und Improvisationsvermögen gefragt. Und die Einsicht in die Notwendigkeit bestimmt den Planungs- und Bauprozess. So viel Grundsätzliches, bezogen auf so viele Aspekte des Bauens, lässt sich vom Katheder aus gar nicht dozieren, wie im Rahmen eines solchen Projekts gleichsam selbstverständlich für jeden Einzelnen an Verständnisgewinn entsteht. Dabei mag das reale Produkt, gemessen an der unsäglichen Armut und den gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten, als Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, doch verkennt man die Vorbildwirkung, wenn die Einheimischen die Vorteile einer angepassten, einfachen Bauweise funktional und technisch nachvollziehen und mit den vorhandenen Materialien auch kopieren können. Da sie von ihren kulturellen Wurzeln getrennt wurden, sind sie wegen sozialer, hygienischer und zahlreicher anderer Probleme in den Townships kaum aus eigener Kraft in der Lage, die Stufe der hoffnungslos unpraktischen, im Südsommer zu heißen und im Südwinter zu kalten Blechhütten zu überwinden.
So mag der Ertrag kurzfristig für die Studierenden sogar höher sein, weil sie ihn optimal in ihre Ausbildung zu integrieren vermögen und das Erlebnis der nicht entfremdeten, unmittelbar nützlichen Arbeit ein bleibendes für das ganze spätere (Berufs-)Leben sein wird. Aber längerfristig kann ihr Einsatz über den Kreis der unmittelbar Begünstigten des Behindertenheims hinaus nachhaltige Wirkung entwickeln und als Folge des gezielten Einbezugs einheimischer Arbeitender die Selbsthilfe anregen und fördern. Die Freude in jeder Phase der Projektarbeit drückt sich in den Gebäuden aus: Sie strahlen so viel positive Kraft und bescheidene Schönheit aus, dass daneben all die modisch gestylten Nutzlosigkeiten unserer Überflussgesellschaft verblassen. Es ist dies der Glanz, der gleichsam als Nebenprodukt eines intensiven sozialen wie materiell-technischen Prozesses zu entstehen vermag. Wenn die Studierenden diesen Vorgang begriffen haben und im weiteren Verlauf ihres Berufslebens anzuwenden und umzusetzen wissen, dann ist für sie und die Architektur viel gewonnen.
Noch nicht so weit gediehen ist das von Richard Vakaj an der Akademie der bildenden Künste initiierte Projekt von Behausungen für Straßenkinder im Senegal, nachdem er vor acht Jahren mit Schülern der Camillo-Sitte-Lehranstalt für Straßenkinder in Rumänien einfache Behausungen errichtet hatte („Spectrum“ vom 15. März 1997). Auch diesmal geht es um einfachste Schlafmöglichkeiten, zusammengefügt aus vorgefertigten Holztafeln. Eine Studentin schreibt dazu: „So waren vor allem die finanziellen Mittel sehr eingeschränkt und ließen uns bald von zu aufwendigen Ideen zu sehr einfachen, aber zweckdienlichen übergehen.“ Als Vermittler der senegalesischen Verhältnisse wirkte der von dort stammende Pater Bonaventura, Pfarrer in Horn, der seit längerem Hilfsprojekte organisiert. Je zwei quaderförmigen Raumzellen mit vier Schlafplätzen in Stockbetten und einem breiten Fensterbrett als Tischplatte sind eine Toiletten- und eine Duschkabine zugeordnet. Eine Gruppe von mehreren derartigen Paaren bildet einen Hof, ergänzt durch einen Gemeinschaftsraum und eine Küche.
Vorerst haben vier Studierende zusammen mit Richard Vakaj einen Prototyp gebaut, an dem eine weitere Vereinfachung studiert wurde. Es zeigte sich, dass die unterschiedliche Vorbildung - einer war nach Tischlerlehre und Arbeit über die Studienberechtigungsprüfung an die Akademie gekommen, für einen anderen war die Lehrerpersönlichkeit Carl Pruscha wichtig, der seine Erfahrungen aus Nepal mit dem dortigen einfachen Bauen vermittelt hatte. Dazu schreibt die Studentin: „Meine Studienkollegen, die länger an der Akademie studieren, haben mir in Momenten der Unsicherheit geholfen und mir viel beigebracht.“ Wieder erweist sich der Nutzen der praktischen Arbeit nicht bloß als Hilfe für andere, sondern als Effekt gegenseitiger Unterstützung auch in der eigenen Fachausbildung.
Obwohl einiges schon gesponsert wurde, benötigt das engagierte Projekt noch einen weiteren materiellen Schub, damit die Teile für etwa 40 Schlafplätze gefertigt werden können. Sie sollen dann in Containern an den Bestimmungsort Ziguinchor in Senegal transportiert und von den Studierenden aufgebaut werden.
Man kann sich von der Globalisierung bedroht fühlen und sich einbunkern, oder man kann, wie die Studierenden in Linz und Wien es vormachen, aktiv damit umgehen, seine Kräfte, die in diesem Alter unerschöpflich scheinen, zum Nutzen von Mitmenschen in extrem bedürftigen Verhältnissen einsetzen und daraus für die eigene Aus- und Charakterbildung einen fundamentalen Nutzen ziehen.
[ Die Ausstellung „Living Tebogo“ im Architekturforum Oberösterreich ist bis zum 28. Oktober zu sehen: Mittwoch bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 20 Uhr. Kontakt zur Unterstützung des Senegal-Projekts: Pater Bonaventura, Horn; Richard Vakaj, Wien. ]
Wie ein Vorposten der Stadt steht es da, das neue Messe-Hotel von Hermann Czech am Wiener Prater. Außen janusköpfig und doch mit klarer Kontur, innen von zeitlos sprödem Charme.
Man sollte es sich nicht zu leicht machen mit einem Bauwerk von Hermann Czech. Erstens hat er selber die Architektur nie auf die leichte Schulter genommen, denn sie hintergründig zu machen, damit sie dort ankommt, wo sie seiner gewichtigen Meinung nach hingehört, ist Arbeit. Eine Arbeit, die allerdings nicht ins Schwitzen bringt, weil sie geistiger Natur ist. Zweitens verfehlt man ihr Wesen, wenn man sie episodenhaft aufnimmt und an den Oberflächen kleben bleibt. Man muss sich auf sie einlassen und in die Tiefe der Schichten vordringen. Übernachten ist nicht unbedingt erforderlich, aber auch nicht hinderlich.
Zwar steht das Gebäude neun Geschoße hoch vor der Nordwestseite des Messegeländes, an jener Stelle, wo die vom Volksprater kommende Perspektivstraße auf die Messestraße trifft, aber mit seiner Krümmung folgt es der Kurve der nördlich wegstrebenden Nordportalstraße. Wie ein Vorposten der Stadt nimmt es diszipliniert Bezug auf die Struktur des Straßennetzes, nutzt aber zugleich das Element der Straßenkrümmung, um damit Identität zu gewinnen.
Mit seiner konkaven Seite umfasst der Baukörper einen grünen Hof, der als Vorfahrt dient. Obwohl an schwach definierter Lage, wirkt das Bauwerk stadtbildend und ordnend, scheut sich aber auch nicht, die Stellung wirkungsstark auszubauen, denn es neigt sich geringfügig um vier Grad nach außen. Als würden die oberen Geschoße vom Kurvenschwung weggedrückt, löst sich der Baukörper von der Vertikalen.
Der Sockel allerdings steht fest. Dies wird nicht etwa mit „schwerem“ Material erzeugt, sondern mit einem geometrischen Muster, das dem Architekten vor Jahren in Leo von Klenzes Münchener Glyptothek aufgefallen ist, weil es trotz exakter Regel auf den ersten Blick unregelmäßig scheint wie Zyklopenmauerwerk. Das Muster ist daher nicht bloß historisches Zitat, sondern etwas Gefundenes, dessen grafische Wirkung faszinierte, und das, in einen anderen Zusammenhang gesetzt, den gewünschten Effekt unterstützt, ohne dass man über die Herkunft Bescheid wissen muss.
Mit einer konkaven und einer konvexen Seite wirkt das Bauwerk trotz gleicher Fassadengestaltung janusköpfig, als hätte es zwei Vorderseiten. Und so staunt man auch nicht, dass es von beiden Seiten betreten werden kann. Überhaupt, die Fassaden: Jedes Hotelzimmer weist eine Fenstertüre sowie anschließend ein Fenster mit normaler Parapethöhe auf, wobei die Position von Tür und Fenster mit jedem Geschoß wechselt. Diesem geometrisch-rhythmischen Fassadenbild wird ein zweites Muster dunkler, horizontaler Streifen scheinbar beziehungslos überlagert, obwohl ihr Abstand exakt eineinhalb Geschoße hoch ist. Die beiden Muster interferieren so stark, dass die Geschoßzahl schwer zu fassen ist und der Baukörper als ein Ganzes und damit monumentaler wirkt. Das ist viel Effekt für wenig Geld.
Die drei Fluchttreppen, je eine an den Stirnseiten sowie eine ungefähr in der Mitte der konkaven Seite, sind als Stahlstiegen auf das notwendige Minimum reduziert, stehen sie doch nur für den Notfall da, der statistisch alle paar Jahrzehnte auftreten mag. Mit ihrem amerikanisch-pragmatischen Charme scheinen sie gar nicht dazu zu gehören.
Zwei Geschoße hoch belegt die Hotel-Lobby den Mittelabschnitt des Gebäudes. Sie erhält Licht über hohe seitliche Glaswände, die sie zugleich nach außen abbilden. Damit die beidseitigen Windfänge genug Platz haben, sind die Betonstützen an diesen Stellen trapezförmig gespreizt. Als Ausnahmeelemente markieren sie natürlich auch den Eingang, und heute mag man es bekanntlich schräg. Doch wer die Arbeiten von Hermann Czech kennt, weiß, dass er schon sehr früh gern schräge Stützen plante, bloß kam er kaum dazu, welche zu bauen. Gleich nach den Eingängen steht je eine weitere Stütze da. Zuerst denkt man sich, warum jetzt das, die stehen doch im Weg. Das tun sie auch und schirmen damit den Binnenbereich vom Eingangsdruck ab, lenken die Bewegungen der Eintretenden um und beruhigen die als Querverbindung dienende Mittelzone.
Die Sessel der Lounge, entworfen für die Swiss Re in Rüeschlikon und hier wieder im Einsatz, paraphrasieren einen Entwurf von Le Corbusier und Charlotte Perriand. Doch Czech übt in der Tradition von Josef Frank Kritik an der harten, oft unpraktischen Moderne, indem er einen Zusatz anbringt: Ein Griff vorn an der Armlehne, ähnlich einer großen Fadenspule, erleichtert das Hochkommen aus den Lederpolstern. Das bricollage-haft angefügte Stück stammt vom Sessel, der vor Jahren für das Palais Schwarzenberg entworfen wurde. Die Kritik des Architekten ist die ausgeführte Korrektur. Zusammen mit der Farbgebung fordert sie die Klassikergläubigkeit gewisser Kreise heraus.
Während die unregelmäßig gelochte, an die 1950er-Jahre erinnernde gelbe Akustikdecke über dem zwei Geschoße hohen Teil durchgeht und damit die Einheit des großen Raumes betont, trennt eine Glaswand einen Teil als Speisesaal ab. Ihr Verlauf wirkt zufällig, fast ungelenk, was sicherlich Absicht ist, denn damit wird ihr trennender Charakter zurückgenommen. Sie scheint provisorisch, als wäre sie später dazugekommen, was sie natürlich nicht ist. Vielmehr handelt es sich um architektonisches Kalkül.
An beiden Stirnseiten der hohen Raumzonen schließen niedrige Raumzonen an. Die vertikalen Flächen dieses Versatzes sind mit großformatigen Fotografien gefüllt. Über den Speisesaal scheint sich ein barocker Balkon zu schieben, der Ausschnitt einer illusionistischen Malerei im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, fotografiert von Margherita Spiluttini; während über der Café-Lounge die Skyline der Donau-City - leicht verfremdet - prangt, festgehalten von Seiji Furuya. Von den beiden Kunstschaffenden stammen auch die Fotografien in den Hotelzimmern, womit auch dort ein anspruchsvolles Niveau herrscht, was man nicht oft antrifft.
Die Hotelzimmer sind, wie in dieser Kategorie üblich, nicht besonders groß, aber mit wenigen Möbelstücken, furniert mit einheimischen Edelhölzern, sympathisch eingerichtet. Außer dem Bett gibt es einen Arbeitstisch mit Sessel, ein bequemes Fauteuil, das Schränkchen mit Minibar und Safe sowie hinter einer Holzblende, die das Sakko auf dem Bügel nachzeichnet, die Kleiderstange. Im Duschbad dann eine Wiederbegegnung mit dem seitenrichtig gespiegelten eigenen Bild - im Übereck-Spiegel.
Auf dem Rückweg durch den Hotelgang fallen die schrägen Flächen auf, die der äußeren Neigung folgen. Ohne zusätzliche Maßnahmen gewinnt der Gang räumliche Spannung, die diesen vor vielen anderen, öden und verwinkelten, auszeichnet.
Hermann Czech liebt die gefinkelte, intellektuell anspruchsvolle Inszenierung. Dabei mischt er, oft recht harsch, Elemente konkreter Ungestaltetheit dazu, die wie „passiert“ aussehen, aber gerade das nicht sind. Vielmehr kontrastieren sie das andere, bequeme, gediegene, auch traditionale Element und schaffen zugleich ein Klima zeitlicher Unbestimmbarkeit, das dem Heute besser entspricht als modisch geschniegelte Glätte.
Einst eine der vielen Kreuzungen aus Schule und Kaserne. Jetzt eine Halle mit Galerien, lichtdurchflutet. Und außen eine Freitreppe, die klar signalisiert: Eingang! Der Umbau der Handelsakademie in Korneuburg durch Nehrer Medek & Partner.
Die städtebauliche Entwicklung von Korneuburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts un terscheidet sich kaum von jener ähnlicher Bezirkshauptstädte. Außerhalb des geschleiften Mauerkorsetts legt sich an die „Ringstraße“ ein Kranz öffentlicher Bauten; eine schöne und markante städtebauliche Figur, die bis in unsere Zeit weitergeführt wurde. Ihre Logik erlaubt es, sich in solchen Städten prinzipiell zurechtzufinden - auch wenn ein Stadtplan im konkreten Fall immer nützlich ist.
Das Gebäude der Handelsakademie liegt nördlich des Stadtkerns an einer Kurve des Dr.-Karl-Liebleitner-Rings am Übergang zum vorstädtisch orthogonalen Straßenraster. Auf Letzteren bezogen, war der Altbestand städtebaulich nicht besonders sensibel eingefügt. Vielmehr ist die symmetrische Fassade vom Ring weggedreht, sodass davor eine ungleiche Restfläche übrig blieb und die städtebauliche Figur eine sinnlose Störung aufwies. Überhaupt war der Altbau alles andere als ein Meisterwerk. Mit den drei flachen Risaliten gelang es nicht, die Fassade wirksam zu gliedern, und der enge, mittige Eingang war weder einladend noch besonders funktionell. An der Rückseite schloss einseitig ein kurzer Seitenflügel an und in der Mitte, der Typologie derartiger Zweckbauten folgend, das Stiegenhaus mit den Toiletten. Eine der verbreiteten Kreuzungen aus Schule und Kaserne eben.
Das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Projekt von Nehrer Medek & Partner löst eine Reihe von städtebaulichen sowie funktionalen Defiziten des Altbaus und verleiht der Anlage deutlich mehr Charakter. Dabei wird nicht die Typologie des Altbaus fortgesetzt, etwa mit einer Verlängerung und Ergänzung durch Seitenflügel, sondern ein ebenfalls winkelförmiger Baukörper an die Rückseite des Altbestands gerückt, sodass sich dazwischen eine lichtdurchflutete Halle mit Gale-rien und Treppenläufen öffnet. Zusammen mit den ehemaligen Korridoren ergibt dies eine lang gezogene, ringförmige Erschließung mit Querverbindungen in Form breiter Stege. Damit gewinnt das neue Ganze eine funktional mehrdeutige, weiträumige Mitte.
Doch damit nicht genug. Die unattraktive zentrale Türe in den Altbau mit nachfolgendem Treppenschluf wird zum Nebeneingang erklärt und der kürzere Schenkel des Neubauteils neben dem Altbau nach vorn gezogen. Er erscheint als markanter Quader, aufgestelzt auf hohen Rundstützen, zwischen denen eine breite Treppe das angehobene Hauptgeschoß erschließt. Seitliche Rampen führen zu den Garderoben im Sockelgeschoß. Die monumentale Stirnseite und die Freitreppe signalisieren klar „Eingang“. Vor allem aber profitiert das neue Portal von dem in diesem Bereich tieferen Vorfeld. Damit wird die bisher unbefriedigende städtebauliche Lage des Altbaus geschickt relativiert und durch die unmissverständliche Geste des neuen Eingangs das Vorfeld positiv aktiviert.
Aber mit dem kompakten Konzept wird nicht nur die Straßenfront verbessert. An der Rückseite bleibt auf dem Grundstück ein großzügiger Freiraum offen für Pau-senflächen, ein Sportfeld und für eine mit Bäumen bestandene Wiese. Eine neue Turnhalle schließt entlang der Seitenstraße an den alten Seitenflügel an und schirmt den Binnenbereich von dieser Seite her ab.
An der anderen Seite verbindet ein neuer Fuß- und Radweg Ring und rückwärtige Straße, was in Korneuburg, wo auch ältere Menschen sich noch aufs Rad trauen können, geschätzt wird. Archi-tektonisch besteht der Dialog zwischen den beiden sich ergänzenden Gebäudewinkeln von Alt und Neu aus einer differenzierten Interpretation des Zwischenraums. Nach vorn bleibt bloß ein schmaler Spalt von der Breite ei- ner Armspanne. Doch ist er nicht nur als formale Distanznahme eingesetzt, wie in zahlreichen anderen Fällen, vielmehr enthält er im Grundriss den links an der Freitreppe vorbeiführenden Rampenweg zur Garderobe im Sockelgeschoß.
Im Binnenbereich, wo sich die beiden langen Schenkel der Gebäudewinkel gegenüberstehen, ist es die bereits angesprochene Oberlichthalle mit den dynamischen Elementen der Treppenläufe und den statischen der Galerien, die zur funktionalen und architektonischen Mitte des Bauwerks wird.
An der Rückseite erweitert sich der Abstand zwischen Alt und Neu, die Erschließungsgalerien werden zu verbindenden Brücken hinter einer verglasten Wand. Eine Freitreppe führt vom Hauptgeschoß in den abgesenkten Gartenhof. Der breite Treppenlauf wird flankiert von halbhohen Gitterwänden, die dem Element im dreiseitig durch Gebäudeteile definierten Außenraum die nötige Kraft verleihen, sodass es nicht bloß funktionell dienlich ist, sondern zugleich auch architektonisch wirksam.
Hier stehen sich der renovierte his-toristische Altbau mit lichtbedürftigen Fenstern von Klassenzimmern und die glatte Fassade des Neubaus, mit alu- miniumbeschichteten Kunststoffplatten geschützt, ein kurzes Stück weit gegenüber. Beide wahren sie ihren Charakter, sind aber zugleich anspruchslos und konkurrenzieren einander nicht, sondern sie bedeuten dasselbe - stammen jedoch aus verschiedenen Zeiten.
Das Innere ist sparsam gehalten; der Luxus manifestiert sich in Raum. Schall absorbierende Flächen sorgen dafür, dass der Nachhall gedämpft wird und man sein eigenes Wort noch verstehen kann, wenn aus allen Klassen die Schülerinnen und Schüler in die Pause strömen. In den Sommerferien, wenn alles aufgeräumt und leer ist, erscheint die Schule sehr spartanisch. Sie braucht das Leben, das von den Heranwachsenden in die Gänge, Galerien, Treppen und Hallen getragen wird. Dann kommt das architektonische Potenzial zur Geltung: das Vis-à-vis über die Halle hinweg; der Überblick auf die oder von der Treppe; die verschiedenen Raumqualitäten, etwa die Ganghalle, die als kleiner Festsaal abgetrennt oder, mit der Oberlichthalle verbunden, zur großen Aula werden kann; dann die kleine Bar für Getränke, Gebäck und Mehlspeisen, von deren Tischchen aus man wie aus einer Loge durch die hohe Glaswand auf das Spielfeld schauen kann.
Selbstverständlich ist eine Schule ein Lernort. Dafür ist die Handelsakademie auch mit großen Klassenzimmern und unzähligen Computern ausgerüstet; aber sie ist ebenso sehr gesellschaftlicher Begegnungsort, wo viele aufeinander folgende Schülergenerationen ihr Sozialverhalten außerhalb der Familie entwickeln können sollten. Und dafür müssen Architektur und Raum vorhanden sein. In Korneuburg wurde dies von Nehrer Medek & Partner überzeugend dargelegt und umgesetzt.
Wie man auf einem ehemaligen Öltank ein Schulgebäude errichtet. Und warum es sich lohnt, wenn Architekt und Bauingenieur an einem strukturellen Strang ziehen. Das Volta-Schulhaus in Basel.
Seit vier Jahren ist das Volta-Schulhaus im Basler St. Johann-Quartier nun in Betrieb. Es steht nahe der mittlerweile doppelstöckigen Dreirosenbrücke der Stadtautobahn über den Rhein. Auf der anderen Seite des Verkehrsbandes ist der Novartis-Campus im Entstehen; ein erster Bau von Diener, Federle und Wiederin ist soeben fertig geworden, ein weiterer, von Adolf Krischanitz, ist im Bau. Doch die Realität im Quartier beidseits der Straße, die geradeaus ins Elsass führt, ist eine andere.
Wegen des hohen Anteils an Kindern mit fremder Muttersprache werden - neben der deutschen - eben diese Sprachen unterrichtet, weil die Kinder so ein klareres Sprachgefühl entwickeln und in der Folge besser Schriftdeutsch lernen. Dies bedingte flexible Unterrichtsformen, ausreichend Gruppenräume neben den Klassenzimmern und ein neues Haus. Viel Platz gab es im Quartier allerdings nicht, sodass der Wegfall eines Teils der verpflichtenden Lagerkapazität für Schweröl des nahen Heizkraftwerks eine Chance bot. Der aus den 1960er-Jahren stammende Betonbau enthielt große Stahltanks in tiefen, wasserdichten Wannen. Nicht ganz die Hälfte stand zur Disposition. Ein Architektenwettbewerb sollte die Möglichkeiten klären.
Es gewann das Projekt der Basler Architekten Paola Maranta und Quintus Miller, das sie zusammen mit dem Bauingenieur Jürg Conzett aus Chur entwickelt hatten. Dabei ging es um die Frage, wie über der intakten Wanne ein Schulgebäude errichtet werden könnte. Als nicht eben harmlos erwiesen sich die Maße: 40 Meter Trakttiefe, 33,5 Meter Breite. Aber ebenso wenig ließen sich Punktlasten auf den Wannenboden aufsetzen. In solchen Fällen lohnt es sich für Architekten, frühzeitig mit einem Bauingenieur, der das Zeug und den Willen zum Tragwerksplaner hat, zusammenzuarbeiten.
Die Rolle des Bauingenieurs wird leider zu oft als die des „Statikers“ gesehen, der in Naviers Namen (Claude Louis Navier, 1785 bis 1836, Begründer der modernen Baustatik) eben berechnet, was ihm der Architektenentwurf vorgibt, und dabei in der Regel die Dimensionen erhöht. Sei es, weil der Architekt zu knapp geschätzt hat, sei es, weil der Statiker sich nicht plagen will. Mit einem Bauingenieur hingegen, der als Tragwerksplaner wirkt, lassen sich die Möglichkeiten viel umfassender ausloten. Vor allem aber kann das Tragwerk integraler Teil von Funktionsstruktur und Raumbildung werden.
Genau das ist im Volta-Schulhaus geschehen. In der Diskussion der Fachleute wurde ein vier Geschoße hohes räumliches Tragwerk aus Scheiben und Platten entwickelt, das die gesamten Gebäudelasten auf die Außenwände der Wanne überträgt. Das heißt: Einige der vertikalen Trennelemente aus Stahlbeton sind als Scheiben mit den ebenfalls betonierten Deckenplatten fest verbunden. Damit es jedoch nicht zu simpel werde, sah das Konzept im Binnenbereich vier Lichthöfe vor - bei der enormen Trakttiefe unumgänglich. Das betraf vor allem die Deckenplatten. Aber zwischen den einzelnen Schotten sollten die Menschen noch hin und her gehen können, die Betonscheiben mussten daher Öffnungen aufweisen. Das tun sie auch, und zwar nicht zu geizig, wie in der Plandarstellung zu erkennen ist. Drei derartige Schotten sind also über die darunter liegende Wanne gespannt, in der die Doppelturnhalle samt Garderoben und Nebenräumen Platz hat. Wer etwas tiefer in das komplexe Gebilde eindringt, stellt fest, dass unter der im Plan größeren Scheibe offenbar ein Querträger liegen muss, was auch stimmt, und bei der im Grundriss mittleren Schotte ist die große Öffnung spiegelgleich nach links gerückt, damit die Biegekräfte in den auf Druck beanspruchten Decken nicht unangenehm werden. Die zusätzlichen Öffnungen für die beiden quer liegenden Treppen und für die breiten Fenster sind dann bloß noch Kinkerlitzchen. Das Übrige ist Leichtbau.
Wir erinnern uns: Da gibt es im Obermurtal eine Holzbrücke über die Mur, die ebenso frech in der Mitte eine breite Öffnung aufweist, flankiert von zwei außermittig angeordneten Scheiben. Ja, genau die. Auch hier hieß der entwerfende Bauingenieur Jürg Conzett.
Mit ähnlichen Überlegungen, aber anderem Material und komplexer spielt es sich im Volta-Schulhaus in Basel ab. Aber was heißt das für die Architektur? Für die räumliche und die funktionale Struktur bedeutet das vorerst, dass man davon wenig merkt. Man betritt das Gebäude von der Hofseite und gelangt in eine die gesamte Breite einnehmende Querhalle.
Von dieser Aula, die bei Schlechtwetter als Pausenhalle dient, führt vom Eingang aus geradewegs eine Treppe ins erste Obergeschoß, das mit den anderen drei Obergeschoßen weit gehend deckungsgleich ist. Der Aufgang lässt sich mit einem Rollbalken schließen, da die Turnhallen am Abend und an Wochenenden Vereinen offen stehen.
In den eigentlichen Schulgeschoßen reihen sich die Zimmer und Gruppenräume wegen der Belichtung vorn und hinten an der Fassade. Den Binnenbereich teilen sich die vier alternierend gegeneinander versetzten Lichthöfe und die von ihnen mit Tageslicht versorgten Ganghallen. Zwei Treppen dienen als Vertikalverbindungen, und natürlich gibt es für Gehbehinderte einen Aufzug.
Der Stahlbeton der Scheiben und Deckenuntersichten liegt offen, die Tragstruktur wird gezeigt. Die übrigen Wände in Leichtbauweise sind in einem warmen Grauton gleicher Helligkeit gehalten, sodass der Unterschied nicht sofort auffällt. Die einzelnen Teile über die vier Geschoße zu verbinden ist anhand der Pläne einfacher als im Bauwerk selbst. Das Tragwerk ist daher keineswegs in den Vordergrund gerückt, es ist vielmehr ein integraler Teil der Architektur.
Im Gegensatz zu kammartigen Grundriss-Typologien liegt hier eine offene Gitterstruktur vor. Sie hat mehr mit einem urbanen Gefüge zu tun, das eine nicht hierarchische Struktur aufweist. Dies wäre generell für große öffentliche Gebäude und Wohnanlagen angezeigt, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls erschöpft sich das architektonische Genießen im Volta-Schulhaus nicht an den Äußerlichkeiten.
Nichts überfordert, nichts übertrumpft. Historischer Bestand in zurückhaltend zeitgenössischer Gestaltung: Wien, Herrengasse 9, 11 und 13. Außenministerium und Nationalbibliothek haben drei erneuerte Häuser bezogen.
Bauzaun und Container am Minoritenplatz sind verschwunden, die schweren Baufahrzeuge, die oft genug den Verkehr zum Stillstand zwangen, sind andernorts im Einsatz. Von außen ist nicht viel Veränderung abzulesen, sieht man ab vom zweigeschoßigen, verglasten Steg über der Leopold-Figl-Gasse sowie von dem schmalen Streifen der beiden gänzlich erneuerten Dachgeschoße auf dem ehemaligen niederösterreichischen Landhaus. Natürlich wurden auch die Fassaden aufgefrischt, aber sonst gleicht das neue lokale Stadtbild dem alten.
Als Generalplaner für Umbau und Erneuerung der drei Häuser Herrengasse 9, 11 und 13 wurde Architekt Gerhard Lindner beauftragt, der sein Atelier in Baden hat, und im Umgang mit denkmalgeschützten Bauten über jahrelange Erfahrung verfügt. Bereits voll in Betrieb ist das mittlere Haus, die Nummer 11. Es wurde 1845 bis 1848 von Paul Sprenger als „Statthalterei“ für die Verwaltung Niederösterreichs gebaut. Baukünstlerisch interessant sind das westliche Stiegenhaus - das östliche wurde im Krieg zerstört - und der Marmorsaal. Letzterer weist an den Wänden prächtigen Stuckmarmor in duftigen Pastelltönen auf. Aus Unkenntnis wird dieses vom Naturstein verschiedene Gestaltungsmittel oft als falscher Marmor, ja als „Fälschung“ bezeichnet. Dieser Irrtum klärt sich schnell in dem von Deckenmalereien Leopold Kupelwiesers überwölbten Raum.
Für die neue Nutzung als Außenministerium wurde der Hauptzugang an den Minoritenplatz verlegt. Sicherheitserfordernisse und denkmalpflegerische Auflagen stellten dem Architekten manche verzwickte Aufgabe, die aber meist mit ansprechender Zurückhaltung gelöst wurde. Vor allem klärte er die ziemlich verbaute Raumstruktur und vereinfachte damit die innere Orientierung. Alte, profilierte Türen wurden gerichtet, die Böden - etwa im Stiegenhaus - gereinigt, aber sonst belassen. Hingegen wurden neue Sanitärgruppen eingebaut und Aufzüge - knapp abgegrenzt - in den Bestand eingeschnitten.
Neue Türen weisen alle die gleichen, standardisierten Zargen auf, in welchen die Türblätter bündig einschlagen. So ergibt sich ein ruhiger Gesamteindruck, in dem Alt und Neu mit derselben Selbstverständlichkeit nebeneinander stehen und dank einer strukturellen Verwandtschaft gut harmonieren. Weniger geglückt ist die von einem „Farbgestalter“ nachträglich vorgenommene, cremige Ausmalung der Gänge. Trotz der „sonnengelben“ Flächen wirken die Korridore nun eher stumpf als hell. Der neu gestaltete Raum des Pressezentrums ist akustisch und optisch stark beruhigt, wird aber gerade dadurch nobilitiert.
Das Auswärtige Amt beansprucht überdies vier Geschoße im benachbarten Haus Herrengasse 13, dem früheren niederösterreichischen Landhaus. In diesem Gebäude wurden 1832 bis 1848 von Alois Pichl verschiedene, teils bis ins Spätmittelalter zurückreichende Teile zu einem Gesamtbauwerk vereinigt, an dem aber die baulichen und stilistischen Unterschiede nicht amalgamiert, sondern integriert wurden. Diesen Ansatz führt Gerhard Lindner, da und dort sogar recht pointiert, weiter. Die Verbindung zum Haupthaus erfolgt über den zweigeschoßigen neuen Glassteg. Vor allem aber wurden die zwei obersten Geschoße gänzlich ersetzt. Sie treten zwar nach außen kaum in Erscheinung, ermöglichen aber eine optimale innere Organisation, denn zuvor waren nicht wenige Räume wegen zu großer Trakttiefe ohne natürliches Licht. Breite Sonnenblenden schützen die großzügigen Büroräume vor sommerlicher Einstrahlung. An der Westseite ergab sich hinter der Attikamauer zum Minoritenplatz sogar Raum für einen attraktiven Gartenhof für Erholungspausen an frischer Luft.
Das Erd- und erste Obergeschoß mit den repräsentativen Räumen Landtagssaal, Herrensaal, Prälatensaal und Rittersaal behielt das Land Niederösterreich, um darin ein Veranstaltungszentrum und die Blau-Gelbe Galerie einzurichten. Der Landtagssaal mit der flach gewölbten, 1710 von Antonio Beduzzi ausgemalten Decke blieb natürlich weit gehend unverändert. Hingegen mussten in den üppigen, späthistoristischen Wand- und Deckenverkleidungen der anderen drei Säle die Maßnahmen für Lüftung und Klimatisierung möglichst versteckt untergebracht werden.
Im Erdgeschoß entstanden ausreichende Foyer- und Garderoberäumlichkeiten in zurückhaltend zeitgenössischer Gestaltung. Auch hier bewährte es sich, den heterogenen, teils attraktiven - beispielsweise gotischen -, aber zugleich schlichten Bestand nicht zu überfordern und auch nicht übertrumpfen zu wollen. Eine uneitle Gestaltung mit Eichenfurnier und Kratzputzflächen kommt dem entgegen.
Im südlichen Seitenflügel wird im Erdgeschoß die Blau-Gelbe Galerie einziehen. Für zeitgenössische Kunst vorgesehen, hält sich die Gestaltung auch hier angenehm zurück. Als Reminiszenz an die frühe Moderne weist der Boden einen fugenlosen Holzzementbelag auf, in den 1930er-Jahren oft als Industrieboden verlegt. Der weiträumige Innenhof wurde mit großformatigen Granitplatten gegenüber der früheren Situation mit Kleinsteinpflaster deutlich nobler definiert. Von hier aus treten auch die neuen Obergeschoße über dem alten Dachgesims in Erscheinung. Gestalterisch zurückgenommen, stören sie kaum.
In das Palais Mollard, Herrengasse 9, früher Niederösterreichisches Landesmuseum und in den hinteren, verwinkelt labyrinthischen Gebäudeteilen als Büros genutzt, zieht neu die Nationalbibliothek mit der Musiksammlung, dem Globen- und dem Esperantomuseum ein. Den barocken Straßentrakt erneuerte man mit denkmalpflegerischer Sorgfalt, während der hintere Teil unter Wahrung der Hofstruktur neu aufgebaut wurde. Im Wesentlichen enthält er einen Tief- und einen Hochspeicher. Vorzeigeelement ist jedoch das im rechten Seitenflügel neu errichtete Treppenhaus, dessen Innenwand aus verschiedenfarbigen, hinterleuchteten Glasflächen besteht. Da die Geschoßhöhen nach oben abnehmen, werden die Treppenläufe kürzer, und der Vertikalraum verengt sich nach oben keilförmig, was dem Raumerlebnis mehr Dynamik verleiht. Damit wird die bis ins 20. Jahrhundert reichende Tradition aufgenommen, Treppenhäuser als architektonischen Erlebnisraum, nicht als bloße Verbindung zwischen den Geschoßen zu interpretieren. Gewiss nehmen die meisten Leute den Aufzug, aber wenigstens abwärts ließen sich Treppen nutzen, was gesünder und hier auch räumlich interessant ist.
Die anspruchsvolle Tragwerksplanung und deren statische Berechnung stammen von den Bauingenieuren Manfred Gemeiner und Martin Haferl, in Architektenkreisen als architektursensible Fachleute seit längerem bekannt. Auch sie hatten weniger Sensationelles als unzählige knifflige Probleme zu lösen. Man mag nun einwenden, das sei für Architekten und Bauingenieure Alltag. Dass es aber trotz der komplexen Bedingungen in allen drei Häusern zu einem ansprechenden und angemessen unaufgeregten Gesamteindruck gekommen ist, ist eher eine positive Ausnahme. Denn aufgesetzte Eitelkeiten gibt es mittlerweile genug.
Als Prügelknaben sind sie schnell zur Hand, die Häuselbauer. Dabei steckte einst in ihrem Bauen die Erfahrung von Jahrhunderten - und durchaus ästhetische Perfektion.
Als Prügelknaben sind die Häuselbauer und ihre Produkte, der allgemein verbreitete Eigenheimbau, schnell zur Hand, wenn Architekten oder Kritiker so richtig loslegen. Ein Blick auf verhäuselte Landschaften bestätigt: Es herrscht ein Missstand. Doch mit permanenter Schelte wurde noch nie eine nachhaltige Verhaltensmodifikation erreicht. Unbesehen der gewichtigen raumplanerischen Argumente, die gegen den massenhaften Bau frei stehender Einfamilienhäuser sprechen, wie Landverbrauch, Infrastrukturkosten und Verkehrsaufkommen, findet er trotzdem statt. Aber wenn schon unvermeidlich, sollte er vielleicht vernünftiger erfolgen. Betrachten wir ihn daher einmal als Phänomen.
Eigentlich würde der verbreitete Eigenheimbau zum anonymen Bauen zählen, jenem traditionalen Hausbau früherer Zeiten. Das mag paradox klingen, aber für einen Großteil führen ähnliche Vorgänge zu Form und Gestalt, indem nämlich passende vorhandene Bauten, allenfalls geringfügig modifiziert, einfach kopiert werden. Auf diese Weise entwickelten sich vor Jahrhunderten jene regionalen Bautypen, die beispielsweise von der Bauernhausforschung erkannt und analysiert werden. Wirtschaftsformen, Klima, vorhandenes oder leicht greifbares Material, aber auch formgeschichtliche Aspekte führten zu oftmals und über Jahrhunderte wiederholten Typen, deren leichte Variation oder lagespezifische Modifikation jenes auf den ersten Blick gleichförmig-ruhige, im Detail jedoch vielfältig individualisierte Bild ergibt, das uns als „anonymes Bauen“ oder „Architektur ohne Architekten“ fasziniert. Die Vorbilder des anonymen Bauens stammten in der Regel von nebenan. An ihnen konnten auf gutnachbarschaftliche Art Mehr- oder Minderbedarf, auch die benötigte Menge Material abgemessen oder abgezählt, ja sogar die Kosten abgeschätzt werden. Und das alles ohne gezeichneten Plan. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sammelte sich in diesen Typenbeispielen sehr viel Erfahrung - und durchaus auch ästhetische Perfektion. Den Beweis liefern mehrere Publikationen, die heute als klassisch gelten.
Seit einigen Jahrzehnten verläuft nun aber der Prozess, wie man zu Situierung, Grundrissaufteilung, Fassade und letztendlich zu seinem Haus kommt, anders ab. Es werden nicht mehr Haustypen an die eigenen Bedürfnisse adaptiert, sondern Elemente gesammelt, die nicht primär Funktionsträger in einem umfassenden Sinn, sondern vor allem Bedeutungsträger sind: Turm, Erker, Schopfwalm, Rundbogen, Wintergarten, Biotop und so weiter. Oft stammen diese Elemente aus aufwendigeren Hauskategorien und müssen daher reduzierter und billiger ausgeführt werden. Wegen des hektischen Bedeutungswandels kultureller Moden gelingt es den Bauenden nicht mehr, das naive Flickwerk auch ästhetisch in den Griff zu bekommen, wie früher üblich, als alles noch viel langsamer ablief.
Oft missproportioniert und zusammengeschustert, verlieren solche Häuser ihren einfachen Charakter und geraten zur peinlichen Karikatur. Dies wird allerdings von jenen, die sie - wenigstens zum Teil - mit eigenen Händen erbaut haben, klarerweise nicht so gesehen. Denn schließlich haben sie sich ihre vermeintlich architektonischen Applikationen von hoch gelobten Häusern abgekupfert. Warum bleibt nun das Lob aus? Übrigens, um es der Gerechtigkeit halber zu sagen, nicht wenige studierte Architekten arbeiten auch nicht anders und sind beleidigt, wenn man sie darauf hinweist.
Der Hauptunterschied zu früher liegt jedoch darin, dass die Vorbilder heute nicht nebenan, sondern in Magazinen gefunden werden. Meist sind es auch ziemlich aufwendige Häuser, oft eigentliche Villen, wenn auch nur auf Papier. Der Typus der Villa taugt jedoch nicht als Vorbild für den normalen Hausbau, weil dieser mit dem Luxus „Raum“ viel sparsamer umgehen muss. Auch ist die Lage meist bescheidener, die Parzelle um vieles enger, das Entree bloß ein Vorraum, das Wohnzimmer bestenfalls halb so groß, das Bad winzig und und und. Dagegen sind (schein)vergoldete Armaturen und Marmorfliesen fürs Bad in jedem Baumarkt zu finden und auch bezahlbar. Auf diesem Feld tobt denn auch der individuelle Konkurrenzkampf der Häuselbauer. Zu einer vernünftigen, Fläche sparenden Grundrissorganisation und einer klugen Gesamtkonzeption kommt man allerdings mit dem aus Nahezu-Villen zusammengestoppelten Eigenheim nicht.
Wie sollen nun aber die Häuselbauer aus ihrer Situation herausfinden, wenn adäquate Vorbilder fehlen, nicht ausreichend bekannt gemacht oder nicht angemessen, in einer verständlichen Sprache, erläutert und gewürdigt werden? Bis heute ist es unter Architekten beliebt, sich über den begehbaren Fertighäusermarkt der Blauen Lagune zu mokieren, aber als Methode liegt sie richtig.
Erinnern wir uns kurz an historische Versuche, an die Modellsiedlungen, die um 1930 auf Initiative der Werkbundbewegung entstanden. Da die sozialen Ziele der Propagierung der formalen Innovation einer neuen Architekturauffassung untergeordnet blieben und zudem oft deren Kostenrahmen sprengten, fanden sie nicht zu den eigentlichen Adressaten. Der Fortschritt im äußeren Erscheinungsbild war einfach zu groß, bei aller Qualität, die da und dort im Inneren zu finden gewesen wäre.
Mit dem Verlust der Vorbilder, verschärft noch durch Veränderungen der gesellschaftlichen Strukturen stellen sich heute entwerferische Probleme, die erst neu bearbeitet, in der Praxis erprobt und dann vermittelt werden müssen. Entsprechende Musterbauten sollten besichtigbar, begreifbar und 1:1 nachvollziehbar sein, nicht bloß in Form schöner Bilder vorliegen. Wenn aber für derartige Aufgaben nach Architekten gerufen wird - und als Neuentwicklungen wären sie eine klassische Architektenaufgabe -, bleibt vorausgesetzt, dass auf die Aufgabe bezogen und hart an der Realität gearbeitet wird. Das heißt vor allem, dass der Rahmen des Möglichen gewahrt und dass das typologisch Wesentliche klar vor dem Modischen rangiert.
Beispiele in Vorarlberg, wo nicht wenige Architekten mehrere Dutzend Einfamilienhausplanungen vorweisen können, zeigen, dass nicht jedes Mal alles neu erfunden werden muss. „Nicht der Rede wert“, sagen sie oft. Warum? Weil sie einen selbstverständlichen, unauffälligen und alltagstauglichen Standard gezeichnet haben, der in einigen wesentlichen Punkten, was Lage und spezielle Bedürfnisse betrifft, unkompliziert modifiziert wurde. Dieser Standard ist ohne viel Aufhebens von den Handwerkern baubar und für die Baufamilie oder den Auftraggeber auch bezahlbar.
Es ist jedoch wenig sinnvoll, den Häuselbauern bloß zu raten, sich doch einen Architekten zu nehmen, wenn nicht zuvor „vertrauensbildende Maßnahmen“ gesetzt werden. Etwa in Form einfacher und doch hochwertiger Mustersiedlungen zum Anschauen und Angreifen; aber auch seitens der Architekten, indem sie die Bauherreninteressen nicht ihrer Gier nach einem „publizierbaren Bau“ unterordnen.
Ein Dach mit zeichenhafter Kraft, ein Damm als Element der räumlichen Struktur. Ansonsten Klarheit und kluge Angemessenheit. Der Bahnhof von Baden bei Wien nach dem Umbau.
Schnurgerade zieht die Südbahn ihre Linie von Nordost nach Südwest durch das Badener Stadtgebiet. Im flachen Vorfeld des Helenentals verläuft die Trasse auf einem Damm. Denn die ersten Bahningenieure suchten jeden unnötigen Höhenunterschied, der kräftezehrende Steigungen zur Folge gehabt hätte, zu vermeiden. So bildet der Bahndamm ein unübersehbares Element der Stadtstruktur in den Erweiterungsgebieten des 19. und 20. Jahrhunderts. Nun könnte man meinen, der Damm trenne das Stadtgebiet. Das ist jedoch weniger der Fall, als wenn die Trasse zu ebener Erde verlaufen würde, wie ein Blick nach Wiener Neustadt beweist. Denn die Hochlage der Bahn erlaubt zahlreiche Durchstiche durch das Hindernis, so dass zwar die Blicke, nicht aber die Verkehrsbeziehungen unterbrochen werden. So schafft der Damm eine räumlich ordnende, aber kaum eine funktionale Trennung.
Die zum historischen Stadtkern periphere Lage des Bahnhofs veränderte das Stadtgefüge in den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten. Auf der Stadtseite befand sich das repräsentative dreigeschoßige Aufnahmegebäude mit den Servicestellen für den Bahnbetrieb sowie Büros und Dienstwohnungen in den oberen Geschoßen. Mit dem Wandel der Rolle der Eisenbahn seit dem Aufkommen des motorisierten Straßenverkehrs sowie den neuerlichen Veränderungen im Zuge einer Intensivierung des Pendlerverkehrs im Großraum Wien sank die Bedeutung der Bahnhöfe in der Hierarchie gesellschaftlicher Wertvorstellungen.
Zwischenzeitlich glaubte man, an den entsprechenden Stellen vom urbanen Potenzial eines Bahnhofs prinzipiell profitieren zu können, und plante, diese Orte hoher Personenfrequenz zu Einkaufszentren aufzurüsten. Dies erwies sich jedoch nur für zentrale, in hoch verdichteter urbaner Lage befindliche Anlagen als sinnvoll, während kleinere Bahnhöfe, mangels längeren Aufenthalts der stets in Eile befindlichen Pendler, zu möglichst rational organisierten Stationen umfunktioniert werden müssen, selbst wenn beziehungsweise gerade wenn sie als regionale Umsteigeknoten von Bahn auf Bus und umgekehrt dienen.
Allerdings bedeutet dies eine Reduktion der erforderlichen Baumasse, wodurch die stadträumliche Präsenz sowie auch die mögliche Rolle im urbanen Gemenge abgebaut und zurückgestuft werden. Bei Erneuerungen oder Neuplanungen stehen die Architekten daher vor der Aufgabe, mangels möglicher Masse mit viel subtileren Mitteln städtebauliche Signifikanz zu erzeugen. Gerade dafür erweist sich die Hochlage der Bahntrasse in Baden als Vorteil. Denn als übergeordnetes stadträumliches Strukturelement ist der Damm, teils mit Mauern, welche die Böschungen befestigen, bereits vorhanden. Es galt daher, den Ort aufzuzeigen, wo der Austausch zwischen den Verkehrssystemen stattfindet. Natürlich ist dieser bereits durch die darauf ausgerichtete Stadtstruktur und die Tradition vorgegeben. Dennoch war es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Das ist dem Wiener Architektenteam Dieter Henke und Marta Schreieck in doppelter Hinsicht gelungen. Einerseits mit einer nichts zu wünschen übrig lassenden Klarheit, andererseits mit kluger Angemessenheit im Umgang mit dem Vorhandenen.
Als von weitem erkennbares Zeichen dient das Dach, das in Form zweier flacher Paneele über dem Bahndamm zu schweben scheint. Weit auskragend, beschirmt es die Eingänge, so dass keinerlei Zusatzelemente wie etwa kleine Vordächer vonnöten sind, welche die Wirkung des großen Daches schwächen würden. Bei Eintreten der Dämmerung wird dessen Unterseite angestrahlt, so dass der leuchtende Schirm auch bei Dunkelheit seine zeichenhafte Kraft bewahrt.
Der Damm ist platzseitig mit einer Mauer befestigt und weist damit eine Fassade auf. Rechter Hand ist es eine aus Naturstein gemauerte Reihe eleganter Korbbögen, deren Bogenfelder teils mit Mauerwerk verblendet, in Stationsnähe jedoch für kleine Geschäfte geöffnet sind. Damit wird sowohl dem städtebaulichen Element des Dammes als auch dem historischen Bestand Rechnung getragen, und beides in die Neukonzeption selbstverständlich integriert. Das Bahnreisezentrum, ein Kiosk, ein Laden mit Backwaren für Reiseverpflegung, einige Automaten und die Toiletten finden im Volumen des Bahndamms ihren Platz. Zu beiden Seiten sind zahlreiche gedeckte Abstellplätze für Fahrräder neu errichtet worden, damit jene Pendler aus dem Nahbereich, die mit dem Fahrrad kommen, auch bei zwischenzeitlichem Regen mit einem trockenen Sattel rechnen dürfen. Für jene, die mit dem Auto zur Station fahren, steht auf der Leesdorfer Seite schon länger ein Parkdeck zur Verfügung. Über eine Brücke gelangt man direkt zum südlichen Bahnsteig.
Die kurz gehaltenen Erschließungswege der Bahnreisenden - der Bahnhof Baden weist eine hohe Benützerfrequenz auf - werden mit einer Glasmembran vor Wind und Schlagregen geschützt. Sie folgt der Rechteckform des Daches und hängt vor der sowohl statisch als auch gestalterisch minimierten Fassadenkonstruktion. Keinerlei Hinterspannungen oder verspielt gestylte Befestigungselemente stören die architektonische Wirkung: Da sind die schlanken Dachstützen, deren kräftige Querschnitte Dachgewicht und Windlasten aufnehmen, ohne dass sie mit ihrer Leistung protzen müssten. Visuell treten sie ebenso zurück wie die horizontalen Sprossen, deren liegende Rechteckquerschnitte in der Mitte von Zugstäben gehalten werden, die erst beim zweiten Hinschauen überhaupt auffallen.
Die Hauptwirkung der Glasmembran liegt jedoch in ihrem Aufbau aus einfachen Scheiben. Im Gegensatz zu den heute für klimatisierte Räume üblichen und notwendigen Isolierverglasungen, die mit vier Reflexionsebenen weniger durchsichtig sind, weist eine einzige Scheibe bloß deren zwei auf. Sie ist daher transparenter und ermöglicht besser als Erstere die Realisierung des klassisch modernen Traumes, den Raum optisch durchfließen zu lassen. Eben das gelingt den Architekten am Stationsgebäude von Baden, indem sie davon profitieren, dass die Halle nicht beheizt wird. Die Warteräume auf Bahnsteigebene sind in den Glasmembrankörper integriert, so dass auch sie die klare Gesamtwirkung nicht beeinträchtigen. Insgesamt ist die Körperhaftigkeit des gläsernen Witterungsschutzes zurückgenommen, so dass vor allem das Dach stark hervortritt und zur Wirkung kommt.
Die alte Unterführung war eng und unattraktiv. Die Erweiterung in Breite und Höhe veränderte den Charakter von einem Durchschlupf in einen Durchgangs- und Aufenthaltsraum. Ein Lichthof, der auf der Leesdorfer Seite in den Bahndamm eingeschnitten ist, unterbricht den Längsraum, korrespondiert mit dem Treppenaufgang zum Bahnsteig der nach Süden fahrenden Züge und wertet den Durchgangsraum architektonisch auf. Der im Hof gepflanzte Baum bildet einen weiteren Akzent.
Mit den architektonischen Maßnahmen gelingt es überraschend gut, trotz fehlender Masse der Bahnstation mit einer unspektakulären Formensprache jene Monumentalität zu verleihen, die ihr städtebaulich und funktional heute zusteht.
Die Bauherren zufrieden, der Kostenrahmen eingehalten - und überdies: städtebaulich, konzeptionell und architektonisch geglückt. Zwei Beispiele zeitgenössischen Architektenhandwerks in Niederösterreich.
Bei den medial aufbereiteten und oft gezeigten Beispielen publizierter Architektur handelt es sich immer um eine selektive Auswahl. Zum einen, weil viel mehr gebaut wird, als publiziert werden kann, zum anderen aber auch, weil eine bloß sorgfältig gemachte Architektenarbeit nicht ausreichend attraktiv ist, als dass sich ein Kritiker oder eine Kritikerin, die ja vom Glanz des publizierten Werks auch ein wenig abbekommen möchten, damit befassen. Es sind daher vor allem Arbeiten der medial bevorzugten „Stars“ oder formal sensationelle Projekte von Newcomern, als deren Entdecker sich Kritiker ebenfalls gern sehen, die besprochen werden. Ebenfalls beliebt sind Einfamilienhäuser, weil sie ein breites Publikum ansprechen, sowie - als wohlfeile Negativbeispiele - die Arbeiten der Häuselbauer, weil deren Geschmack oft genug verwirrt ist und sich ziemlich ungleichzeitig zum gerade gültigen und publizierten bewegt.
Architekten, die ihr Handwerk differenziert und sorgfältig, aber ohne Hang zu Sensationalismen betreiben, müssen sich denn auch von „Star“-Kollegen womöglich als „Häuselbauer“ abqualifizieren lassen, auch wenn ihre Arbeit für das Erscheinungsbild der Masse des Gebauten wichtiger ist als all die missverstandenen Kopien medial bekannter Bauten oder als die missglückten Arbeiten von Stars, die eher verschwiegen werden. Es sei denn, sie werden von Claqueuren und Nebelmachern so lange hoch gelobt, bis auch die Letzten begriffen haben, dass hier ein Misserfolg kaschiert werden soll.
Für Kritiker ist es daher erholsam, sich mit Bauten zu befassen, die alltägliches zeitgenössisches Architektenhandwerk repräsentieren, die die Bedürfnisse der Bauherrschaft erfüllen, den Kostenrahmen nicht überschreiten und dennoch städtebaulich, konzeptionell und architektonisch geglückt sind. Dies betrifft oft Sanierungen, Erneuerungen und Erweiterungen von Gebäuden aus Phasen intensiver Bautätigkeit, etwa der Gründerzeit oder der 1960er- und 1970er-Jahre, wie sie heute anstehen. Unsere beiden Beispiele stehen stellvertretend für andere, und der verantwortliche Architekt, Johannes Zieser, ist kein einsamer Vertreter seines Berufsstandes. Es gibt ausreichend gleich Gesinnte.
Die Gemeinde Würmla liegt an der Straße Richtung Tulln zwischen Böheimkirchen und Michelhausen. Das wahrscheinlich einzige besondere Bauwerk im Dorf ist das gründerzeitliche Schloss, das im Vergleich mit Schönbrunn natürlich im Erdboden versinken würde. Aber in Würmla ist Schönbrunn weit weg, und das Schloss - in einem Park mit alten Bäumen gelegen - wird zum architektonischen Angelpunkt. Jahrzehntelang vernachlässigt, waren seine Mauern durchfeuchtet, das Dach war undicht und der Park verwildert. Für einen privaten Käufer gab das Gebäude zu wenig her, und für eine öffentliche Nutzung des gesamten Hauses ist die Gemeinde zu klein. Den Niedergang beendete ein Konzept, das im Erdgeschoß unter anderem das Gemeindeamt und die Mediathek vorsah, im Obergeschoß den Einbau von Wohnungen. Aber auch dafür musste ein Investor gefunden werden, was mit der gemeinnützigen Genossenschaft Alpenland gelang.
Die geräumige Eingangshalle und das repräsentative Treppenhaus dienen heute beiden Nutzergruppen. Die wenigen, in ihrer Qualität erhaltenen Räume im Erdgeschoß boten für das Bürgermeisterzimmer und den Ratsaal einen würdigen Rahmen, auch wenn von den Stuckdecken bloß eine gerettet werden konnte. Dafür wertet der eine oder andere Kachelofen mit seiner Präsenz jeweils einen Raum auf. Das Äußere des Schlosses wurde nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten hergerichtet und der vollkommen zugewachsene Park ausgelichtet, sodass das freundlich-helle Gebäude nun in einem Hain hoher Bäume steht, wodurch die bescheidene Anlage aufgewertet wird. Die größten Eingriffe erfolgten im Obergeschoß, wobei es sich als Chance erwies, dass die Dippelbaumdecken verrottet waren und ersetzt werden mussten, weil die neue Stahlbetondecke einige Zentimeter höher gesetzt werden konnte, sodass in der Mittelzone eine Galerie eingezogen und die Wohnfläche vergrößert werden konnte.
Die hohen Fenster des Piano nobile lassen genügend Licht herein, dass auch die oberen Raumzonen nicht düster wirken. Unter der Galerie befinden sich Sanitär- und Abstellräume, die niedriger als die Wohnräume sein dürfen. Die zwölf Wohnungen zu zwei und drei Zimmern mit der meist als zusätzliche Wohnzone genutzten Galerie haben alle Abnehmer gefunden.
Beim Bundesschulzentrum für wirtschaftliche Berufe in Horn galt es, einen Bestand aus den 1970er-Jahren zu erweitern und überdies wärmetechnisch zu sanieren. Der zweiflügelige Erweiterungsbau setzt in der Mittelachse an der Rückseite des Bestandes an. Als räumliches Gelenk wirken die alte Treppe und, an diese anschließend, im Erd- sowie im ersten Obergeschoß eine großzügige Halle. Die beiden Flügel mit Klassenzimmern sind vom Altbau geringfügig weggeschwenkt, was sich noch an der Rückseite an der leicht polygonal eingezogenen Fassade abbildet. Städtebaulich nimmt der Baukörper in unaufgeregter Weise sowohl mit dem Bestand, an den er angebaut ist, als auch mit der rückwärtigen Nachbarschaft der Volksschule einen entspannten Dialog auf und führt das angelegte Konzept weiter. Sein zeitgenössischer Charakter realisiert sich auf der architektonischen Ebene: Die Treppen in den Flügeln liegen in lichtdurchfluteten Ganghallen. Eine farbige Folie im Verbundsicherheitsglas der Geländer bietet sowohl Transparenz als auch Differenz zur verglasten Fassade davor.
Neue Wandelemente im Altbau erhielten eine am Computer verfremdete Gestaltung durch die Künstlerin Elisabeth Handl, deren Ausgangsmotive Schülerfotos waren. Die Flächen in Orangetönen beleben die Stimmung in den Ganghallen und relativieren den ehemals nüchternen Charakter. Die alte Treppe mit ihren Sichtbetonwangen und Brüstungsauflagen aus dunklem Holz wurde original bewahrt. Sie zeugt von der Zeit, da ein Stiegenaufgang - auch in sparsamen Jahren - als architektonisch-räumliche Inszenierung aufgefasst wurde, dem mit beschränkten Mitteln Ausdruck verliehen wurde. Es ist nicht zuletzt das Verdienst von Johannes Zieser, diese zurückhaltende Qualität erfasst und im originalen Charakter in das erneuerte Konzept überführt zu haben. Denn bei dieser Sanierung und Erweiterung ging es nicht darum, dem qualitativ durchschnittlichen Bestand in demütigender Weise eine gegensätzliche Gestaltung überzustülpen, sondern darum, positive Elemente der Grundriss- und Raumstruktur aufzunehmen und mit eigenständigen, aber nicht konträren Elementen zu einem neuen Ganzen zu verbinden.
Das ist weder ein falsches Amalgamieren als Folge unklaren Denkens noch ein billig zu habendes, scheinradikales Schwelgen in hochgespielten Gegensätzen. Es ist viel schwieriger, weil sowohl im Erkennen als auch beim Entwerfen Sensibilität und - ja, auch Demut vor dem Vorhandenen gefordert sind, ohne dass dabei das Gesamtkonzept aus den Augen gelassen wird.
„Wer sich in Kolorit und Milieu einer Stadt einfühlt, Zufälle und Patina thematisiert, der mag Denkmalpflege und Museen nicht.“ Miroslav Sik, Architekt und Theoretiker. Ein Porträt.
Eine der großen Schwächen der Neomoderne - die auf die „Postmoderne“ folgte - ist die Neigung zahlreicher Exponenten, immer wieder das Kind mit dem Bade auszuschütten, indem sie - ahistorisch, wie sie sind - das Vorhandene verdrängen oder ablehnen und unter verbalradikalen Trompetenstößen vom unerledigten Heute in eine von subjektiven Hoffnungen und Wünschen verengte „Zukunft“ flüchten, von der sie nicht wirklich eine Ahnung haben.
Das gilt sowohl für nicht wenige Architekten als auch für ihre eifrigen Propagandisten in den Medien. Offensichtlich unfähig, eigene, von der Sache ausgehende Gedanken zu entwickeln, folgen sie diesem oder jenem medial aufgebauschten formalistischen Trend und verlieren dabei die Bodenhaftung, weil sie meinen, sich nicht mehr mit dem konkreten städtebaulichen Kontext auseinander setzen zu müssen. Und sie schwätzen in oberflächlicher Weise von amerikanischen oder asiatischen Stadtvorbildern, die angeblich die Zukunft für die europäische Stadt darstellen. De facto auf das eigene Objekt fixiert, verbreiten sie publizistischen Nebel, um in dessen Schutz ihre Fremdanleihen einzubringen. Dabei verkennen sie sowohl die strukturelle Vielfalt als auch die oft Jahrtausende zurückreichenden historischen Wurzeln der europäischen Städte und ihre je spezifischen Entwicklungen, die jeder Stadt ihren individuellen Charakter eingeschrieben haben. Wird dies beim Arbeiten an der Stadt nicht berücksichtigt, sondern verdrängt, werden die daraus resultierenden Bauten jahrzehntelang Fremdkörper bleiben, bis sie wieder verschwunden sind, gestalterisch überformt oder von der Vitalität der Stadt schlicht assimiliert worden sind.
Das Instrumentarium zur Analyse des individuellen Charakters europäischer Städte wurde von italienischen Städtebautheoretikern in Rom, von Saverio Muratori und anderen, begründet und in der Folge effektvoller von Aldo Rossi verbreitet. Ihr typologisch-morphologischer Ansatz der Analyse erlaubte ein kontextuelles Projektieren, vernachlässigte jedoch die Berücksichtigung von Nebenwirkungen in der Feinstruktur, so dass formalistische Implantate nicht ausblieben.
An diesem Punkt setzen Theorie und Praxis des tschechisch-schweizerischen Architekten und Architekturlehrers Miroslav Sik an. Während sich die meisten Städtebauhistoriker auf die geschichtlichen Zentren beschränkten, richtete er seinen Blick frühzeitig auch auf vorstädtische Gebiete, in denen seit dem 19. Jahrhundert Wohnanlagen, Gewerbe- und kleinere Industriebetriebe, Dienstleistungsinfrastrukturen sowie Verkehrsbauten in dichter Mischung ein spezifisches Ambiente entwickelten. Sik, der sich selbst als Traditionalist bezeichnet, analysiert die Orte für seine Bauwerke bis in die Feinheiten lokaler Stimmungen, die von Farben, Nutzungsambiente, lokalen Stilmischungen bis hin zu einzelnen Bäumen reichen. Seine Interventionen sind zurückhaltend und streben die Stärkung vorhandener Ensemblewirkung an. Obwohl wortgewaltig und profiliert in seiner oft an Loos gemahnenden Diktion - „Das Stadtgesicht deines Gebäudes ist nicht deine Privatsache“ -, sind seine Entwürfe und Bauwerke verbindlich in der Haltung. Siks kurzer Text „Traditionell poetisch“ von 1995 (zu finden in seinem Buch „Altneue Gdanken. Texte und Gespräche 1987 - 2001“, Quart Verlag, Luzern) gibt sein Verhältnis zur europäischen Stadt konzentriert wieder, weshalb er hier zur Gänze zitiert werden soll:
"Die Stadt in ihrer Alltäglichkeit zu bewahren und ihr zugleich durch minimale Eingriffe Poetisches zu entlocken ist wohl das einzige Prinzip des Traditionalismus. Es tönt einfach: integriere und verfremde, Genius Loci und abgeleitete Imagination, Stadt als Vollendetes und ihr lokaler und empirischer Umbau. Nichts Großmaßstäbliches, Radikales und Avantgardistisches, keine Nostalgie und Importe. Es tönt einfach, ist jedoch das Allerschwierigste.
Die Stadt als Überlieferung zu bewahren verknotet uns mit älteren Generationen, ihren Träumen und Gewohnheiten, mit Wunder- und Widerlichkeit. Diesem Gegebenen verweigert der metropolitane Neomodernist Respekt und Verantwortung und zelebriert, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die Stunde zero. Seinem Neuanfang folgt der nächste, bis sich alles in Kontraste und Fragmente verwandelt. Wohl wachsen sie eines Tages wieder zum Ensemble zusammen, doch führt dorthin ein langer und schmerzhafter Weg. Die Alten sagten ,ordo amoris' und meinten damit die sanfte Einfühlung.
Die Stadt als Multiversum zu bewahren erfordert ein pluralistisches Gemüt. Heimat ist überall, im historischen Stadtkern, auf den Paradeboulevards des 19. Jahrhunderts, in der technischen und Schrebergarten-Peripherie, in der Satelliten-Utopie der 60er-Jahre. Romantisch und aufklärerisch strahlte die Heimat Stolz, Schönheit und Harmonie aus. Unsere Heimat ist grau und steif, zugleich bunt und motivierend, Tristesse und Action. Komposition gehört ihr an wie Chaos und Monotonie. Traditionalismus ist kein Stil, sondern ein Weg der Analogien.
Wer die Stadt traditionalistisch, sprich interpretierend, bewahrt, sich in Kolorit und Milieu einfühlt, Zufälle und Patina thematisiert, der mag Denkmalpflege und Museen nicht. Gewohnheiten und Traditionen werden bewahrt, indem man sie lebt, bewusst um sie kämpft, sie mit Nonkonformen schmilzt und ihnen eine gute Portion Spannung beimischt."
Als gebautes Beispiel sei das Musikerwohnheim genannt, eine Wohnanlage an der Zürcher Bienenstraße. Vis à vis steht eine Halle der Verkehrsbetriebe, und wenige Schritte westlich befindet sich das Letzgrund-Stadion, insgesamt eine spannende urbane Mischung. Drei kurze Trakte sind im Norden über zwei Stiegenhäuser zusammengekoppelt, von denen die akustisch gedämmten Übungsräume direkt zugänglich sind. Davor liegen südorientiert zu den beiden Höfen je zwei Loggien, über die der Zugang zu den eigentlichen Wohnungen erfolgt. Damit ist eine komplexe Benutzung möglich, weil die Übungsräume unabhängig sind - man muss als Musiker gar nicht im Haus selbst wohnen. Andererseits bietet die Loggia einen in seiner Art fast ländlich anmutenden Pufferbereich vor der eigentlichen Wohnung.
Miroslav Sik, der 1968 mit seiner Familie in die Schweiz emigrieren musste, lehrte seit den 80er-Jahren an den Technischen Hochschulen von Zürich, Lausanne und Prag. Seit 1998 ist er ordentlicher Professor an der ETH in Zürich.
Die 1931 in Hamburg gegründete Alfred-Toepfer-Stiftung, die sich für europäische Einigung und die Integration mittel- und osteuropäischer Länder und die Schwerpunkte Kultur und Wissenschaft, Naturschutz und Jugend einsetzt, vergibt seit 1963 die Heinrich-Tessenow-Medaille in Gold. Ausgezeichnet wurden bisher unter anderem die Architekten Sverre Fehn, Juan Navarro Baldeweg, David Chipperfield, Heinz Tesar, Edouardo Souto de Moura und Peter Märkli. Heuer ist es Miroslav Sik, der für seine Verdienste für eine „qualitätsvolle Weiterentwicklung der historisch gewachsenen europäischen Stadt“ gewürdigt wird.
Warum wird das Innere eines Indianerzeltes bei Regen nicht nass? Warum hat der Athener Parthenon zwei verschiedene Säulenordnungen? Ein Plädoyer für offene Augen beim Studium der Architekturgeschichte.
Soll man sich das als junger Architekturstudent antun: die Stilgeschichte von den Ägyptern bis zu Historismus und Jugendstil zu büffeln, Bauwerke, Namen von Baumeistern und Architekten und immer wieder Jahrzahlen auswendig lernen? Wozu soll das gut sein? Diese Frage darf getrost gestellt werden, wenn Architekturgeschichte wie Rechnen unterrichtet und geprüft wird - nichts gegen Kopfrechnen! - und daher auch daraufhin gelernt wird: ein Name, eine Jahreszahl; ein Name, eine Jahreszahl und so weiter. Kann denn Architekturgeschichte nicht mehr bieten als hohle Gelehrsamkeit? Natürlich könnte sie das, allerdings ist dies mit Verlust an Bequemlichkeit verbunden, sowohl für Lernende als auch für Lehrende. Wenn man sich nämlich die Frage stellt, was architektonisch vorliegt, lassen sich völlig andere und vor allem nachhaltigere Erkenntnisse gewinnen.
Mit zwei ausgewählten Beispielen soll das mögliche Feld skizziert werden, auf dem sich eine auch heute noch ertragreiche Architekturgeschichte bewegen kann. Denken wir uns in ein Kegelzelt der Ureinwohner Nordamerikas in den Plains, wo einst Millionen Bisons grasten. Die sorgfältige Zeichnung des Ethnografen Frederic Weygold stammt aus dem 19. Jahrhundert, bezüglich Geräte und Waffen ist die Steinzeit bereits vorbei - aber die Behausung, ursprünglich für den Sommer, die Zeit der Büffeljagd, vorgesehen, versammelt Jahrhunderte praktischer Erfahrung. Den Berichten von 1832 von Maximilian Prinz zu Wied dürfen wir entnehmen, dass die Zeltmembran dünn wie Pergament geschabt war und das Licht durchscheinen ließ. Auf der Zeichnung erkennen wir vor dem primären Holzgerüst eine Art Vorhang, der an den Zeltstangen angehängt ist. Die Befestigung erfolgt jedoch nicht direkt, sondern über eine umlaufende Leine, die jeweils von oben her einmal um die Zeltstangen geschlungen ist. Der Ledervorhang hängt dazwischen mit Schlaufen an der Leine.
Was wir nicht sehen, aber wissen dürfen, ist, dass die Zeltstangen oben über den Kegel hinausragen. Wenn es regnet, dringt an der als Rauchloch dienenden Kegelspitze Wasser ein und rinnt an der Unterseite der Stangen ins Zelt. An der umgeschlungenen Leine würde es etwas aufgehalten und bald heruntertropfen. Die ethnografischen Quellen berichten, dass an dieser Stelle zwei Holzspäne solcherart unter die Leine geklemmt wurden, dass das Wasser kapillar angezogen, zum Stangenfuß weitergeleitet und an den Zeltrand geführt wurde. Dieses Detail ist bloß eines von vielen, die an der über Jahrhunderte und Generationen mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln perfektionierten Zeltkonstruktion zu finden sind. Es handelt sich um eine beispielhafte Annäherung von Nutzeffekt und formaler Durchbildung.
Die verdichtete Erfahrung von Generationen manifestiert sich ebenso im wiederkehrenden Strukturprinzip des Dreibeins, ob für die Primärstruktur des Zeltes, die Rückenstützen oder das Gestell des Kochkessels, der den Bisonmagen abgelöst hat, in dem wenige Jahrzehnte zuvor noch mit erhitzten Steinen gekocht wurde. Und alles war leicht und unkompliziert transportfähig! In ungestörten Gesellschaften entstanden auf diese oder ähnliche Weise in einem kollektiven Prozess jene komplexen Zusammenhänge, die wir bis heute als Architektur wahrnehmen. Indem wir ihre Prinzipien erkennen, begreifen wir die Zeitlosigkeit architektonischer Wirkung. Und ihre Durchdringung bis in die kleinsten Details kann uns Heutigen zwar nicht materiell, aber ideell von Nutzen sein.
Nächstes Beispiel: Der Parthenon auf der Athener Akropolis gilt als jener Tempel, an dem die klassischen Prinzipien am perfektesten ausgearbeitet wurden. Das mit dorischer Säulenordnung versehene Bauwerk erlaubt daher einen genussvollen Nachvollzug dessen, was wir heute unter Klassizität verstehen. Die dorische Ordnung gilt als die ursprünglichere, direktere Umsetzung des Prinzips „Tragen und Lasten“. Es wurde ihr - im Gegensatz zur ionischen Ordnung - das männliche Prinzip zugeschrieben, das für Tempel männlicher Gottheiten Anwendung fand. Doch bereits hier sollten wir skeptisch werden, denn der Parthenon ist der Athene Parthenos gewidmet, die nach der Sage in voller Rüstung dem von Schmerz gepeinigten Haupt des Zeus entstieg.
Wenn wir uns nun aber auf die primäre architektonische Ebene begeben und eine dorische Säule näher anschauen, ist es vor allem die flache Kannelur mit scharfen Graten, welche die Oberfläche des Schaftes bestimmt. Im haptischen Zugriff erweist sie sich als eher schroff. Der allseitigen Offenheit des Säulenumgangs steht somit die distanzierende Wirkung der Oberfläche des Säulenschafts entgegen. Diese Spannung gegensätzlicher architektonischer Wirkungen lohnt bereits das nähere Eingehen auf die attraktive Ruine. Doch es gibt mehr zu entdecken: Im westlichen Teil der Cella, der mit dem östlichen, wo das Standbild der Athene stand, keine Verbindung hat, stehen im Geviert vier Säulen, welche die Decke tragen. Überraschenderweise folgen sie jedoch nicht der dorischen Säulenordnung, sondern der ionischen. Wie das? Ein derartiger Stilbruch am perfektesten Tempel des klassischen Altertums wird kaum einfach „passiert“ sein. Wir dürfen daher architektonische Absicht vermuten. Die ort- und zeitgleiche Anwendung beider Säulenordnungen mag schnell Urteilenden als „Protopostmoderne“ erscheinen, das Phänomen wäre provokant benannt, einige Lacher hätte man eingeheimst - aber sind wir damit dem Wesen der Sache näher gekommen? Nein.
Befassen wir uns daher mit der Oberflächenbeschaffenheit der ionischen Säulenschäfte: Sie weisen ebenfalls Kanneluren auf, doch sind sie schmaler und tiefer. Vor allem aber trennt ein leistenartiger Steg die vertikalen Rinnen, sodass das Rund der Säule stärker zum Ausdruck kommt. Sie wirkt weniger abweisend, mithin weniger raumverdrängend als eine Säule mit dorischer Kannelur. Hier dürfte der Schlüssel für ein Verstehen der vier andersartigen Säulen liegen: Dorische Säulen hätten stärker raumfordernd und objekthafter gewirkt. Der Raum wäre zurückgedrängt worden. Die annäherungsfreundlichere Kannelur der ionischen Säulen nimmt die mitten im Raum stehenden stützenden Elemente zurück, um den Raum aufzuwerten. Auch hier wurde eine ausgewogene Spannung gegensätzlicher architektonischer Momente angestrebt.
Einmal sensibel geworden, wird man bald merken, dass auch bei den Propyläen, dem Torbauwerk zur Akropolis, die inneren, den Torweg flankierenden Säulen der ionischen Ordnung folgen, während außen die dorische gilt. Nun dürfen wir annehmen, dass das Nebeneinander beider Ordnungen weder historische noch stilistische Gründe hat, sondern schlicht architektonischen Wirkungen gehorcht. Vitruv, der ein halbes Jahrtausend nach Errichtung des Parthenon Stile und Entwicklung erläuterte, hat Textgläubige auf eine zumindest denkwürdige Fährte gelockt. Das authentisch-architektonische Wesen eines Sachverhalts ist in den Bauwerken selbst zu suchen. Ihr Nachvollzug hilft, den Blick zu schärfen für ähnliche oder auch ganz andere architektonische Phänomene, die dann beim Entwerfen das Verständnis für ein Arbeiten mit komplexen Zusammenhängen zu einem lustvollen Prozess werden lassen, im Gegensatz zur Exekution modischer Stilelemente mit platter, auf vordergründige Effekte zielender Aussage.
Dabei ist es relativ unerheblich, an welchen Bauwerken und an welcher Epoche wir den differenzierenden Blick schulen, die Geschichte der Architektur ist so reich, dass wir nie an ein Ende gelangen.
Den Nebelwerfern, Claqueuren und dem Starkult zum Trotz: Nur das reale Bauwerk ist Architektur. Die bloße Zeichnung bleibt Projekt. Das Metier braucht mehr als schöne Bilder.
Eine Überbetonung äußerlich-for malistischer Aspekte, die Ein schränkung auf zweidimensio nale Bilder meist glatter Oberflächen sowie unkritische, sprachlich holperige Lobeshymnen kennzeichnen in jüngster Zeit die mediale Kommunikation von Gebautem. Besonders avanciert sich wähnende Auguren konstatieren einen Trend zu reinen Bildmedien und verabschieden sich vorauseilend von einer sprachlichen Auseinandersetzung mit Architektur. In der Not fachlicher Inkompetenz greifen die Schreiber zu populistischen Metaphern, die bei näherer Analyse des architektonischen Kontextes nicht standhalten. Kürzlich tauchte in einem Bericht über das geplante Stadion in Beijing von Herzog & de Meuron die Bezeichnung „Vogelnest“ auf. Mit seiner strukturell und maßstäblich falschen Metapher demonstriert der Schreiber sein eigenes Unverständnis architektonischer Zusammenhänge.
Mag sein, dass im Bürojargon, vor dem Modell 1:500, solche Übernamen - von mir aus sogar „liebevoll“ - in Gebrauch sind. Für das Raumgefühl im bewusst astatisch wirkenden Tragsystem im Maßstab 1:1 mit seinen mächtigen, sich wild kreuzenden Kastenträgern aus Stahl helfen solche populistischen Anbiederungen nicht weiter; viel schlimmer, sie leiten in die Irre. Denn methodisch Entwerfenden dient ein Modell als Kontrollmedium der Vorstellung des Projekts vor dem inneren Auge in wahrer Größe, andernfalls stolpern sie leicht über die Strukturformel, die besagt, dass ein Großteil der Parameter beim Vergrößern nicht linear, sondern mit der zweiten und dritten Potenz wächst. Es sind daher sprachliche Bilder zu finden, die sich nicht am Modell auf dem Tisch, sondern am realen architektonischen Konzept orientieren
Zwar gilt vordergründig als allgemeiner Konsens, dass Architektur nur in Kenntnis des Originals beurteilbar sei. Die Vernebelungsagenturen des Stararchitektenkults forcieren jedoch das Gegenteil. Indem sie isolierte und geschönte Bilder publizieren, versuchen sie Ansichten bereits vor einem Besuch an Ort und Stelle zu fixieren, eifrig bestrebt, deren unkritische Bestätigung zu provozieren. Und nicht wenige der solcherart gehuldigten Architekten verlieren die Bodenhaftung, schwimmen oben auf der Welle mit und geben unverständliches Geraune von sich, das mit ihren Bauten und Projekten wenig zu tun hat. Dazu ist zu sagen: Nur das real vollendete Bauwerk ist Architektur. Gezeichnetes bleibt Projekt; Geredetes bestenfalls Luftschloss.
Denn Architektur bleibt ein anspruchsvolles Komplexon, das zahlreichen Kriterien unterliegt. Vor 2000 Jahren fixierte der römische Militäringenieur Vitruv in der Hauptquelle unseres theoretischen Wissens über die Architektur der Antike, „Zehn Bücher über Architektur“, drei Kriterien: „firmitas“ (Festigkeit), „utilitas“ (Zweckmäßigkeit) und „venustas“ (Anmut). Zudem äußert er sich bereits zur Notwendigkeit der Kostenkontrolle, da der Architekt mit fremdem Geld baue. Vieles hat sich seither verändert, einiges ist erstaunlich aktuell geblieben. Die Renaissance, durch Leon Battista Alberti eingeleitet, erneuerte die Gültigkeit von Vitruvs Kriterien bis weit ins 18. Jahrhundert.
Mit dem Anbruch des bürgerlichen Zeitalters erhielt die Ökonomie wesentlich mehr Gewicht, und Jean Nicolas Louis Durand formulierte mit seinen Typologien grundrissökonomische Kriterien. Die Verwissenschaftlichung des Denkens und die zunehmenden Verluste an vertrauten Bauwerken im Zuge der Industrialisierung aktualisierten die Geschichte der eigenen Disziplin im Historismus, und mit der Entwicklung einer Theorie der Denkmalpflege durch Georg Dehio und Alois Riegl erhielten die Kriterien zur Wahrung des Kulturerbes eine moderne Grundlage. Gleichzeitig erstarrte jedoch der Historismus im billigem Eklektizismus.
Dennoch bleibt die Architekturgeschichte für das zeitgenössische Bauen eine unabdingbare Wurzel zur kritischen Selbstanalyse. Die wiederkehrenden Bestrebungen, dieses Kriterium zu umgehen oder zu verdrängen, wie dies von selbst ernannten Avantgardisten immer wieder probiert wird, sind ihrerseits zu Historismen verkommen. Denn was wegweisend sein wird, lässt sich bei einer langsamen und per se nachhaltigen Kunst wie der Architektur erst aus zeitlicher Distanz beurteilen. Das Übrige ist Kaffeesatzleserei und Wichtigmacherei.
Die soziale Komponente in der Architektur wird nicht von allen gleich gewertet. Im Interesse gesellschaftlicher Stabilität wird sie jedoch im Städte- und Wohnbau vernünftigerweise ernst genommen. Spät hat die Industrialisierung das Bauwesen erfasst, beflügelt vom Erfolg der Fordschen Fließbandproduktion von Automobilen. Die meisten Architekten verirrten sich jedoch in vordergründigen Formalismen, die oft genug zu Bauschäden führten. Das Kriterium einer optimierten Industrialisierung des Bauens ist jedoch heute unabdingbar. Die Ölkrise von 1973 verschaffte endlich der Energiefrage und der Forderung nach Nachhaltigkeit die nötige Beachtung. Und die Erneuerung historischer Stadtteile führte rasch zur Frage nach der städtebaulichen Angemessenheit der Interventionen. Alle diese Kriterien sind auch heute aktuell. Wenn sie vernachlässigt werden, kommt es zu unnötigen Reibungen im Entwurfs- und Bauprozess. Ihre Bearbeitung im Zuge der planerischen Durcharbeitung ist anpruchsvolles Architektenhandwerk und erfordert qualifizierte Berufsleute. Künstlerische Kompetenz in Bezug auf Konzeptidee, Raumstruktur, Materialwirkungen und Proportionen ist jedoch Voraussetzung.
Aber damit ist das Haus noch nicht gebaut, denn die Umsetzung der Planung in jener Qualität, die den integralen architektonischen Anspruch im späteren Bauwerk sicherstellt, erfordert eine vom Starkult in der Regel unterschlagene intensive Beteiligung von Spezialisten. Es beginnt mit der ingenieurwissenschaftlichen Komponente für das Tragwerk, die Konstruktion und die bauphysikalischen Aspekte. Dazu kommen die Leistungen der Baustoff- und Bauteilindustrie. Vieles wird heute vorgefertigt und auf der Baustelle montiert. Erst heute befinden wir uns dort, wo sich die Pioniere in den 1920er-Jahren hinträumten. Trotzdem bedingt die Bauherstellung weiterhin ein technisch versiertes zeitgenössisches Handwerk. Das „Gewusst-wie“ und eine perfekte Endfertigung sind unverzichtbar, sonst kommt es schwerlich zu Architektur.
Die organisatorisch-technische Komponente für den gesamten Ablauf, die Bauleitung, ist von zentraler Bedeutung. Nicht von ungefähr kooperieren namhafte Architekten immer wieder mit denselben spezialisierten Bauleitungsbüros. Und dabei gibt es auch eine Ästhetik schlanker, wirksamer Baubesprechungs-Protokolle!
In den vergangenen Jahrzehnten ist das Errichten architektonisch qualifizierter Bauwerke immer mehr zu einem extrem anspruchsvollen Prozess mit permanentem Mediationsbedarf geworden. Wohl hat der Architekt in manchen Ländern seine zentrale Rolle zu Gunsten der Architektur wahren können. Das Herunterspielen der Herstellungsproblematik sowie eine formalistisch orientierte Vernebelung durch Claqueure auf der medialen Ebene spalten jedoch die Ansprüche von der Wirklichkeit ab - mittelfristig zu Lasten der Architektur.
Fahrt durch das frühwinterliche Niederösterreich: über kleine Pässe, durch enge Täler, Kleinstädte und Dörfer. Und entlang der jüngsten Arbeiten engagierter Architekten. Ein Streifzug.
Fahrt durch Niederösterreich im Spätherbst: auf Land- und Nebenstraßen, mit kurzen Halten in Kleinstädten und Dörfern, zwecks Besichtigung jüngster Arbeiten verschiedener Architektinnen und Architekten. Anfangs auf morgendlich nebelfeuchter Fahrbahn durch enge Täler und über kleine Pässe im Voralpenbereich, die Talflanken bedeckt mit steilen Waldstücken, durchsetzt von Felsformationen, zwischendurch eine kleine Ansiedlung, wenn die Erweiterung des Talbodens dies zulässt, und da und dort eine Burgruine über schroffen Feldzacken.
In Scheibbs, wo der mittelalterliche Stadtkern in eine schmale Zone neben dem Fluss gezwängt ist, wurde jüngst eine Filiale von Forster Optik eingerichtet, gestaltet von Irmgard Frank und Finn Erschen. Das prominent unter einem bemalten Giebel im Stadtgefüge ruhende Haus weist mit Stein eingefasste Stichbogenarkaden aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf. Dahinter befindet sich das Optikgeschäft, das tief ins Gebäude hineinreicht. Eine kräftige Längsmauer, durch Einbauten in ihrer Dimension noch verstärkt, teilt den Schauraum vom Servicebereich. Durchgänge und ein geschützter Sitzplatz für kurze Wartezeiten lockern dieses strukturierende Element auf. Im Schauraum werden Brillengestelle auf gläsernen Tablaren vor hinterleuchteten Milchglasflächen präsentiert, oben und unten begleitet von einem breiten Band eisgrün leuchtender Scheiben. Dazu kontrastiert das warmfarbig dunkle Parkett, während frei im Raum stehende Möbel aus hellem Holz gearbeitet sind. Der edle Charakter der Einrichtung verleiht dem Angebot und der Serviceleistung der Firma einen zusätzlichen Impuls zum positiven Gesamteindruck.
Ins Alpenvorland weiten sich die Täler, und die Topografie wird weicher. Am Weg liegt Matzleinsdorf bei Melk, eine kleine Ortschaft. Die bescheidene Kirche unklaren Alters erhielt einen Vorbau, der als geräumiger Eingangsbereich dient. Hinter dem Schulhaus hervor lädt der schräg aus der gerundeten Ecke stoßende Eingang zum Eintreten. Ein breites Fenster bietet Einblick in den Sakralraum mit den schlichten Fichtenholzbänken. Richard Zeitlhuber hat den Vorbau auf beengtem Platz als zeitgenössisches Element an das kleine Kirchenschiff gefügt. Er wirkt angenehm beiläufig und dennoch freundlich offen.
In Melk befindet sich am Hauptplatz eine weitere Forster-Filiale, diesmal von Sabine Bartscherer und Ana Paula Cachola gestaltet. Auch hier galt es, das Geschäft in die Mauerstruktur eines im Kern mittelalterlichen Hauses zu komponieren. Ein mit Glas überdeckter ehemaliger Hof bringt Licht in die Tiefe des Raumes, eine in Pfeiler aufgelöste Mauer teilt wiederum die Hauptbereiche ab. Die Brillengestelle werden hier in niedrigen, dafür umso breiteren Fächern präsentiert, die unregelmäßig in der schwarzen, rahmenden Wandfläche eingeschnitten sind. Eine indirekte Beleuchtung verstärkt die Wirkung der Objekte. Der Generationsunterschied in der Ausbildung zwischen den Entwerferinnen - im Vergleich zu jenen der Filiale in Scheibbs - wird deutlich an der Schrägstellung einer Arbeitsinsel im hinteren Bereich oder an der Möblierung der Kinderecke im Obergeschoß. Dennoch passt die differenzierte Gestaltung zu den ausgestellten Produkten: zarten Brillengestellen und zerbrechlichen Augengläsern, und ebenso zur exakten Bearbeitung und Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse und -wünsche, wie dies dem hoch spezialisierten Geschäftszweig entspricht.
Durch den Dunkelsteiner Wald, dessen Name allein schon an Märchen gemahnt, führt der Weg nach Herzogenburg. Hier wurde der Platz vor der Stiftskirche teilweise neu gestaltet, aber der Bereich daneben, vor der Feuerwehr, belassen. Es handelt sich um eine gestufte Anlage: von Betonmäuerchen gerahmte Grünflächen, dazwischen eingesenkte Ruhezonen; eine in ihrer plastischen Qualität durchaus erhaltenswerte Anlage aus den 1970er-Jahren. Und auch die von geparkten Autos besetzte Hauptfläche des von Bürgerhäusern eingefassten Kirchenplatzes blieb unangetastet. (Gregor) Eichinger oder (Christian) Knechtl, die Gestalter der Zone vor der Kirche, legten eine mit quadratischen Ebenseer Zementsteinen belegte Fläche aus, die von einer frei ausbauchenden Linie begrenzt wird. Das unregelmäßige Muster der von hell- bis dunkelgrau abgestuft eingefärbten Steine erschließt sich erst aus großer Höhe, beispielsweise von den Balustraden unter dem Turmhelm. Die „Pixel“ verdichten sich zum Bild: Eine Hand scheint sich den Platzteil zu greifen, um die Zone vor der Kirche den zudringlich parkenden Autos zu entziehen: eine feinsinnig kontextuelle Arbeit.
Weiter geht es durch die Ebene nach Zwentendorf. Positive Erinnerungen steigen auf an die Jury im Verfahren zur Erweiterung der Hauptschule, umsichtig und vorbildhaft geleitet durch den tragischerweise früh verstorbenen Reinhard Medek, die das Projekt von Martin Kohlbauer auf den ersten Platz setzte. Wie hat der Gewinner die Ausführung bewältigt? Ein Gang um das Gebäude nähert Erinnerung und reales Bauwerk einander an: die gestuft vorkragenden Geschoße, der schlank aufgestelzte Körper des zweiten und dritten Obergeschoßes, die ruhige Fassade zum Park neben der Kirche, die Pausenfläche im Hofbereich auf dem Turnhallendach und die Raum lassende Behandlung des alten Baukörpers: alles vorhanden und in Gebrauch. Die städtebauliche Integration der zeitgenössischen Bauformen ist gelungen.
In Tulln ist es ein Billa-Markt von Gottfried Haselmeyer der positiv ins Auge springt. Lange Jahre waren die rotgelben Läden geprägt von hochnotpeinlichen Anbiederungsversuchen aus mit Holz getäfelten Blenden und ziegelbedeckten Scheindächern an eine vermeintlich ländliche Bauweise. Architekt Haselmeyer hat in Niederösterreich in dieser Hinsicht unbedankt härteste Pionierarbeit geleistet und die ersten selbstverständlich wirkenden Billa-Märkte in Zwettl, Grein und eben Tulln gestaltet.
Im Bogen um Wien herum, südlich von Schwechat stoße ich an der Landstraße nach Lanzendorf auf ein Firmengebäude, dessen signifikantes Dach aus regelmäßig gereihten Schichtholzträgerrn über den Gebäuden und Lagerflächen zu schweben scheint und alles zu einem Ganzen fasst. Otmar Hasler hat für die Dachdeckerfirma ein unmissverständliches, aber vor allem auch nützliches Kennzeichen entworfen, dessen klare architektonische Form mehr bietet, als nur ein „Firmenschild“ zu sein.
An hellen Tagen mag man auf der Heimfahrt durch die ebenen Landstriche vor dem Einbruch der Nacht nicht selten von einem dieser großartig weiten, von Wolken dramatisch aufgeladenen niederösterreichischen Himmel überrascht werden, die für den Betrachter aus den Häuserschluchten der Großstadt nie diese Entfaltung und überwältigende Wucht erreichen.
Angemessen, klassisch und soeben mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnet: Schule, Dorfladen, Gemeindeamt und Dorfgasthaus aus massivem Holz. Nach dem Entwurf von Bruno Spagolla für Blons im Großen Walsertal.
Wenn man von Süden her über das Tal auf den Sonnenhang schaut, auf dem die zahlreichen Höfe des Dörfchens Blons verteilt sind, fällt auf, dass um die Kirche herum einige größere Baukörper stehen und kleinere sich dazu scharen. Zusammen bilden sie das Dorfzentrum. Der Kirchturm mit spitzem Helm überragt die Gruppe, darunter lagert die Längsseite des Kirchenschiffs unter steilem Schindeldach. Zu beiden Seiten schließt je ein giebelständiges Bauvolumen an, das jenes der nahen Familienhäuser um das Vier- bis Fünffache übersteigt. Es handelt sich links um das alte Volksschulhaus aus den 1950er-Jahren, rechts um das neue, das diesen Herbst in Betrieb genommen wurde. An den äußeren Flügeln dieses gleichsam klassischen Aufbaus befinden sich zwei parallel am Hang liegende Baukörper; links die Hauptschule aus den 1970er-Jahren, die sich in die alte Volksschule ausdehnen wird, sowie rechts das Gebäude mit dem neuen Dorfgasthaus und dem Gemeindeamt. Noch leuchtet das Holz der Neubauten hellgelb heraus. In wenigen Jahren wird es die Sonne goldbraun und bald noch dunkler gebrannt haben.
Ja, ist denn diese auf Harmonie bedachte Verdichtung der dörflichen Struktur zeitgemäß? Das kontextuelle Bauen ist doch vorbei. Angesagt ist das Betonen von Gegensätzen, die Fixierung auf den eitlen Solitär, und überhaupt, wo bleibt da die Innovation? Angemessenheit, denn um die geht es hier, ist zeitlos. Angemessen zu entwerfen heißt eben nicht, ein Bauwerk monofunktional auf Aufmerksamkeit hin zu trimmen, mit dem erwartbaren Risiko, dass ein aggressiv um Beachtung bettelndes Äußeres nach einigen Jahren peinlich wirkt, weil die überzogene Gestik lächerlich geworden ist. Heute, da gestalterisches Polarisieren in vielen Fällen zum Selbstzweck verkommen ist und die Pawlowschen Hunde der Architekturagitprop nur auf simple Äußerlichkeiten ansprechen, ist es hingegen eine Wohltat, vertieftes Eingehen auf komplexe, Tradition und Innovation integrierende Angemessenheit nachvollziehen zu dürfen und den vielschichtigen Überlegungen nachzuforschen, die diese und jene Entwurfsentscheidung zur Folge hatte. Damit gelangen wir in jenen Bereich komplexen Genießens von Architektur, der dem schnellen Kick vordergründiger Effekte überlegen ist, weil er nicht zuletzt nachhaltiger ist. Das heißt aber auch, dass traditionelle Prinzipien, kombiniert mit neuer Technik, oft weniger störanfällig sind als kaum erprobte Neuigkeiten. Die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts zeigt daher unter anderem, dass ein Verdrängen von Erfahrung zu eklatanten Bauschäden führt.
Das Dorf Blons musste nach den schweren Lawinenniedergängen vom 11. Jänner 1954 nicht weniger als 57 Menschenleben beklagen. Die Schneemassen hatten den Schutzwald umfahren oder sich neue Bahnen gebrochen. Als Gegenmaßnahmen wurden hoch oben Verbauungen errichtet, und der gemeindeeigene Schutzwald wurde erweitert. Doch auch dieser erfordert Pflege, will sagen: Durchforstung. Dabei fallen zuhauf kräftige Stämme von Fichten, Weißtannen und Lärchen an, und manch schöner Bergahorn ist auch dabei.
Die Blonser besitzen also Holz genug, weshalb sie es als Baumaterial für die dringend benötigten Zentrumsfunktionen festlegten. Die neuen Gebäude sollten die zweiklassige Volksschule mit Turnsaal und den Dorfladen sowie die Gemeindeverwaltung und endlich wieder ein Dorfgasthaus enthalten. Dazu kam ein Lawinenlehrpfad zur Erinnerung und Aufarbeitung, aber ebenso zur Mahnung für Skitouristen und Snowboarder. Ein Architektenwettbewerb erkor das Projekt von Bruno Spagolla aus Bludenz, der vor Jahren die Hauptschule gebaut hatte, zur Ausführung.
Die Funktionen sind auf zwei Gebäude aufgeteilt, die von der Straße weg in den Hang hinausgeschoben sind, so dass eine ebene Fläche als Schulhof und Parkplatz entsteht und darunter, zum Tal hin, ein volles Geschoß Licht erhält. Im Untergeschoß des giebelständigen Schulhauses befinden sich Turnsaal und Garderoben. Das große, außermittig liegende Fenster prägt die Stirnseite des Gebäudes und bietet den Turnenden Ausblick ins Tal. Darüber im Erdgeschoß ist der Dorfladen angeordnet, der vorher von der Straße abgelegen und recht beengt war. An der eingezogenen Nordostecke, einem Schopf, wie diese wettergeschützte Vorzone in Vorarlberg genannt wird, befindet sich der Eingang zu den beiden Volksschulklassen, die das Obergeschoß ausfüllen. Eine Galerie nutzt zusätzlich den Firstraum unter dem Satteldach für Gruppenbereiche, das Giebeldreieck ist verglast und gibt wieder die Aussicht ins Tal frei.
Doch nun zum Holz: Mit provisorischen Seilbahnen aus dem Wald gebracht und in der nahen Großsägerei zu Klotzbrettern und Balken geschnitten, wurden die Fichtenbohlen zu 20 cm starken und 80 cm breiten Elementen gefügt, die von diagonal vorgebohrten und eingepressten Buchenholzdübeln zusammengespannt werden. Die stärker getrockneten Dübel quellen im wenig feuchteren Fichtenholz wieder auf und halten durch Reibung fest. Diagonaldübelholz nennen es die Fachleute. Mit diesen Elementen werden Wände und Decken gefügt und als transportierfähige Teile auf dem in Stahlbeton gegossenen Sockelbauwerk aufgerichtet. Als Witterungsschutz ist eine in Nut und Kamm gefügte Bohlenplatte, die ebenso durch Diagonaldübel zusammengehalten wird, vor die Holzwand montiert. Gemeinsam verfügen sie über ausreichend Dämm- und Speicherwirkung, so dass für das Gebäude Passivhausstandard erreicht wurde. Auch das Satteldach ist aus Diagonaldübel-Holzelementen gefügt. Das statische Verhalten dieser Platten und Scheiben gleicht jenem von Stahlbeton, sie sind allerdings bloß ein Drittel so schwer und bilden keine Wärmebrücken. Und für die erdberührenden Teile kam ausreichend Beton zum Einsatz. So ergänzen sich die Materialien.
Aus den kräftigsten Weißtannen, ein Baum, der in Vorarlberg häufiger ist als sonst in Österreich, konnten wunderschön schlichte, astfreie Bretter und Kantel geschnitten werden, die für die Fenster und an den Laibungen Verwendung fanden. Für die Handläufe und Stiegen kam handschmeichelnder Bergahorn zum Einsatz. So sind die meisten im Schutzwald vertretenen Hölzer auch im Schulhaus zugegen.
Das andere Gebäude enthält im Erdgeschoß das Dorfgasthaus und darunter im Gebäudesockel die Gemeindeverwaltung. Es ist als Skelettbau mit kräftigen Schichtholzpfeilern errichtet, dessen Pultdach wieder von Diagonaldübel-Holzplatten getragen wird, die zusätzlich unterspannt sind. Die Gestaltung bleibt zeitgenössisch, wie dies der aufgeschlossenen Gemeinde mit einem nicht geringen Anteil junger Einwohner entspricht. Vor allem aber wurde das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Ort gesellschaftlicher Begegnung wieder erfüllt. Die prächtige Aussicht an den entlang der Südfassade aufgereihten Tischen wird aber auch Gäste von auswärts herbeilocken. Und nebenbei können sie sich von den Bauwerken deren Geschichte erzählen lassen, in der Angemessenheit und vernetztes Denken und Handeln gut vertreten sind.
Moderne Klassizität statt falscher Aufgeblasenheit: Salzburg hat für sein Museum der Moderne ein spannungsvolles Gebäude bekommen. Eines, das nicht wichtiger sein soll als die Kunstwerke, die es beherbergt.
Diese Kiste da auf dem Mönchsberg . . ." - „Entschuldigen Sie, eine Kiste wäre aus Holz.“ - „Na dann, diese Schachtel . . .“ - „Ist auch falsch, denn eine Schachtel bestände aus Karton oder dünnem Holz.“ - „Ja, darf man denn überhaupt keine griffigen Metaphern mehr verwenden?“ - „Nein, dürfen Sie nicht, denn Ihre Metaphern greifen daneben und sind maßstäblich falsch. Sagen Sie großer, liegender Quader, und schon stimmt's.“ - „Aber . . .“ - „Halten Sie jetzt die Klappe!“
Neben der gedrungenen Vertikalen des vertrauten Wasserturms, dessen historisierendes Äußeres seit über hundert Jahren erfolgreich um Akzeptanz des camouflierten Zweckbaus bettelt, ist ein horizontal betontes Element dazugekommen. Rahmenartig fasst die zur Stadt gerichtete Ostfassade ein breites Fenster, das den Hochblickenden signalisiert, wie bequem man von dort oben herunterschauen kann. Auf sich aufmerksam macht das Bauwerk mit der massiven Verkleidung aus dem fast weißen hellen Untersberger Marmor, der aus der Nähe stammt und, von nahe besehen, feine rote Äderungen aufweist. Modisches Schwarz hätte den Bau verschwinden lassen; doch wäre das gescheit gewesen? Schließlich sollen Besucher darauf aufmerksam gemacht werden, müssen sie doch mit dem Lift hinauffahren. Und besser als falsche Aufgeblasenheit ist moderne Klassizität allemal. Die neun Zentimeter starke Vormauerung weist Körper und Masse auf, und der lagerhafte Steinschnitt vermittelt Klassizität, subtil gebrochen durch die aufgeraute Oberfläche und ein nach Musikthemen mathematisch umgesetztes Muster schmaler Vertikalschlitze, die der Entlüftung dienen.
Das Haus für die Sammlung Welz, etliche Dauerleihgaben und Ankäufe vieler Jahre, reiht sich somit in die Gruppe jener Muse-umsbauten, die nach außen Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Wertkonservativismus vermitteln. Aber ist das Bewahren und Herzeigen von Werken der Moderne, ja selbst zeitgenössischer künstlerischer Arbeiten nicht eine konservierende Tätigkeit? So kommen äußerer Eindruck und Funktion des Hauses zur Deckung.
Doch wechseln wir zum Inneren des mehrgeschoßigen Bauwerks der Münchner Architekten Klaus Friedrich, Stefan Hoff und Stefan Zwink, das hinter dem Aussichtscafé, dem das breite Ostfenster gewidmet ist, quasi versteckt liegt. Der Mönchsberg wird durch einen Torbogen auf dem Niveau des Stadtkerns betreten. Drei schnelle Aufzüge heben die Besucher aus der Kaverne in die Höhe. Sie enden in einer niedrigen Halle, aus der zwei Stiegenläufe hinauf ans Licht und an die Brüstung über der Felswand locken. Der Zugang zum Museum führt aber in die andere Richtung, weiter in den Berg hinein, wo eine geräumige Querhalle die Besucher vorerst zur Ruhe und ans Kassenpult bringt und von wo Garderoben, Shop sowie ein Vortrags- und Mehrzweckraum zugänglich sind. Eine wirklich breite Treppe lädt nun ein, tiefer in den Berg einzudringen, doch zugleich ansteigend auf einen Lichtschein zuzugehen. So gelangt man in eine schluchtartige Querhalle, von der die erste Ausstellungsebene zugänglich ist. Hoch über Kopf schützt ein Glasdach, und rechts führen weitere breite Stiegenläufe zum nächsten Geschoß, denn noch ist man nicht aus dem Berg heraus. Die Säle weisen Kunstlicht auf, es sind Rundgänge, aber auch eine freie Wegsuche möglich. Die Wände sind hier neutral weiß, während die Gang- und Treppenhallen von Mauern aus glattem Sichtbeton umfangen sind, dem ein heller Zuschlagstoff beigemischt wurde, so dass er freundlicher wirkt als der übliche Tiefbaubeton. Eine feine Maßnahme, knapp über der Wahrnehmungsschwelle, aber enorm wichtig.
Natürlich kann man auch den Aufzug nehmen, um in die oberen Geschoße zu gelangen, doch der Weg durch die Treppenschlucht ist architektonisch attraktiver. Nun hat man auch die zur Terrasse befestigte Oberfläche des Berges erreicht. Breite Fenstertüren öffnen sich zum Skulpturenhof im Schatten des Wasserturms. Zwei lange, parallele Säle liegen vor und hinter der Treppenschlucht; im vorderen Gebäudeteil befindet sich auf dieser Ebene das Café.
Nochmals lockt eine Treppe unter gläsernem Dach zum weiteren Aufstieg ins oberste Geschoß, wo die Oberlichtsäle sich S-förmig um die beiden Treppenschluchten legen und Verbindungsgänge sowie ein luftiger Steg einem direkten Zugang dienen. Hier sind mit Bedacht teils sehr große Ausblicksfenster gesetzt, die sich zu den nahe stehenden Bäumen öffnen oder einen Ausblick nach Süden erlauben. Allerdings wird die Durchsicht wegen der starken Filterwirkung gegen UV-Licht beeinträchtigt, wenn zugleich die Sonne aufs Glas scheint. Hier muss die räumliche Konzeption vor den konservatorischen Bedingungen kapitulieren.
Die flach in die Decke eingesetzten Oberlichter beruhigen deren Wirkung, so dass von dort kaum eine visuelle Störung ausgeht. Etwas schwieriger ist es in den unteren Geschoßen mit dem Kunstlicht, das aus stark präsenten, parallelen Leuchtbalken an der Decke kommt. Aber da das Museum nicht streng als neutraler weißer Raum ausgelegt ist, ist dies ein Nebenaspekt in der attraktiven räumlichen Vielfalt, die mittels zusätzlicher Wände variiert und für kleinere Formate und Bildkombinationen anders definiert werden kann.
Dass das Präfix „Star“ nicht immer Erfolg garantiert, gilt nicht nur im Fußball, sondern auch in der Architektur. Dies erweist sich an der von Matteo Thun stammenden Einrichtung des Cafés von der modischen Stange. Lässt sich in dem Gewirr abgeworfener Geweihstangen, welche die Deckenbeleuchtung kaschieren, noch so etwas wie Witz vermuten, sind die Farbkreise an der Rückwand im Café eines Kunstmuseums peinlich. In einer Werkskantine hätte man gesagt: „okay, gut gemeint“. Doch wer weiß, wie flüchtig solche Inszenierungen sind, wird sich nicht aufregen.
Denn die Art und Weise, wie sich das Bauwerk innenräumlich aus dem Berg heraus entwickelt, ist spannungsvoll und engagiert gemacht. Die Trennung von Aufstieg und Abstieg von den Raumfolgen im Ausstellungsbereich sowie die Differenzierung der Geschoße sind sinnvoll. Doch vor allem ist angenehm, dass das Gebäude nicht wichtiger sein soll als die darin auszustellenden Kunstwerke und deren Zusammenschau. Es ist ein dienendes Bauwerk, dessen räumliche Entwicklung in vertikaler und horizontaler Ausdehnung die notwendige „Passegiata“ zwischen einer Bildersequenz, einer Thematik, einer Künstlerpersönlichkeit oder einer Epoche und der nächsten anbietet, also trotz der beachtlichen Ausstellungsfläche von 2300 Quadratmetern, abwechslungsreich bleibt. Salzburg hat damit ein attraktives Haus für seine Sammlung der Moderne und darüber hinaus zielenden Ausstellungen erhalten, dessen Innenleben den Vergleich mit anderen Häusern nicht zu scheuen braucht.
Das Glanzstück ist die Decke: Im Rhythmus einer Sinuskurve hebt und senkt sie sich. Und bestimmt so den Raum wie die ersten Takte einen Walzer. Friedrich Kurrents Ausstellungshalle für die Werke Maria Biljan-Bilgers.
Entlang der Straße, die nach Westen aus dem niederösterreichischen Dorf Sommerein strebt, reihen sich die Weinkeller. Das knappe Dutzend in die Böschung hineingebauter Stirnfassaden wird angeführt von einem Gebäude mit breiter, im Mittelteil steil aufragender Giebelmauer, in dessen Kern sich eine vermutlich spätmittelalterliche Kapelle verbirgt, an die, längst säkularisiert, zu beiden Seiten angebaut wurde. Sie markiert die Grenze des Wohngebiets. Das von Mauern eingefasste Geviert könnte vor Jahrhunderten ein Friedhof gewesen sein, aber so genau weiß man das nicht. Dahinter, im Süden, liegt ein aufgelassener Steinbruch, in dem Leithakalk gebrochen wurde.
Seit den 1970er-Jahren dienten Gebäude und Garten der bildenden Künstlerin Maria Biljan-Bilger (1912 bis 1997), die für ihre bildhauerischen Arbeiten den Leithakalk schätzte, als Atelier und Sommerwohnort. Vor etwas mehr als zehn Jahren konnte ein rückwärtig anschließender, trapezförmiger Grundstücksstreifen dazuerworben werden, mit dem Ziel, darauf eine Ausstellungshalle für Werke aus dem Besitz der Künstlerin sowie verstreute, vom Zeitgeist verschmähte und mit Glück gerettete Arbeiten zu errichten. Er war mit Abraum des Steinbruchs angefüllt, so dass sich erst später herausstellte, dass sich eine verbliebene Felskante diagonal durch das Grundstück zieht. Architekt Friedrich Kurrent, Lebenspartner der Künstlerin und Spiritus Rector des Unternehmens, begann 1994 mit der Planung. Ein Verein der Freunde wurde gebildet, und endlich flossen Fördergelder vom Land Niederösterreich, vom Bund, und auch die Gemeinde trug das Ihre dazu bei, so dass am 1. Mai dieses Jahres eröffnet werden konnte.
Das Grundstück ist bloß 36 Meter lang, die Ostseite, wo der Eingang von einer Stichgasse her erfolgt, misst 20 Meter, die kontinuierlich auf 13 Meter im Westen schrumpfen. Der erste Plan sah vor, darauf flächenfüllend eine zweischiffige Halle zu errichten, was von dem zum Vorschein gekommenen Fels durchkreuzt wurde. Nun ist sie um ein Drittel kürzer und im hinteren Teil etwas eingeschränkt, dafür ist die Präsenz der Felskante ein Gewinn für die Raumstimmung in der Halle.
Als ordnendes Element wirkt die Natursteinmauer im Süden, die in einem Rhythmus von sechs Metern jeweils durch einen Mauerpfeiler verstärkt ist. Das Baumaterial stammt von einem abgebrochenen Gasthaus im Dorf. Zwischen den Pfeilern ziehen sich Steinbänke, die bei Sonnenschein zum Sitzen einladen. Die Krone der Mauer onduliert nun zwei Wellen lang in einer Sinusschwingung, deren Amplitude unmerklich abnimmt. Genau genommen, verebbt sie im Schnittpunkt der nach etwa 150 Metern sich schneidenden Geraden der beiden Grenzlinien. Doch davon merkt der Besucher im Innenraum wenig, meint er doch, in den um einige Grade vom orthogonalen Netz abweichenden Ecken rechte Winkel zu erkennen; und der unmerklich zusammenlaufende Raum wirkt vom Eingang her kürzer, in der Gegenrichtung länger. In Hinblick auf den imaginären Schnittpunkt irgendwo am Ende der Kellerzeile denkt man an den tröstenden Vers Christian Morgensterns, dass sich selbst Parallelen in der Unendlichkeit treffen werden.
Friedrich Kurrent hat die Illusion freilich noch etwas zugespitzt, indem auch der Boden leicht ansteigt, so dass die Stirnseiten des südlichen Hallenschiffs vorn und hinten ähnliche Proportionen aufweisen und man ohne Grundriss zuerst einmal gar nichts merkt von dieser besonderen räumlichen Spannung, aber nichtsdestotrotz davon gefangen genommen wird. Das nördliche Hallenschiff verengt sich nun im Rhythmus der Stützen, weil die Felskante sich breit macht und am Ende auch in den Raum drängt.
Obwohl man beim Eingangstor zu ebener Erde den Raum betreten hat, kommt nun ein Gefühl des Sich-unter-der-Erde-Befindens auf, eine spezifische Geborgenheit, wie sie höhlenartigen Räumen eigen ist. Eine Pforte führt zuhinterst wieder ins Freie, man findet sich in einem allseitig mehr als kopfhoch eingefassten Außenraum wieder: auf der Südseite begrenzt durch die weitergeführte Natursteinmauer, im Norden umfasst von der ausbuchtenden Felskante. Den Raum beherrscht eine blockhafte Skulptur aus römischem Travertin. Drei Stufen in einem schmalen Durchlass leiten über zum Freiraum hinter der Ausstellungshalle, wo jene Reliefmauer steht, die Maria Biljan-Bilger für das längst abgebrochene Ausflugsrestaurant „Bellevue“ (1959 bis 1963) der Architekten Traude und Wolfgang Windbrechtinger schuf, sowie Kinderhäuser aus Steinzeug aus dem Kinderbad Hietzing, die in dieser Umgebung gut zur Geltung kommen.
Aber das Glanzstück des die Sachzwänge subtil überspielenden Entwurfs für das Bauwerk ist die Hallendecke. Während der Längsträger, der die beiden ungleichen Hallenschiffe zoniert, auf drei Rundstützen aus Stahlbeton horizontal verläuft, hebt und senkt sich die Decke an den Seiten im Rhythmus von Sinuskurven, so dass sich flache Gewölbe mit gebauchten Flächen abwechseln. Diese wenigen Schwingungen bestimmen den Raum wie die ersten Takte einen nachfolgenden Walzer. Erzeugt werden sie, wie dies bei Regelflächen so üblich ist, durch Geraden, deren Lage durch die gegenläufigen Sinuskurven der Seitenmauerkronen und die Gerade des Hauptträgers in der Mitte vorgegeben werden. Konstruktiv umgesetzt sind sie mit armierten Trägern aus Ziegeln und Beton, wie sie bei Tonhohlkörperdecken verwendet werden. Allerdings sind sie hier fugenlos nebeneinander verlegt, wobei die längstmögliche Spannweite gerade ausreichte. Der Versatz der Träger ergibt ein feines Stufenmuster, das an der Decke aufscheint und verschwindet, entsprechend dem Kurvenschwung der Flächen. Ein armierter Überbeton verbindet die Einzelelemente statisch zur Platte.
Mit dieser Decke gewinnt die Halle jene Besonderheit, die sie zum architektonischen Raum, zur Ausstellungshalle für die Steinzeug-Figuren von Maria Biljan-Bilger werden lässt. Hohes Seitenlicht, das durch breite Öffnungen unter den Wölbungen eindringt, betont deren Plastizität und erweckt sie zum Leben. Vertikale Lamellen aus Stahlblech regeln den Lichteinfall und halten Wind und Wetter ab. Quadratische Ausblicksfenster zielen auf die Felsformationen des verlassenen Steinbruchs und halten die Erinnerung lebendig, wo man sich befindet. Ihre Kraft bezieht die Halle neben der räumlichen Qualität aus dem ,Infinito' des bewusst im Rohbau angehaltenen Bauverlaufs.
Friedrich Kurrent, dem Wenigbauer und wichtigen Lehrer, ist damit ein Hauptwerk gelungen. Und ich wiederhole eine Überlegung zur Ausstellungshalle „La Congiunta“ in Giornico, Schweiz, von Peter Merkli, die er für Werke von Hans Josephson errichtete: „Wie viel Raum braucht ein Kunstwerk? Vielleicht so viel, als es Kraft enthält, dass es Menschen dazu bewegt, diesen Raum zu schaffen.“
Die Ausstellungshalle ist von April bis Oktober samstags und sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Seit Jahrtausenden ist die Architekturentwicklung ein Open-Source-Projekt. Ein Diskurs, der permanent stattfindet. Nicht zuletzt in Wiener Architekturzeitschriften. Ein Überblick.
Unter dem Titel „Ein Kommunismus der Ideen“ plädiert Dennis Kaspari im kürzlich erschienenen „Umbau 21“ dafür, eine Architekturpraxis zu entwickeln, die in Anlehnung an die „Open-Source-Bewegung“ der freien Softwareszene (zum Beispiel Linux), den Architekturdiskurs ebenso offen und für alle zugänglich organisiert. Man müsse nur den Quellcode der jeweiligen Programme der Architekturgenerierung veröffentlichen. Nun, die Türen, die hier aufgestoßen werden sollen, sind weit offen. Mag sein, dass vor lauter Toren die Eintrittsmöglichkeiten übersehen werden. Denn wer sich ein wenig mit Architekturgeschichte befasst hat, wird rasch merken, dass die Architekturentwicklung seit Jahrtausenden ein Open-Source-Projekt ist. Denn selten sind Kunstwerke so öffentlich wie Bauwerke. Sie stehen über Jahrzehnte und Jahrhunderte und geben sogar als Ruinen noch ihre zugrunde liegenden Überlegungen jenen preis, die gelernt haben, sie zu analysieren und im Kontext zu verstehen.
Damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt: Die Architektur ist die Architektur und ein Computerprogramm ist ein Computerprogramm. Was unter Architektur nach heutigem Wissen verstanden werden kann, ist, dass es sich um ein Komplexon aus messbaren und nur gefühlsmäßig erfassbaren Faktoren handelt und dass ihr Gestehungsprozess sich aus strikten Abläufen und unabhängig wirkenden Einflüssen herausbildet. Es liegt ihr nicht ein mechanisches Muster zugrunde, das eindeutige Beziehungen zwischen dem konkreten Objekt und den Bedeutungen und Wirkungen sicherstellen würde; vielmehr kommt es immer wieder zu Mehrdeutigkeiten und interferierenden Überlagerungen, so dass die Interpretation von zahlreichen Faktoren abhängt, angefangen vom kulturellen Kontext bis hin zur Fähigkeit, die Betrachtenden zu analysieren. Bei der strenger und finaler zu strukturierenden Softwareproduktion ist dieser Spielraum viel geringer.
Der Vergleich mit Disziplinen der Massenkultur mag immer wieder anregend sein, doch geht in die Irre, wer, statt bei der Sache selbst zu bleiben, nach den Regeln eines woher auch immer gewählten Erklärungsmusters weiterdenkt. Ob dies nun das Fußballspiel, das Kochen oder etwas anderes sei, jede Disziplin hat je ihre eigenen Regeln, die von jenen der Architektur verschieden sind. Alle vergleichenden Überlegungen müssen weiterhin im innerarchitektonischen Diskurs wurzeln, sonst schaut außer kurzzeitiger Anregung wenig heraus.
Dieser Diskurs findet permanent statt: in nonverbalen Bereichen durch Anschauung und das Errichten von Gebäuden nach den Entwürfen der Architekturpraktiker sowie als planliche Darstellung von Projekten, beispielsweise bei Wettbewerben; auf der sprachlichen Ebene sind es Vorträge und Diskussionen sowie die schriftliche Fassung von Erkenntnissen und Meinungen. Dabei kann es immer wieder zu Dialogen kommen, die über zeitliche Distanzen von wenigen Monaten bis zu Jahrhunderten reichen, deren Medium die Architektur ist, das heißt die Bauwerke selbst.
Über das Medium der Sprache verständigen sich die am Diskurs teilnehmenden Fachleute und interessierten Laien sowie Spezialisten anderer Disziplinen über ihre gegenwärtige Interpretation des betrachteten Gegenstands oder Sachverhalts. Waren es bis ins 18. Jahrhundert vornehmlich Traktate und enzyklopädische Veröffentlichungen, die - neben Vorträgen, die großteils verhallt sind - den stattgehabten Diskurs ausmachten, so treten mit der politischen Liberalisierung im 19. Jahrhundert die Fachzeitschriften auf den Plan, mit denen technische Neuerungen und gestalterische Entwicklungen in den Markt der Ideen eingebracht werden. Diese Tradition hält bis heute an, und so finden wir auch in Wien wieder mehrere diesbezügliche Zeitschriften, wobei unser Interesse diesmal jenen gelten soll, die mit wenig Bildern und viel Text, oftmals wissenschaftsmethodisch gestützt durch Fußnoten, daherkommen. Trotzdem handelt es sich dabei um ein Minderheitenprogramm, aber um eines für qualifizierte Minderheiten, was sich letztlich überproportional auswirkt. - Beginnen wir mit der älteren, der bereits erwähnten Zeitschrift „UmBau“, die seit 1979, zwar nicht periodisch, aber immer wieder als mehr oder weniger starke Broschüre im A5-Format erscheint und nun bei der 21. Nummer angelangt ist. Herausgeberin ist die Österreichische Gesellschaft für Architektur, die seit Jahrzehnten mit Vortrags- und Besichtigungsprogrammen in Wien präsent ist. Ab der Nummer 19 wurde das Institut für Architekturtheorie der TU Wien, Leitung Kari Jormakka, dazugeholt, was sich sowohl inhaltlich als auch auf die Frequenz des Erscheinens positiv auswirkte. Dieser wichtige Bezug zur universitären Ebene, der früher zwar informell immer irgendwie bestanden hatte, erhöhte das Gewicht der Publikation im doppelten Sinn.
Das Themenheft „Lernen von Calvin Klein“ versammelt Aufsätze und Gespräche mit Fachleuten zur Frage, inwieweit die Mode, deren implizite Muster und ihr beschleunigter Wechsel sowie die Techniken und der absolute Zwang zum Verkauf die Architekturentwicklung und das Schaffen der Architektinnen und Architekten beeinflussen. Nicht immer wird man bereit sein, den Ausführungen widerspruchslos zu folgen, aber das ist der Sinn derartiger Lektüre. Schwieriger wird es bloß dann, wenn nach einer langen Folge von Zitaten nicht klar wird, worauf der Autor eigentlich hinaus will. Doch der nächste „Call for Papers“ zum Thema „Wettbewerb!“ ist bereits erfolgt, für neuen Diskussionsstoff wird gesorgt.
Seit dem Jahr 2000 erscheint die vom Architekturzentrum Wien herausgegebene Publikation „Hintergrund“, ursprünglich als Heft im A5-Format, seit der Nummer 20 als Taschenbuch, wenig größer als die bekannt günstigen Reclam-Editionen. Thematisch begleitet „Hintergrund“ das Ausstellungs-, Kongress- und Vermittlungsprogramm in freier Weise. Die jüngste, die Nummer 24, befasst sich unter dem Stichwort „Kiosk“ mit dem Resultat eines diesbezüglichen Wettbewerbs für den Ticketservice „Österreich Ticket“ sowie getreu dem Namen der Publikation mit literarischen Texten, in denen das alltagskulturelle Geschehen in den und um die wackeligen Hütten am Straßenrand mehr oder weniger hintergründig aufscheint.
Etwa gleich alt ist das A4-große Heft „dérive“, im Untertitel als Zeitschrift für Stadtforschung präzisiert, deren 15. Heft den Schwerpunkt „Frauenöffentlichkeiten“ behandelt. Das Schwergewicht liegt hier auf soziokulturellen Themen, die für eine erneuernde Programmierung von Städtebau und Architektur Diskussionsstoff bereitstellen. Engagiert setzen sich die Schreibenden für soziale Randgruppen ein, doch verschwimmt dabei ein wenig der Unterschied zwischen asiatischer, amerikanischer und europäischer Stadt. Allen drei Publikationen ist gemeinsam, dass sie sich intensiver mit der Bedeutung stiftenden kulturellen Umgebung befassen als mit innerarchitektonischen Themen, mit denen der „Quellcode“ zu den nachhaltigeren Beweggründen von Architektur zu knacken wäre. Aber das wäre für viele weniger unterhaltsam.
Die Gezeiten städtebaulicher Entwicklung haben vom Garten des Kriegsherrn und Pflanzenfreunds Prinz Eugen wenig übrig gelassen. Jetzt wurde er denkmalpflegerisch wiederbelebt, nach Konzepten von Maria Auböck.
Schon Mitte 18. Jahrhundert, nach Übernahme der Schlossanlage durch Kaiserin Maria Theresia, wurde der gärtnerische Aufwand im Belvederegarten stark reduziert, denn Prinz Eugen, der erfolgreiche Kriegsherr, war als Pflanzenliebhaber eine Ausnahmefigur und hatte in seinen letzten 15 Lebensjahren auf Gestaltung und Pflege seiner Gärten viel Geld und auch Zeit verwendet. Bereits 1779 wurden die Anlagen dem Publikum geöffnet, sodass Wienerinnen und Wiener sowie erste Touristen den Garten genießen durften. Im 19. Jahrhundert kam die Anlage auch technisch immer mehr in die Jahre; erst unter Franz Ferdinand, der im Schloss Wohnsitz nahm, gab es einen gestalterischen Impuls - der Zeit entsprechend im Jugendstil.
Doch in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen wird von Heuernte im Gartenparterre berichtet. Kriegsschäden kamen dazu, und dem ahistorischen Funktionalismus der Nachkriegszeit ging das Gefühl für barocke Gärten völlig ab. Doch seither dehnten sich die kunsthistorischen Forschungen auch auf Anlagen gärtnerischer und landschaftlicher Gestaltung aus, und mit dem vertieften Wissen wuchs zugleich die Begeisterung der spezialisierten Fachleute.
Zu diesen zählt auch die Gartenarchitektin Maria Auböck, die mit dem Konzept zur Restaurierung des Gartenkomplexes beim Belvedere beauftragt wurde, das 1991 vorlag. Als wichtige Quelle diente das von Prinz Eugen in Auftrag gegebene Stichwerk Salomon Kleiners. Mit vergleichsweise wenig zusätzlichen öffentlichen Geldern bewerkstelligte die Bundesgartenverwaltung unter dem örtlichen Leiter Willibald Ludwig in den folgenden Jahren eine künstliche Bewässerung, die Sicherung der Beetkanten und die Anlage von Ziegelbruch- und Kiesornamenten; dazu kamen der Tausch der überalterten Hecken aus Feldahorn sowie die Sommerpflanzungen nach dem Konzept des schottischen Gartengestalters Mark Laird. Der World Monuments Fund aus New York initiierte mit einer großen Spende - die von der Burghauptmannschaft kräftig aufgestockt wurde - den Bau einer Zisterne und die Sanierung der Rampen. Und der Verein der Wiener Museumsfreunde ließ die Sphingen restaurieren.
Archäologische Grabungen lieferten die Angaben zur Wiederherstellung des Senkgartens - man beliebte dort jeweils Crocket zu spielen - vor der ehemaligen Voliere im Kammergarten, dem besonders reich gestalteten Teil vor den Privatgemächern des Prinzen.
Wenn man das Wienpanorama des Bernardo Bellotto, das in der Weltkulturerbediskussion unter dem Stichwort „Canaletto-Blick“ immer wieder als Maßstab zitiert wurde, zur Hand nimmt und dabei berücksichtigt, dass seither die Ringstraße entstand und überhaupt alle Häuser höher geworden sind, fällt dennoch auf, dass der Garten Prinz Eugens einen wesentlichen Teil des Vordergrundes einnimmt. Abgesehen von der günstigen Lage für einen Blick auf die Stadt, dürfte auch der berühmte Garten die Standortwahl für die Camera obscura des Künstlers beeinflusst haben. Jedenfalls ist er sehr detailliert dargestellt, mitsamt pflegenden Gärtnergesellen und zahlreichen Besuchern, sodass auch dieses Bild als Quelle für die Restaurierung herbeigezogen wurde.
Wenn schon Weltkulturerbe, dann gehört der Belvedere-Garten dazu: ehedem ein sanft nach Norden abfallender Weinberg, ließ der Erbauer das Terrain kräftig umgestalten. Zwischen den Hauptbauwerken des Unteren und des Oberen Belvedere ist der in drei Teile gegliederte Hauptgarten aufgespannt. Im unteren, ebenen Teil bilden Bosketten aus exakt geformten Hecken und hochstämmigen Kugelbäumen abwechslungsreiche, nach oben offene Raumgebilde mit Durchblicken und ruhigen, geschützten Bereichen. Eine Querachse mit ehemals zwei Teichen - heute Senkgärten - weitet den Raum, während die Mittelachse, begleitet von weißen, aus den Hecken tretenden Skulpturen und flankiert von einem Spalier aus Eibenpyramiden und -kegeln in Menschengröße, auf einen leider noch trockenen Brunnen zustrebt, der in die akzentuierte Geländestufe zum oberen Teil eingebaut ist. An der Westseite des unteren Teils schließt der Kammergarten an, in dem die farbenprächtige barocke Bepflanzungsweise bereits wieder zu bewundern ist.
Vor der Geländestufe verschwindet das obere Belvedere aus dem Blickfeld, der Flaneur ist gehalten, nach rechts oder links auszuweichen und über die dort befindlichen Stufen, zwischen denen ornamentgeschmückte Rampen hochführen, die obere Ebene zu erreichen, wo das Schloss wieder zu sehen ist. Die stetig ansteigende Fläche bildet das Gartenparterre, dessen mit Kies und Ziegelsplit im Rasen angelegte Ornamente dafür vorgesehen waren, von den oberen Räumen des Schlosses aus gesehen, am wirkungsvollsten zur Geltung zu kommen - wie dies durch Bernardo Bellotto und andere nachvollzogen wurde.
Im vorderen, dem Ausblick entfernteren Teil schneidet eine horizontale Fläche in die schiefe Ebene: das versenkte Parterre. Die seitlich begleitenden Rasenflächen werden immer steiler, im hinteren Abschluss kommt es zu einer zweiten künstlichen Geländestufe, deren Mittelachse von einer Kaskade besetzt gehalten wird. An dieser Stelle sind beide Schlossteile den Blicken entzogen, was natürlich umgekehrt auch gilt. Dieser Teil des Gartens war - und ist heute wieder - mit stark farbigen Sommerblumen bepflanzt, die drei Mal gewechselt werden, damit die sinnenfreudige Pracht länger anhält.
Vor der Ostseite des Oberen Belvedere liegt die radial gegliederte ehemalige Menagerie, während südseitig der Vorpark und der Teichhof bis zum Linienwall, dem heutigen Gürtel, reichten. Hier ist vorgesehen, die Bestandsreste aus der Zeit Franz Ferdinands zu ergänzen. Auch würde es nicht schaden, die Asphaltflächen zu reduzieren. Es wird kaum verwundern, dass die denkmalpflegerische Erneuerung und die jährliche Betreuung aufwendig sind. Die Umwegrentabilität für den Wientourismus sollte jedoch nicht unterschätzt werden, ebenso wenig die Bedeutung als Grünraum für die benachbarten Wohnquartiere. Mit der Wiederherstellung wachsen Verständnis und Stolz in der Stadtbevölkerung, mithin die Identifikation mit dem kulturellen Erbe. Man wird Gäste hinführen und als Wissensbasis mit kundigen Erläuterungen das vor kurzem von Maria Auböck herausgegebenes Buch zur Hand nehmen.
Der von Maria Auböck herausgegebene Band „Das Belvedere“ (Fotos: Ingrid Gregor) ist bei Holzhausen, Wien, erschienen.
verknüpfte Publikationen
- Das Belvedere - Der Garten des Prinzen Eugen in Wien
Zum Tod des Architekturpublizisten Walter Zschokke
Er hat die Architekturpublizistik Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Seit 1988 schrieb der gebürtige Schweizer, Jahrgang 1948, Hunderte einschlägige Essays im „Spectrum“ – präzise, leidenschaftliche Reflexionen am Puls der regionalen und internationalen Entwicklung. Zschokkes Engagement für gestalterische Qualität in allen Maßstäben produzierte sich nie in lauter Polemik oder in brillant gedrechselten, ästhetischen Urteilen. Unbeirrt von Zeitmoden, kultivierte er die sachbezogene, vielschichtig ausgelotete Beschreibung des Faktischen als Grundlage jeder Diagnose, jeder kritischen Äußerung, jeder negativen oder positiven Wertung. Dazu befähigten ihn ein exzellentes technisch-konstruktives Wissen und Gespür, die breite Erfahrung auch als praktizierender Architekt, die kulturwissenschaftliche Schulung an der besten technischen Hochschule Europas und nicht zuletzt sein handwerkliches Know-how, speziell im Umgang mit Holz.
Aufgewachsen im Kanton Aargau, kam Zschokke nach dem Studium an der ETH Zürich, nach acht Jahren Assistenz bei Adolf Max Vogt und mit einem von André Corboz und Jacques Gubler approbierten technischen Doktorat 1985 nach Wien; hier führte er ab 1989 mit Walter Hans Michl ein Atelier, war Mitautor eines Wohn- und Bürohauses in Wien-Neubau, des Kirchenzentrums im Stadtteil Wien-Leberberg und großer städtebaulicher Wettbewerbe; 1992 gestaltete er mit Margherita Spiluttini die Fotoschau „Neue Häuser“, welche die damals junge Szene Österreichs auf vielen Stationen bis nach New York und Mexiko präsentierte; anlässlich des EU-Präsidentschaft Österreichs 1998 war er Mitautor und -gestalter der multimedialen Wanderausstellung „Architekturszene Österreich“.
Neben der Arbeit für das „Spectrum“ redigierte Zschokke etliche Architektenmonografien, war Mitbegründer von „Orte – Architekturnetzwerk Niederösterreich“, gefragter Juror und Gutachter, Vortragender. All dies wurde offiziell mit Preisen für Architektur und Publizistik von den Ländern Wien und Niederösterreich gewürdigt; zuletzt wirkte er als Juror/Mediator beim Um- und Zubau der Wiener Arbeiterkammer.
Sein bestes Buch ist die in der Schweiz verlegte Dokumentation über die hochalpine „Sustenpassstraße“, ein Standardwerk internationalen Formats an der Schnittstelle von Verkehrs- und Landschaftsplanung, von Ingenieurwesen und Architektur, von Wissenschaft und Ästhetik. Sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit war in Wien die Vorstellung des mit Walter Bohatsch betreuten nachgelassenen Buches „Geschautes“ von Ernst Hiesmayr.
Walter Zschokke konnte wie kein anderer konstruktive Stärken und Schwächen von Tragstrukturen auf Anhieb analysieren oder gebaute Raumereignisse in nachvollziehbare Beschreibungen gießen, vermochte aber auch aus der Betrachtung einer windschiefen Vorgartenmauer oder einer hölzernen Trinkschale ein ganzes Panorama alltagskultureller Kausalitäten und Schönheiten zu erzählen. Am 5. Februar war sein jahrelanger Kampf gegen den Krebs zu Ende, er starb im AKH, umsorgt von seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern. Er fehlt uns.

2008
Die Architektur von Dietrich|Untertrifaller hat eine starke Beziehung zum Ort und seinem Umfeld. Sie ist individuell aus der Situation und dem Programm entwickelt. Dies garantiert differenzierte Lösungen, Individualität und Unverwechselbarkeit. Bestehendes und Neues ergänzen einander und führen zu einem
Hrsg: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

2007
Seit Jahrzehnten gleichen sich die Bürogebäude: Rasterfassade mit viel Glas, rechteckige Grundrisse. Gegen diese Klischees setzt der Neubau für die niederösterreichische Wirtschaftskammer, des Architekturbüros Rüdiger Lainer + Partner, einen überzeugenden Kontrapunkt. Das mächtige Bauwerk ist als Großform
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

2006
Sowohl die Bedeutung des Holzes als Roh-, Bau- und Werkstoff als auch die Vielfältigkeit und Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Holzarten werden oftmals unterschätzt. Denn jede Holzart besitzt ihre spezifischen Eigenschaften, die sich je nach Anwendungsbereich vorteilhaft einsetzen lassen. Zugleich
Hrsg: proHolz Austria
Autor: Walter Zschokke, Josef Fellner, Alfred Teischinger
Verlag: proHolz Austria

2006
Architektur hat in Niederösterreich, dem großen Bundesland rund um Wien, im Zuge der Hauptstadtplanung in St. Pölten erhöhte Aufmerksamkeit gewonnen. Seither sind im ganzen Land Bauwerke entstanden, deren Qualität Betrachtung und Auseinandersetzung lohnen. Ältere und jüngere Architekten wie Ernst Beneder,
Hrsg: Walter Zschokke, Marcus Nitschke
Verlag: SpringerWienNewYork

2003
Die präzise und materialreiche Darstellung einer wichtigen Epoche - mit überraschenden Einsichten und Anregungen für das heutige Architekturschaffen.
Hrsg: Walter Zschokke, Michael Hanak
Verlag: Birkhäuser Verlag
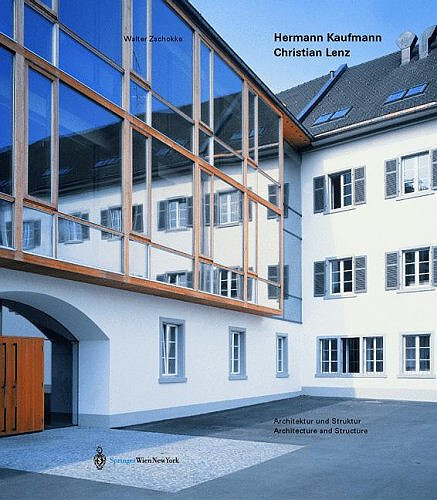
2002
In der Vorarlberger Architekturlandschaft verfolgen Hermann Kaufmann und Christian Lenz mit eigenständig und gemeinsam bearbeiteten Bauwerken eine Linie, die auf sorgfältiger Konstruktion beruht und sich an klare Geometrien und exakte Proportionen hält. Dem Baumaterial Holz und industriell erzeugten
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork
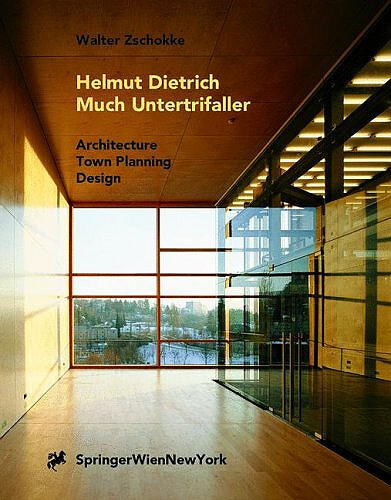
2001
Im scheinbar homogenen Architekturschaffen Vorarlbergs, das im vergangenen Jahrzehnt international bekannt wurde, treten die Bauwerke von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller aus verschiedenen Gründen hervor: sie sind feinfühlig architektonisch und großstädtisch, sie bevorzugen keines der primären
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

1999
Die erste Monographie über den österreichischen Architekten Rüdiger Lainer, der in seinen Bauten systemische Ökonomie und individuelle Lebendigkeit in Einklang bringt.
Hrsg: Walter Zschokke
Verlag: Birkhäuser Verlag

1997
Das Bundesland Niederösterreich, ehemals das Umland von Wien, hat im 20. Jahrhundert eine schrittweise Emanzipation vollzogen, was zuletzt in der Wahl St. Pöltens zur eigenen Hauptstadt (anstelle von Wien) und in der Folge im Bau eines entsprechenden Regierungsviertels kulminierte.
Die ländlich industriell
Hrsg: ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Autor: Walter Zschokke, Otto Kapfinger
Verlag: Birkhäuser Verlag

1997
Im September 1946 ist die Sustenpassstrasse, die in einschlägigen Kreisen damals schon als «Musterstück schweizerischer Strassenbaukunst» galt, nach achtjähriger Bauzeit offiziell eröffnet worden. Der Architekt Walter Zschokke zeigt, wie die Linienführung einer Strasse in die Landschaft integriert werden
Autor: Walter Zschokke
Verlag: gta Verlag

1996
Boris Podrecca, dessen umfangreiches Schaffen sich inhaltlich im Bereich der Pole Wien und Triest bewegt, liegt mit seinen auf organische Prozesse bezogenen und Lebensvorgänge interpretierenden Entwürfen weder im Trend einer zur Manier verkommenen «Neuen Einfachheit», noch folgen sie dem zum Dekorstil
Autor: Walter Zschokke
Verlag: Birkhäuser Verlag
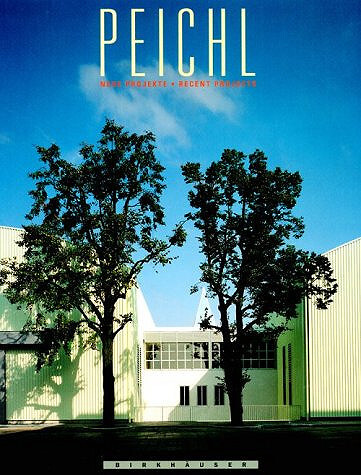
1996
Gustav Peichl gehört zu jenen international anerkannten österreichischen Architekten, «die das österreichische Selbstverständnis mitstilisiert haben» (Friedrich Achleitner). Unter seinen Arbeiten sind vor allem die Rundfunkstudios des ORF sowie die Bundeskunsthalle in Bonn international bekannt geworden.
Autor: Walter Zschokke, Gustav Peichl
Verlag: Birkhäuser Verlag