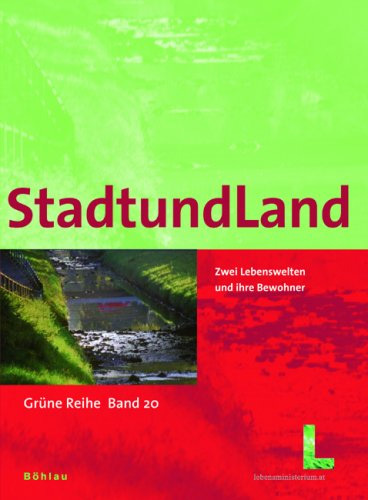Ein park für alle
Integrative Planung am Beispiel Oeversee-Park Graz
Gezielt angelegte Partizipationsverfahren, die von vornherein in die Fachplanung integriert werden und die künftigen NutzerInnen eines Freiraums als PartnerInnen ernst nehmen, können den Projektverlauf verkürzen, die Planungsqualität erhöhen und in vielen Fällen sogar die Gesamtprojektkosten senken.
BürgerInnenmitbestimmung bei Planungsprojekten ist doch nur unnötiger Ballast. Sie verteuert die Projektkosten, verzögert den Planungsablauf, und zumeist werden die Planungsideen verwässert. Aber was bleibt uns übrig – man
kommt heute nicht mehr drumherum.
Eine nur mehr selten ausgesprochene, aber immer noch weitverbreitete Meinung unter PlanerInnen, BeamtInnen und PolitikerInnen.
Zwei Beamte und zwei Stadträte im Grazer Rathaus waren der gegenteiligen Meinung und setzten ein Projekt in Gang, mit dem sie den Beweis antreten wollten, daß integrative Planung mehr ist als ein Alibi; daß sie zumindest gleich schnell ist und höhere Planungsqualität hervorbringt als konventionelle Planung, wenn man‘s nur richtig angeht. Und sie scheinen recht zu behalten.
Oeversee-Park Graz – die Ausgangssituation
Vor einem Jahr wurde ich von der Stadt Graz beauftragt, auf einer 2 ha großen, für zehn Jahre durch die Stadt angepachteten Fläche im Herzen eines mit Grünflächen sehr schlecht ausgestatteten Bezirks einen Park zu projektieren. Die Finanzierung erfolgte im Rahmen des Projektes „Urban Graz – Platz für Menschen“ aus dem EU-Förderungsprogramm URBAN, welches großen Wert auf integrative Planung legt. Die Anzahl der potentiellen NutzerInnen des Parks ist groß (etwa 4.000 Haushalte). Die Planung sollte rasch abgeschlossen werden (hoher jährlicher Pachtsatz muß gerechtfertigt werden). Die Nutzungsansprüche divergieren stark (Mittelschule und Altersheim unmittelbar daneben, viele Randgruppen und soziale Probleme im Bezirk).
Der methodische Ansatz
Der Planungsablauf folgte einem im voraus festgelegten, detaillierten Zeitplan. Zur Sicherstellung des integrativen und partizipativen Charakters wurden Planungsprozeß und Einbeziehung der Bevölkerung eng miteinander verknüpft.
Der eigentlichen Entwurfsphase wurde eine Phase der Zielfindung und Ideensammlung gemeinsam mit den künftigen NutzerInnen vorgeschaltet. Der Entwurfsprozeß an sich wurde immer wieder mit einer kleinen, aber repräsentativen Gruppe aus der Gesamtheit der künftigen NutzerInnen rückgekoppelt. Dieses aus etwa zwanzig Personen bestehende Komitee brachte in Werkstattgesprächen die Vorstellungen und Erwartungen der künftigen NutzerInnen ein. Das Komitee wurde nach dem Vorbild der „Planungszellen“ (DIENEL, 1978) so zusammengestellt, daß alle wichtigen NutzerInnentypen und die VertreterInnen der wesentlichen betroffenen Institutionen darin vertreten sind. Während aber beim ursprünglichen Modell der Planungszellen die VertreterInnen nach dem Zufallsprinzip aus dem Wählerverzeichnis gezogen werden, mußte die Methode hier adaptiert werden. In einer BürgerInnenversammlung und mit einem Rundbrief an alle 4.000 Haushalte im Einzugsgebiet wurden interessierte BürgerInnen aufgefordert, sich freiwillig als VertreterInnen der NutzerInnengruppen zu bewerben. Bei Mehrfachbewerbungen wurde die Entscheidung dem Los überlassen.
So konnte ein Großteil der künftig zu erwartenden Nutzungskonflikte in den Planungswerkstätten bereits vorweggenommen und behandelt werden.
Parallel zu dieser Arbeit im Planungskomitee erfolgte die Information der Gesamtbevölkerung des Stadtteils durch zwei BürgerInnenbesprechungen zu Beginn und zu Ende der Entwurfsplanung, durch drei Rundbriefe zur Information der BewohnerInnen sowie durch Berichterstattung in den lokalen Medien.
Die Moderation
In der Abwicklung der Sitzungen wurde auf eine lebendige, aber dennoch sehr konsequente und zielorientierte Moderation geachtet – im Planungskomitee durch den Planer selbst, in den BürgerInnenversammlungen durch einen externen Moderator. Dabei wurden verschiedenste Hilfsmittel und Methoden moderner Moderationstechnik angewandt – insbesondere Elemente der „Zukunftswerkstätte“ (JUNGK, MÜLLERT, 1989) wie Brainstorming, Gruppenarbeiten, Priorisierung, Blitzlicht im methodischen Bereich und Flip-Chart, Pin-Wände, Moderationskärtchen etc. als materielle Hilfsmittel.
In diesem über sieben Monate laufenden Planungsprozeß wurde ein Entwurf erarbeitet, der den formulierten Wünschen der AnrainerInnen und den Vorgaben der AuftraggeberInnen weitgehend entspricht.
Im gegenständlichen Projekt wiederholten sich viele Erfahrungen aus anderen Partizipationsplanungen. Einige der immer wiederkehrenden Aspekte sollen im folgenden am Beispiel Oeversee-Park diskutiert werden.
AuftraggeberIn – Planer/Moderator – Beteiligte: eine Dreiecksbeziehung
Wie der Name schon sagt, ist der Moderator in der Rolle der „Mittlers“ zwischen mindestens zwei, meistens mehreren Gruppen, die in der Regel stark divergierende Wünsche haben und deren Kommunikationsbasis zumeist auch mehr oder weniger beeinträchtigt oder zumindest angespannt ist. Umso wichtiger ist es, daß der Planer/Moderator außerhalb dieses Verhältnisses steht und diese Position auch gegenüber allen Beteiligten immer wieder klar zum Ausdruck bringt. Ein heikler Punkt ist dabei die Auftragsbeziehung: Der Auftraggeber zahlt, und „wer zahlt, schafft an!“, heißt es im Volksmund. Es lohnt sich, in diesem Punkt Klarheit zu schaffen. Denn der, der da zahlt – zumeist die öffentliche Institution – ist ja in Wirklichkeit nur treuhänderischer Verwalter der Mittel, die ihm „das Volk“ zur Verfügung gestellt hat.
Beim gegenständlichen Projekt waren bis jetzt insgesamt 14 klar definierbare Gruppen zu integrieren:
Auf der Auftraggeberseite der „formelle“ Auftraggeber in Gestalt des Amtes für Stadtentwicklung und der „inhaltliche“ Auftraggeber in Gestalt des Stadtgartenamtes.
Als Kooperationspartner die Büros der beiden Stadträte Feldgrill-Zankel und Pammer, das Büro für Bürgerinitiativen der Stadt Graz, das für die Aussendungen und Einladungen sorgte, das Oeversee-Gymnasium, das die Räumlichkeiten für sämtliche Besprechungen zur Verfügung stellte, die Magistratsabteilungen für Verkehrsplanung sowie Straßen- und Brückenbau.
Als Beteiligte die „breite Öffentlichkeit“ in Form der etwa 6.000 potentiellen ParknutzerInnen, das zwanzigköpfige Planungskomitee, die LehrerInnen und SchülerInnen des Oeversee-Gymnasiums sowie die Beschäftigten des Geriatrischen Krankenhauses.
Die Aufgabe des Planers/Moderators ist es, den Überblick über den Kommunikationsfluß zu erwerben und zu bewahren und dafür zu sorgen, daß das erforderliche Maß an Kommunikation sichergestellt ist.
Der zeitliche Ablauf – ein Drei-Phasen-Modell
Die meisten Partizipationsprozesse folgen einem charakteristischen Ablauf, der drei Phasen – Vorbereitung, Planung und Umsetzung – erkennen läßt. Die Phasen sind unterschiedlich ausgeprägt, und die Partizipation kann unterschiedlich intensiv sein.
Vorbereitungsphase
Alle Beteiligten sind mit der meistens sehr ungewohnten Situation, zum Mitreden eingeladen zu werden, vertraut zu machen und für eine aktive Mitarbeit zu motivieren. Auf die Aufforderung, sich an einem Gestaltungsprozeß zu beteiligen, gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen, die meist von den Erfahrungen geprägt sind, die die Leute bisher in Planungsprozessen und mit Behörden gemacht haben. Vorsichtiges Abwarten, Beobachten, oft auch Mißtrauen sind in dieser Phase häufig. „Ich habe bis zum heutigen Tage nicht geglaubt, daß Sie ernsthaft auf unsere Vorschläge eingehen würden!“, meinte eine Teilnehmerin des Planungskomitees Oeverseepark am Abend nach dem letzten Werkstattgespräch. Das Mißtrauen in die Institutionen sitzt tief – in der Regel umso tiefer, je städtischer das Einzugsgebiet ist. Hier ist man eher auf Kampf und Konflikt denn auf konstruktive Kooperation eingestellt. Die ersten Bemühungen gelten dem Ziel, eine Vertrauensbasis zwischen Beteiligten, Moderator und Projektträger herzustellen, wechselseitiges Verständnis für die oft divergenten Eigeninteressen aller Beteiligten zu erzeugen.
Planungsphase
Ist der Damm des Mißtrauens erst einmal gebrochen, folgt die für die PlanerInnen zumeist erfreulichste Phase, die von Engagement, Einsatz und Begeisterung geprägt wird und zumeist auch die PlanerInnen beflügelt, deren Freude wiederum die Beteiligten zu noch größerer Identifikation bewegt.
Ein positiver Aufschaukelungsprozeß beginnt. Hier kann auch am besten der Grundstein für eine langfristige Mitarbeit gelegt werden, hier übernehmen die Beteiligten selbst Verantwortung für „ihr“ Projekt und sind oft zu überraschendem Einsatz bereit. Vorsicht vor zuviel Euphorie ist jedoch geboten – zu diesem Zeitpunkt muß der Planer/Moderator darauf achten, nicht allzu hohe Erwartungen zu wecken, die dann in der Umsetzung nicht gehalten werden können. Hier wurde zum Beispiel von einer Untergruppe des Planungskomitees der Entschluß gefaßt, das Eröffnungsfest gemeinsam mit dem Büro des zuständigen Stadtrates vorzubereiten. Außerdem wurden vier Personen nominiert, die in der Umsetzungsphase den „schnellen Draht“ mit dem ausführenden Stadtgartenamt wahren.
Umsetzungsphase
Eine Möglichkeit der Beteiligung in dieser Phase ist die praktische Mitarbeit bei der Ausführung. Sie ist bei einfachen Arbeiten, die keine großen Fachkenntnisse erfordern, relativ leicht zu realisieren und fördert sowohl die Identifikation mit dem Projekt als auch die Kommunikation unter den Beteiligten. Sie wird umso schwieriger, je größer und technisch anspruchsvoller das Projekt wird. Beim gegenständlichen Projekt wird versucht werden, einzelne Teilprojekte in Arbeitseinsätzen abzuwickeln – etwa die Ausführung von Spielbereichen oder die Pflanzung von Gehölzen.
Eine große Bedeutung kommt in der Umsetzungsphase der Information der Beteiligten zu. Neben den gängigen Formen wie Aussendungen, Rundbriefe oder Berichterstattung in Medien sind hier vor allem alternative Methoden in Erwägung zu ziehen, beispielsweise Baustellenführungen, Etappenfeste, Kooperationen mit Radio und Fernsehen.
Räumliche und technische Einrichtungen
Die räumlichen Möglichkeiten und technischen Hilfsmittel, die in einem Beteiligungsprozeß zur Verfügung stehen müssen, werden in ihrer Bedeutung häufig unterschätzt.
Ein ausreichend großer, heller Raum mit flexibler Bestuhlung, der für die Beteiligten leicht zu erreichen ist und in der Nähe des „Tatorts“ liegt, ist ebenso wichtig wie die Sorge für das leibliche Wohl: Kühle Getränke zu heißen Diskussionen und ein gemütlicher, neutraler Ort zum Zusammensetzen nach der Arbeit. In Gries hat sich ein nahegelegener „Chinese“ zur Geburtsstätte vieler guter Ideen und produktiver Beziehungen entwickelt.
Genügend Papier und Schreibmaterialien, um alle Ideen und Beiträge festzuhalten sowie fixe und mobile Wände, um Ideen und Arbeitsergebnisse für alle sichtbar und die Arbeitsatmosphäre spürbar zu machen, fördern den Arbeitsfortschritt. Technische Hilfsmittel wie eine Lautsprecheranlage, ein Overhead- und Dia-Projektor helfen bei der Veranschaulichung von Gestaltungsabsichten oder Vergleichsbeispielen.
Konzept und Flexibilität
Ein Erfolgsgeheimnis für erfolgreiche Partizipationsverfahren ist eine klar durchdachte Vorgangsweise, ein Konzept, das möglichst alle Rahmenbedingungen berücksichtigt. Es ist eine Struktur zu schaffen, innerhalb derer die Beiträge und Wünsche der Beteiligten ihren Platz finden können. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, denn inhaltlich kann in diesem Rahmen ja sehr vieles offen bleiben.
Auf der inhaltlichen Ebene ist es wichtig, die Spielräume festzulegen und klarzustellen. Nichts ist frustrierender für engagierte BürgerInnen, als Ideen und Konzepte zu entwickeln und dann zu erfahren, daß die Hälfte davon nicht möglich ist. Im Fall Oeversee-Park traten im Zuge der Planung immer wieder Forderungen in Richtung Verkehrsberuhigung auf. Hier war es wichtig, klarzustellen, daß diese Forderungen zwar sachlich durchaus berechtigt sein mögen, aber im Rahmen dieses Planungsprozesses nicht gelöst werden können und daher auch nicht zuviel Zeit darauf verwendet werden kann.
Ein Konzept kann noch so gut durchdacht sein – im Laufe der Durchführung treten Überraschungen auf, Abweichungen vom Erwarteten. In diesen Situationen ist es wichtig, flexibel zu sein und den Prozeß an die neuen Bedingungen anzupassen. Dabei muß berücksichtigt werden, daß die Änderung, Streichung oder Einfügung eines Arbeitsschrittes fast immer auch Auswirkungen auf alle folgenden Arbeitsschritte hat. Der laufenden Aktualisierung des Konzepts, des Drehbuches kommt also größte Bedeutung zu.
Professionelle NutzerInnenbeteiligung – ein vielversprechender Weg
Ein partizipativer Planungsprozeß, der die Hebung der Planungsqualität zum Ziel hat, birgt eine Reihe von Chancen:
Die Qualität von Bestandsanalysen und Zielformulierungen kann beträchtlich gehoben werden. Eine bedarfsgerechte Planung wird dadurch gefördert.
Die NutzerInnen identifizieren sich stärker mit dem Planungsobjekt und übernehmen Verantwortung dafür. Dadurch können Aufwendungen für Pflege und Betreuung reduziert werden.
Die Planungssicherheit wird erhöht, das Risiko von zeitraubenden Umplanungen wird beträchtlich vermindert.
Jedes Beteiligungsverfahren ist ein wichtiger demokratiepolitischer Lernprozeß und stellt somit eine wertvolle Grundlage für den späteren Umgang mit Nutzungskonflikten dar.
Literatur:
DIENEL, P. C. (1978): Die Planungszelle. Der Bürger plant seine Umwelt. Opladen.
JUNGK, R., MÜLLERT N. (1989): Zukunftswerkstätten. München.