
Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Otterbach
St. Florian am Inn (A) - 2005
Architekturzentrum Wien
Architekturstudium an der TU Wien
Seit 1993 freischaffende Architektin in Linz
Seit 1995 Architekturkritiken für die OÖ Nachrichten und Beiträge über Architektur in verschiedenen Medien
2007 – 2021 Lehrtätigkeit an der HTL1 Goethestraße, Linz
2015 – 2021 Abteilungsvorstand Hochbau/Holzbau an der HTL1 Goethestraße, Linz
2001 – 2004 Vorsitzende des Fachbeirates für Architektur und Denkmalpflege im OÖ Landeskulturbeirat
2004 – 2006 Vorsitzende des architekturforums oberösterreich
2006 – 2015 Vorsitzende des Diözesankunstvereines der Diözese Linz
2010 – 2012 Vorsitzende des Fachbeirates für Architektur und Denkmalpflege im OÖ Landeskulturbeirat
2004 »Architektur in Oberösterreich seit 1980« Verlag Anton Pustet
2012 Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz für Architektur
2003 Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Architektur
2003 Oberösterreichischer Holzbaupreis (Auszeichnung für Landwirtschaftliche Fach- und Berufsschule Otterbach)
1998 Journalismuspreis der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg 1998
Oberösterreichischer Holzbaupreis 2003, Preisträger, Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Otterbach
Wenn sich Hotelgäste nicht in einem Labyrinth unbelichteter Gänge verirren, sondern dank natürlicher Belichtung die Orientierung bewahren, hat man ein Beispiel gelungener Architektur vor sich. So gefunden in Lech am Arlberg, verantwortet von Florian Aigner aus Linz.
Ursprünglich waren es nur ein paar Mitarbeiterräume, die der junge Linzer Architekt Florian Aigner dem Hotel Stäfeli in Lech am Arlberg hinzufügen sollte. Um mit dieser Maßnahme die zukünftige Entwicklung des Betriebes nicht einzuschränken, legte er mit dem geforderten Entwurf auch ein Erweiterungskonzept vor, das die Eigentümer von der Sinnhaftigkeit eines wesentlich größeren Eingriffs überzeugte. Er erhielt den Auftrag, mit 16 neuen Gästezimmern die Kapazität des Hotels fast zu verdoppeln und bei dieser Gelegenheit die gesamte Anlage neu zu ordnen. Im Team mit seinen Eltern, Rudolf und Ines Aigner und ihrem Büro Aigner + Partner, ist es ihm gelungen, eine Herausforderung vorbildhaft zu meistern, die vielen Hotels im alpinen Raum bekannt sein dürfte.
Diese meist mit hohem persönlichen Engagement ihrer Eigentümerfamilien geführten Betriebe haben sich den steigenden Nächtigungszahlen der vergangenen Jahrzehnte und den wachsenden Qualitätsansprüchen ihrer Gäste gleichermaßen gestellt. Wo früher ein Waschtisch im Zimmer und ein WC pro Stockwerk denkbar waren, sind eigene Sanitärzellen für jeden Gast heute eine Selbstverständlichkeit. Man bietet, um im Wettbewerb zu bestehen, zumindest einen sogenannten Wellnessbereich, den, wenn möglich, ein Schwimmbad ergänzt. Das alles hat man nach bestem Wissen errichtet und steht am Ende ohne jeden bösen Vorsatz vor Anlagen, die man selbst unter weitgehender Zurücknahme gestalterischer Ansprüche so niemals neu bauen würde. Da explodieren die Gebäudeproportionen, wuchern die Dachlandschaften, und so mancher Gast wünscht sich im Labyrinth unbelichteter Gänge einen Faden, der ihm den Weg von der Heukraxensauna zum Kaffeestübchen weisen möge.
Nun war es mit dem Hotel Stäfeli längst nicht so weit gekommen. In Lech achtet schon die Baubehörde erster Instanz, die Gemeinde, auf die Balance des Ortsbildes. Gerade die Ortschaft Zug, in der das Stäfeli liegt, hat den Charakter des bäuerlichen Dorfes gewahrt. Umso vernünftiger war der Vorschlag Florian Aigners, die Erweiterungsflächen des Hotels in einem Zubau unterzubringen, der als eigenständiges Gebäude lesbar sein und so die Maßstäblichkeit des Ortes wahren würde.
Da mit seiner Errichtung die bereits in früheren Erweiterungsphasen eingeleitete Verschiebung des Nutzungsschwerpunktes hinauf in den Hang ein weiteres Mal verstärkt wurde, lag die Bereinigung der Eingangssituation nahe. Der bisherige Eingang auf der untersten Ebene wurde aufgegeben, wodurch die Hotelgäste der Notwendigkeit enthoben wurden, an dem auch für externe Besucher geöffneten Restaurant vorbei über eine wenig einladende Stiege hinauf ins Hotel zu steigen. Der Haupteingang befindet sich nun ein Geschoß höher an der Westseite und gibt über einen gläsernen Windfang den Weg zu einer von Tageslicht erhellten Rezeption frei. Hier hat ein weiterer, nicht nur im Hotelbau häufig vernachlässigter Aspekt Beachtung gefunden: die Wohltat natürlicher Belichtung von Erschließungsflächen und die durch einen Außenraumbezug wesentlich verbesserte Orientierung darin. Indem Florian Aigner eine kleine Sonnenterrasse an der straßenseitigen Grundgrenze aus dem Hang bricht, verschafft er dem Haupteingang des Hotels einen angemessenen Vorplatz und belichtet neben der im Bestand angeordneten Rezeption auch ein neues, dem Aufenthalt der Gäste dienendes Kaminzimmer sowie die ebenfalls neue Schwimmhalle. Beide sind im untersten Geschoß des Erweiterungsbaus untergebracht, der sich erst zwei Geschoße darüber als schlichter dreigeschoßiger Körper aus dem nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in seinem natürlichen Verlauf hergestellten Gelände erhebt.
Eine zweite, ähnlich motivierte Maßnahme wirkt sich ebenso deutlich auf die Qualität der angrenzenden Räume aus. Sie schafft dem bestehenden Saunabereich wie seiner Erweiterung im Neubau Licht und Luft und gewährleistet die Belichtung der Mitarbeiterzimmer im Geschoß darüber. Für die 16 im Neubau untergebrachten Hotelzimmer muss die Belichtung freilich mit einer direkten Verbindung zum Landschaftsraum einhergehen. Die über die gesamte Südseite gezogenen Balkons der beiden Obergeschoße, die darunter geschützt liegende Terrasse im Erdgeschoß und zwei in die Ost- und die Westfassade geschnittene Loggien machen aus allen Zimmern des äußerst kompakt angelegten Traktes tatsächlich Zimmer mit Aussicht.
Der Verzicht auf Trennwände in den Balkons unterstreicht den Eindruck eines breit geöffneten Horizontes, der als Motiv auch in den zu horizontalen Feldern verbundenen Fenstern der Stirnseiten anklingt. Das Haus nimmt mit seinem parallel zum Hang liegenden Satteldach die Dachneigung und Richtung seiner Nachbarn auf. Die erdberührten Wände sind grau verputzt, jene der frei liegenden Geschoße mit Holz verkleidet. So lautete nicht zuletzt die Vorschrift der Gemeinde. Diese Vorgaben in heute gelebte Architektur zu übersetzen war Florian Aigner besonders wichtig. Er hat sich gegen den zuletzt gebräuchlichen Überzug aus Holzschindeln und für eine horizontal gegliederte Verkleidung aus dunkel gebeiztem Lärchenholz entschieden. Die hellen Holzbalkons und die ebenfalls hellen Fensterfelder gliedern den Baukörper in schlichter, gut lesbarer Weise.
Dem so selbstverständlich anmutenden Erscheinungsbild des Hauses liegt eine aufwendige Detailentwicklung zugrunde. Die Kooperation mit lokalen Handwerksbetrieben war folglich für den jungen Architekten ein besonderes Erlebnis. Trotz größten Termindrucks machten sie seine Anliegen in technischer wie in gestalterischer Hinsicht zu den ihren und setzten anspruchsvolle Elemente wie etwa ein durch alle Geschoße gefädeltes Stiegengeländer oder ein multifunktionales Möbel für die Hotelbar vorbildlich um. Auch die Kunst des Konstrukteurs soll an dieser Stelle nicht vergessen sein: schon die Ausbildung des schlanken Dachrandes ohne sichtbare Sparrenlage forderte angesichts der vorgeschriebenen Auskragung und der ortsüblichen Schneelasten Rudolf Aigner beträchtlichen konstruktiven Einfallsreichtum ab; um gar nicht von der in den Hang gesetzten Stahlbetonkonstruktion zu sprechen, die einem fest gefügten künstlichen Berg gleicht und dennoch das Licht tief in ihr Inneres lenkt.
Wenn Architektur ein tragfähiges wie inspirierendes Umfeld für Arbeit schafft: ein Besuch im Mühlviertler Schwertberg.
Oesterreich baut auf seine Unternehmen: Sie schaffen Arbeit, sie zahlen Steuern, sie halten den Kreislauf der Wirtschaft in Schwung. Unternehmen bauen Österreich, auch im direkten Sinn des Wortes. Wer durch ein Gewerbegebiet in eine Stadt oder in ein Dorf einfährt, bemerkt schnell, dass in diesem Teil unserer Lebenswelt Gestaltung keine tragende Rolle spielt. Nun ist es einigermaßen wohlfeil, sich über das Fehlen städtebaulicher Konzepte für diese Zonen in ihrer Gesamtheit ebenso zu mokieren wie über die Scheußlichkeit des einzelnen Objektes. Es wird Ihnen kaum jemand widersprechen. Die zuständigen Gemeinden aber werden in Gedanken an das Steueraufkommen stumm die Achseln zucken, und der eine oder andere Firmenchef wird Ihnen versichern, dass er mit seinem eigenen Geld baut, wie er es für richtig hält. Punkt. Ende der Diskussion.
Zum Glück gibt es auch Unternehmen, die dem qualitätsvollen Bauen einen hohen Rang einräumen. Für die Firma Engel mit ihrem Stammhaus im oberösterreichischen Schwertberg etwa ist die Planung der Firmengebäude auf gestalterisch hohem Niveau Teil der Unternehmenskultur. Die Repräsentation nach außen, ein Anliegen, das auch weniger Architektur-affinen Entscheidungsträgern geläufig wäre, steht hier nicht im Vordergrund. Vielmehr halten die Eigentümer des zu hundert Prozent im Familienbesitz stehenden Weltmarktführers für Spritzgießmaschinen nun schon in der vierten Generation an der Überzeugung fest, dass Architektur in der Lage ist, ein ebenso tragfähiges wie inspirierendes Umfeld für erfolgreiches Arbeiten zu schaffen. Der jeweilige Zugang zum konkreten Bauvorhaben – Engel hat neun Produktionswerke in Europa, Nordamerika und Asien sowie zahlreiche Niederlassungen weltweit – ist stets ein anderer.
Auch das Stammhaus in Schwertberg hat sich seit seiner Gründung 1945 stark verändert. Es ist mit dem Betrieb gewachsen, hat sich jedoch dank ordnender Eingriffe zur rechten Zeit nie zu einer jener heillos heterogenen Strukturen entwickelt, in denen so viele Betriebe ihr baukulturelles Desinteresse unter Beweis stellen. Die in der Firmenchronik gesammelten Bilder zeigen das Werkin jeder Epoche als ein in sich stimmiges Ganzes, das ein angemessenes Arbeitsumfeldmit einem gediegenen Auftritt nach außen verbindet. „Unser Anspruch an Qualität, Innovationskraft und Offenheit spiegelt sich in unserer Architektur wider“, fasst Stefan Engleder, CEO der Engel Holding, die Haltung der Eigentümer zusammen.
Die vorläufig letzte Anpassung der Anlage wird nun vom Linzer Architekturbüro Riepl Riepl Architekten betreut. Das Werksgelände liegt in fußläufiger Distanz südlich des Zentrums von Schwertberg. Es wird im Süden von der Bahn, im Norden und Osten von Straßen und im Westen von der Aist begrenzt, die mit ihren Hochwässern schon manchen Schaden verursacht hat. Dass Engel den Standort dennoch nie in Zweifel gezogen, sondern lieber in effizienten Hochwasserschutz investiert hat, ist nicht nur der Ortsverbundenheit der Eigentümerfamilie zu verdanken. Man weiß eben den Wert einer besonders wichtigen und beileibe nicht überall verfügbaren Ressource zu schätzen: eines soliden Stammes gut ausgebildeter Mitarbeiter. Diese Hinwendung zum Ort ist an dem jüngst fertiggestellten, „Halle Nord“ genannten Objekt der Riepl Riepl Architekten deutlich ablesbar. Die in der Grundfläche etwa 90 mal 22 Meter messende, zwölf Meter hohe Halle erweitert den Produktionsbereich der Anlage zur nördlichen Grundgrenze hin. Sie wurde als konstruktiver Stahlbau auf einer monolithischen Stahlbeton-Bodenplatte errichtet, wodurch eine variable Aufstellung der schweren Maschinen möglich ist. Die gesamte Nordseite ihrer schwarz glänzenden, aus hochwertigen Aluminium-Verbundplatten gefertigten Hülle öffnet sich über einem geschlossenen Sockelgläsern zu der etwas erhöht vorbeiführenden Straße. Dem daraus gewonnenen Einblick in den von seiner Konstruktion und denBeleuchtungskörpern strukturierten Raum entsprechen die Sicht der Mitarbeiter in den Ort und die umgebende Landschaft.
Im Inneren der Halle wiederum werden in der geschlossenen Außenwandzone die Leitungen sämtlicher Medien wie Strom, Druckluft, Öl oder Maschinenkühlung hinter textilen Vorhängen geführt. So sind sie an jeder gewünschten Stelle zum Anschluss an die Maschinen verfügbar, ohne die Ordnung des Arbeitsumfeldes zu stören.
Alle in der Halle Nord sehr deutlich zum Ausdruck gebrachten Qualitäten sind der Anlage eingeschrieben: das über die (zahlreichen) Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz weit hinausgehende Bemühen um eine angenehme, Kreativität und Leistung fördernde Stimmung der Räume, die Weltoffenheit oder das Bekenntnis zu neuen Technologien, hochwertigen Materialien und gediegener Verarbeitung. Das zeigt sich nicht nur in jenen Bereichen, die man auf den ersten Blick mit dem Begriff Architektur in Verbindung bringen würde. So verfügt etwa die von Riepl Riepl Architekten im südlichen Erweiterungstrakt des Produktionsbereiches geplante Lehrwerkstätte nicht nur über höchst moderne Maschinen, sondern bietet den jungen Menschen überdies einen großzügigen, hellen und luftigen Raum, der unter anderen Ausblicken den Sichtbezug in eine neue Erschließungsachse des Unternehmens herstellt.
Diese Achse entsteht gerade im Zuge einer Erweiterung des Bürotraktes an der östlichen Flanke des Firmengeländes, den Klaus Kada seinerzeit als Gewinner eines geladenen Architektenwettbewerbes konzipierte. Mit seiner mehrgeschoßigen, von einem plastisch durchgeformten Auditorium flankierten Eingangshalle und den transparent geteilten, um begrünte Innenhöfe gruppierten Büros lädt es nicht zuletzt die Kunden der Firma Engel ein, sich als Teil eines vielfältigen wie funktionstüchtigen Ganzen zu fühlen. Das Bürogebäude wird von Riepl Riepl Architekten erweitert und begradigt nun die südliche Kante des Gesamtkomplexes. Hier ist noch Baustelle.
Ein wichtiges Element darin ist jedoch fertig und in Betrieb: die „Kleinen Engel“. In zwei hellen Gruppenräumen mit Ruheraum, dem an einen Spielgarten gekoppelten Bewegungsraum und den entsprechenden Nebenräumen tauchen die Kinder der Mitarbeiter in die Arbeitswelt ihrer Eltern ein, bevor sie mit drei Jahren alt genug sind, in einen Kindergarten einzutreten.
Besuch in Marchtrenk, Oberösterreich: Die Stadtbevölkerung ist sehr zufrieden mit dem Neubau des alltagstauglichen Veranstaltungszentrums, bestehend aus Musikschule und Kulturzentrum. Ein schönes Kompliment an das Welser Architekturbüro Luger & Maul.
Marchtrenk: Wer die offizielle Internetseite der mittlerweile größten Stadt des Verwaltungsbezirks Wels-Land aufruft, gelangt mit zwei Mausklicks an eine Videobotschaft, in der ein namhafter Kabarettist die Worte „Marchtrenk“, „noch nie gehört“ und „Kaff“ in einem Satz unterbringt; der digitale Weg zu einem Rückblick auf das Jahr 2016 ist aber ebenso kurz und komfortabel. Wenn man diesem in Bildern, Fernsehmeldungen und Interviews gefassten Bericht Glauben schenkt, war 2016 für Marchtrenk ein gutes Jahr. Einen wichtigen Platz in diesem Rückblick nimmt, nicht nur als Hintergrund zahlreicher festlicher Ereignisse, der vom Welser Architekturbüro Luger & Maul geplante Neubau des Veranstaltungszentrums ein.
Genau genommen ist es der Neubau zweier Anlagen, den das Büro Luger & Maul schon im Jahr 2009 im Rahmen eines Architektenwettbewerbes entwickelt hat: der dem Land Oberösterreich zuzuordnenden Musikschule Marchtrenk und des Kulturzentrums der Gemeinde. In der seither über uns hereingebrochenen und nach wie vor nicht überwundenen Ära der leeren Kassen schien die Realisierung des Projekts zunächst unmöglich. Um den immer drängender werdenden Raumbedarf der Musikschule zu decken, wurde sogar über die Errichtung eines halbierten, mit Feuermauern provisorisch abgeschlossenen Gebäudes nachgedacht.
Glücklicherweise setzten sich Vernunft und Optimismus durch, sodass die im Projekt angelegte gegenseitige Ergänzung und Stärkung der beiden Kultureinrichtungen heuer gebaute Wirklichkeit werden konnten. Die Notwendigkeit zu eiserner Budgetdisziplin aber hat das Büro Luger & Maul in eine Vielzahl von Maßnahmen übersetzt, die unter einem Motto zusammengefasst werden könnten: sparen, wo es möglich ist, doch keinesfalls zulasten der Baukultur. Diese Grenzen des Gerade-noch-Möglichen auszuloten ist ein spannendes Unterfangen für ein Architekturbüro, jedoch nicht unbedingt lohnend. Denn mit disziplinierter Selbstbeschränkung kann man die Fachwelt nicht verblüffen; das Laienpublikum hat auch schon Spektakuläreres erlebt; und viele, viele Stunden sind in Überlegungen investiert, deren Ergebnisse man unter Umständen gar nicht sieht.
Vor diesem Hintergrund ist die rückhaltlose Zufriedenheit der Stadtbevölkerung mit ihrem neuen Veranstaltungszentrum ein schönes Kompliment an die Architekten, das sicher großteils der Funktionstüchtigkeit der Anlage gezollt wird. Der Bauplatz des neuen Veranstaltungszentrums liegt unweit des Kerns von Marchtrenk, sofern man diesen in der Gegend des Stadtamtes oder der katholischen Pfarrkirche verortet. Der Neubau teilt sich ein Grundstück mit seinem Vorgänger, dem Volkshaus Marchtrenk. Dieses Mahnmal seiner Entstehungszeit sollte eigentlich längst abgebrochen sein; als von den Vereinen Marchtrenks hochgeschätztes, da unverwüstliches Gehäuse von Aktivitäten aller Art wird es aber wohl noch eine Weile zwischen dem neuen Veranstaltungszentrum und der Hauptschule auf der Südseite der Goethestraße stehen. Den Auftritt des Neubaus schränkt dieser Umstand kaum ein: Das Büro Luger & Maul hat die beiden Nutzungsbereiche in einem zweigeschoßigen Baukörper organisiert, der mit seinem Volumen und dem annähernd quadratischen, um einen Innenhof gruppierten Grundriss das Motiv des für den Landstrich typischen Vierkanthofes aufgreift. Die Musikschule und das Kulturzentrum haben jeweils einen eigenen Haupteingang, die beide in einer von schlanken Stützen getragenen Loggia liegen. Die Loggia erstreckt sich über die gesamte Ost- und Südseite des Gebäudes und sichert insbesondere dem Veranstaltungsbereich durch das Verschwenken der Fassade ein vom geplanten Abbruch des Volkshauses unabhängiges, großzügiges Vorfeld und eine klar herausgearbeitete Eingangssituation.
Die Anlage ist augenscheinlich einfach, mit einer hohen Dichte an Überlegungen für das reibungslose Ineinandergreifen der verschiedenen Funktionen entwickelt. Die gesamte Westseite des Gebäudes wird vom großen, über zwei Geschoße reichenden Veranstaltungssaal mit dem vorgeschalteten Foyer eingenommen. An der Südseite liegt, ebenfalls zweigeschoßig und vom Foyer aus erreichbar, ein kleinerer Saal, der von der Schrägstellung der Fassade in diesem Bereich akustisch profitiert. Direkt gegenüber öffnet sich der daran grenzende Erschließungsgang zum dritten großen Volumen des Hauses, dem Innenhof. Sein gekiester Boden senkt sich leicht nach Süden hin; von Bäumen beschattete Sitzstufen, ein Podest auf der einen und ein Balkon auf der anderen Stirnseite laden zu Aufführungen im Freien ein. Die Bühnen der beiden Säle liegen, über kurze Rampen erschlossen, auf einer Ebene, was den Transport schwerer Instrumente beträchtlich erleichtert. Im nördlichen und im östlichen Trakt des Gebäudes sind Unterrichtsräume angeordnet; die beiden Längsseiten des Hofes werden ebenfalls von Unterrichts- und Nebenräumen gesäumt. Musikschule und Kulturzentrum können voneinander getrennt und die Säle von beiden Einrichtungen bespielt werden.
Den auf umfassende Alltagstauglichkeit zielenden Raumfolgen des Veranstaltungszentrums entspricht ein Gestaltungskonzept, das ebenfalls recht alltäglich daherkommt mit den weiß verputzten Wänden, grauen Keramikböden und nüchternen Stabgeländern. Dennoch sind Beispiele nachlässig hingeworfenen billigen Bauens mit dieser sparsamen Architektur nicht vergleichbar. Hier wurde alles weggelassen, was nicht nötig gewesen wäre. Notwendig waren: klare Wegführung und Orientierung im Haus; Zonen für Ruhe und für Bewegung; gut proportionierte, von Tageslicht erhellte, akustisch einwandfrei funktionierende Räume; flächenbündige Türen aus geweißter Eiche; Eichenböden; putzbündig verlegte Sockelleisten und Fensterbänke; der in Eichenholz gefasste kleine Saal; der mit Kiefer, dem typischen Gehölz der Welser Heide, akustisch wirksam verkleidete große Saal; der breite Blick ins Freie aus beiden Sälen; die Stiege zur Galerie im gläsernen Erker; die sorgsame Komposition der Körper und Fassaden; die mit ihrer Metall-Ummantelung in den Himmel gespiegelte Haustechnik; der fein geglättete Außenputz; die zarten Stützen auf flächenbündigen Edelstahlsockeln; der filigrane Rand des Daches.
Kurzum: ein wahrhaft kultiviertes Haus, intelligent und sorgfältig gearbeitet, das den kulturellen Anspruch der Stadt mit anmutiger Selbstverständlichkeit auf eine neue Ebene hebt, ohne sein Umfeld zu beschämen.
„Manchem erscheint es vielleicht hausbacken, den ,bloßen‘ Komfort des Benützers für einen gedanklichen Inhalt der Architektur zu nehmen. In Wahrheit muss sich gerade, wer dazu nicht bereit ist, einen inferioren Architekturbegriff vorwerfen lassen.“ Hermann Czech zum 80. Geburtstag: eine Textcollage.
Bitte fragen Sie nicht: Was ist Architektur? Die meisten Antworten haben das Potenzial, selbst Fachleuten den Blick zu trüben. Fragen Sie lieber: „Was kann die Architektur leisten?“ Hermann Czech, aus dessen umfangreichem publizistischem Werk diese und alle hier folgend zitierten Textstellen übernommen sind, umreißt die Grenzen der Architektur sehr klar: „Sie wird nicht unsere politischen, unsere sozialen, ja nicht einmal unsere Umweltprobleme lösen, so wenig wie die Musik unsere Lärmprobleme lösen wird.“
„In den 70er-Jahren glaubten Architekten noch, die Welt würde an ihren Utopien genesen. ,Architektur ist nicht das Leben. Architektur ist Hintergrund. Alles andere ist nicht Architektur‘, habe ich 1971 geschrieben. Das heißt aber nicht, dass sie unscheinbar sein muss, sie kann durchaus präzis oder markant sein. Hintergrund heißt auch, dass man sich daran lehnen kann — und dass er hält.“ Es wäre ein Wunder, hätte Hermann Czech da nicht an eine Haltbarkeit in mehr als einem Sinn gedacht. „Je dichter am Leben die Architektur bleibt, desto komplexer ist sie; ,einfach‘ kann sie nur werden, indem sie davon abhebt.“ Der Umgang mit Komplexität will jedoch gelernt sein. „Das Prinzip der Delegation – jedem Yuppie geläufig – kommt in der Bauherrensituation, die ja die meisten selten im Leben einnehmen, schwer an. Es bedeutet: vorgeben, was man will, aber nicht wie.Der Bauherr kann sich auf Überblick und Kontrolle zurückziehen, muss aber zugleich akzeptieren, dass die Lösung des Architekten etwas Unvorhergesehenes ist – übrigens ohnehin auch für den Architekten selbst.“
Diese Lösung ist allerdings nicht unvorhersehbar, weil sie das Produkt eines „Einfalles“ wäre. Im Gegenteil: Schon als Jugendlicher in den Salzburger Sommerakademie-Seminaren von Konrad Wachsmann darin geschult, Planungsentscheidungen auf methodischem Weg zu erarbeiten, sieht Hermann Czech „die formale Vorstellung nicht am Anfang, sondern am Schluss des Entwurfsprozesses“: „Es muss wohl jeder lernende Architekt eine Methodik finden, die es ihm zunächst erlaubt, auf vordergründig Hübsches, auf die Motive aus den Zeitschriften zu verzichten und eine gedankliche Basis zu gewinnen.“ Man muss also zu einem systematischen „Denken zum Entwurf“ gelangen: „Architekturtheorie, die bei Entwurfsentscheidungen helfen soll, kann nicht im Metaphorischen stehen bleiben. Sie muss bei der Ausbildung einer Ecke, bei der Wahl einer Farbe, bei der Form eines Handlaufs, bei der Vorstellung einer Stadt brauchbare Kriterien bieten. Fast alles hat mit alltäglichen Vorgängen, dem Befinden von Benutzern zu tun.“
Tatsächlich ist Hermann Czech an unterschiedlichste Bauaufgaben, den Wohnbau, den Schulbau oder den Hotelbau, die städtebauliche Studie, die Ausstellungsgestaltung oder an seine vielen Interventionen im kleinen und kleinsten Maßstab stets unter der Voraussetzung herangetreten, „konkret in der Situation und nicht abstrakt in Regeln zu denken“: „Das sind die tragenden Aspekte: Architektur als Hintergrund — Umbau — Heterogenität, die Triviales einschließt — und Komfort. Der Umbau ist ein architekturtheoretisch wichtiges Thema; vielleicht das zentrale überhaupt — weil im Grunde alles Umbau ist. Dabei stellt sich die Frage der Annäherung an das Vorhandene. Wird dem Vorhandenen ein Neues, Anderes entgegengesetzt, oder handelt es sich um eine Fortsetzung des Vorhandenen mit anderen (oder gar gleichen) Mitteln? Es scheint, dass der Umbau beides enthalten muss und dass die Fortsetzung des Vorhandenen in der Bildung einer neuen Einheit auf höherer Ebene besteht. In jedem Umbau gibt es Erfordernisse, die es nahelegen, gegen den Bestand zu operieren, ihn zu konterkarieren — gleichwohl oder gerade dann können der Bestand oder seine wesentlichen Gedanken spürbar bleiben.“
Sollten Sie, werte Leserin, geschätzter Leser, sich für die Diskussion architekturtheoretischer Feinheiten nicht erwärmen können: Der Komfort – oder vielmehr seine Abwesenheit – geht Ihnen sicher unter die Haut. Auch in dieser Hinsicht haben Sie in Hermann Czech einen leidenschaftlichen Verteidiger Ihrer Interessen: „Wenn die moderne Architektur mit der Verheißung angetreten ist, dass das Leben leichter würde, so hatte das zwei Tendenzen: Mit der entwickelten Technik würde uns alle unschöpferische Arbeit durch Maschinen abgenommen — und mit dem verpönten Ornament würde physisch und psychisch aller kulturelle Schutt wegfallen, der uns bei der Selbstverwirklichung im Wege lag. Wann ist diese umfassende Konzeption des Komforts eigentlich verloren gegangen? Komfortverlust ist die ärgerlichste Begleiterscheinung des Wandels. Wenn wir Architekten schon in jeder Generation das Rad neu erfinden müssen, sollten wir dazusehen, dass es nicht zunächst immer eckig ist.“
„Ich sehe mich nicht als Spezialisten der Gastronomie-Architektur.“ Viel näher liegen Hermann Czech zurzeit städtebauliche Fragen; etwa warum man in Wien gar so stolz darauf ist, die Blockstrukturen der Gründerzeit zu zerstören. „Aber es ist richtig, dass es kaum eine andere Aufgabe gibt, bei der man so direkt am Benutzer arbeitet und so unmittelbar Erfolg oder Misserfolg eines Konzepts oder eines einzelnen Gedanken registrieren kann. Themen, die in der Architektur oft nur symbolisch abgehandelt werden, etwa der Schwellenbereich des Eingangs, Licht und Dunkelheit, die räumliche Kommunikation, der Bezug zum menschlichen Maß (ob ich mein Glas noch auf ein Gesims stellen kann oder nicht) – all das kommt in einem Lokal ganz konkret und handfest vor. Trotzdem ist es immer eine Gratwanderung. Nur eine Ausstattungsfirma weiß vorher, wie das Lokal ausschauen wird – nämlich uninteressant. Das Unvorhergesehene muss sich zu etwas Selbstverständlichem verdichten, so selbstverständlich, dass dem Gast als höchstes Kompliment die Frage bleibt: Dafür haben Sie einen Architekten gebraucht?“
Diesen Schritt in den Hintergrund fordert Hermann Czech für alle Bauaufgaben ein. Dass er sich damit als Gegner einer „Star-Architektur“ positioniert, „von der ein Großteil dereinst sehr alt ausschauen wird“, erschreckt ihn nicht. „Manchem erscheint es vielleicht hausbacken, den ,bloßen‘ Komfort des Benützers für einen gedanklichen Inhalt der Architektur zu nehmen. In Wahrheit muss sich gerade, wer dazu nicht bereit ist, einen inferioren Architekturbegriff vorwerfen lassen.“
Hermann Czech feiert dieser Tage ein Jubiläum. Wenn Sie gratulieren wollen: Sie finden ihn in seinem Atelier in der Wiener Singerstraße – sollte er nicht gerade auf einer Baustelle unterwegs sein.
Viel neuer Platz in Wien und Niederösterreich: Pointner/Pointner Architekten zeichnen verantwortlich für die Sanierung der Pfarrkirche Wien-Essling sowie für das neue Pfarrheim der Kirche Großebersdorf.
Nähert man sich Großebersdorf von Süden her, ist es der schlichte Bau der katholischen Pfarrkirche, der das Profil der Marktgemeinde prägt. Ihr unmittelbares Umfeld mit seinen schmalen, an den Gabelungen zu kleinen Plätzen erweiterten Gassen und dem Ineinandergreifen von bebautem und landwirtschaftlich genutztem Raum ist charakteristisch für den Ort. Diese Stimmung hat Helmut Pointner, einer der in Wien und Freistadt arbeitenden Brüder Pointner/Pointner Architekten, im Erweiterungsbau desneben der Kirche gelegenen Pfarrhofes eingefangen und behutsam verdichtet.
Der Neubau macht aus einem Freiraum zwischen dem historischen Pfarrhaus im Süden, den daran schließenden ehemaligen Stallungen im Westen und einem an der östlichen Hangkante stehenden Presshaus einen windgeschützten Hof. Der Erweiterungsbau umfasst einen Pfarrsaal, zwei Jugendräume und ein verbindendes Foyer. Ein neuer, den Anstieg der Pfarrhausgasse ausgleichender Zugang führt am sanierten, Küche und Sanitärräume fassenden Westtrakt entlang und erschließt das Pfarrheim barrierefrei. Unter Berücksichtigung der Topografie hat Helmut Pointner das Gebäude hangseitig als Massivbau, zum Hof hin jedoch als konstruktiven Holzbau entwickelt. Er übernimmt mit dem Foyer und den Jugendräumen die Traufenkante des historischen Bestandes; der Pfarrsaal ragt darüber hinaus und bildet so die markante Nordostecke der Anlage.
Betritt man das Pfarrheim über seinen Haupteingang, fällt der Blick aus dem Foyer gleich in den Hof, den Helmut Pointner mit einer wassergebundenen Decke, einem die Hauskanten fassenden Traufpflaster und einer Ulme in der Mitte gestaltet hat. In der Nische linker Hand, aus der sich die zwei Türen zu den Jugendräumen öffnen, hat die Teeküche, Voraussetzung für Geselligkeiten, Platz gefunden. Auch die kleine, professionell eingerichtete Küche im Westtrakt ist über eine Durchreiche mit dem Foyer verbunden. Es sind wohl funktionale Zusammenhänge dieser Art, die zunächst das Herz der Pfarrgemeinde für die Architektur gewonnen haben. Die Alltagstauglichkeit des neuen Pfarrheimesist jedoch nicht nur einem vernünftigen Grundriss, angenehmen bauphysikalischen Eigenschaften und klug gewählten haustechnischen Einrichtungen wie einer automatischen Nachtlüftung geschuldet.
Mit der Wahl der Materialien hat Helmut Pointner das notwendig Robuste des Hauses betont; mit seiner sorgfältig detaillierten Bearbeitung verfeinert er es zu etwas Besonderem, das aus dem Alltag in jene Sphären reicht, in denen die Kultur zu Hause ist. Die massiven Wände des Neubaus sind Hohlwände aus Beton, industriell gefertigte Massenware also, die nach dem Versetzen sandgestrahlt wurden. Außen gedämmt und verputzt strahlen die raumhohen Elemente in ihrem Ebenmaß nach innen Beständigkeit und Ruhe aus. Ihre Öffnungen sind sparsam und mit Bedacht gesetzt: zwei Ausgänge in den Garten an der Ostseite, ein Blick auf den neuen Zugang aus dem Jugendraum und zwei einander gegenüberliegende Fenster im Pfarrsaal, die den Bezug zur Kirche und zum Gemeindeamt herstellen.
An der Südseite des Saales bildet, mit fünf schlanken Holzstützen von diesem abgesetzt, ein in Fortsetzung des Foyers angelegter, niedrigerer Raum einen aus Holz und Glas komponierten Filter zum Innenhof. Verschiebbare hölzerne Sonnenschutzelemente und großzügige gläserne Schiebetüren erlauben die Dosierung des Außenraumbezuges. Zwischen den Rahmen des Holzbaus sorgt eine akustisch wirksame Holzlattung in Pfarrsaal und Foyer für gute akustische Bedingungen. Unter der Decke des Saales stellen drei filigrane Lichtlinien die Allgemeinbeleuchtung her, die bei Bedarf durch diskret über die Zwischenräume der Deckenlattung versorgte Strahler ergänzt werden. In den Jugendräumen dämmt eine mobile, mit Schafwollmatten belegte Trennwand den Schall.
Die Offenheit, mit der sich die Pfarrgemeinde auf Neues, Ungewohntes eingelassenund in ihrem Pfarrheim konsequent verwirklicht hat, ist einerseits dem engen Kontakt zum Architekturbüro zu verdanken; andererseits soll an dieser Stelle die Beratungstätigkeit des Bauamtes der Erzdiözese Wien unter der Leitung von Harald Gnilsen nicht unerwähnt bleiben. Das von seiner Fachkompetenz getragene Bekenntnis der Erzdiözese, ihren breit gefächerten Immobilienbestand nicht zuletzt unter Mehrung seines kulturellen Wertes zu pflegen, sichert der katholischen Kirche eine vom unmittelbar Religiösen unabhängige Möglichkeit zur Gestaltung der Welt.
In einem zweiten, demnächst fertiggestellten Projekt von Helmut Pointner kommt die positive Wirkung eines seitens der Kirche unternommenen Bauvorhabens auf sein Umfeld besonders gut zur Geltung: Die Pfarrkirche in Wien-Essling hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im 19. Jahrhundert als Kapelle für das auf der gegenüberliegenden Seite der Esslinger Hauptstraße gelegene Schloss errichtet, wurde sie in den 1930er-Jahren erweitert und schließlich 1988 durch einen Einbau verengt und verfinstert. Das von der Erzdiözese zur Sanierung der Kirche ausgeschriebene Gutachterverfahren konnte Helmut Pointner mit einem Projekt für sich entscheiden, das den Rückbau des Hauptschiffes auf den großzügigen Raum der Zwischenkriegszeit unter Beibehaltung seines Dachstuhles vorsah. Sein Entwurf öffnet überdies die Nordflanke des Hauptraumes zu der von allerlei Einbauten befreiten Kapelle. Durch das Vorrücken des Altars in den Kreuzungspunkt der beiden Schiffe dient sie nun gleichzeitig als Kirchenerweiterung und Werktagskapelle. Schmale Fenster, von der Künstlerin Ingeborg Kumpfmüller mit zart gefärbten Schriftzügen gestaltet, rhythmisieren und erhellen das Hauptschiff.
Die Ostflanke der Werktagskapelle öffnet sich, geschützt hinter vertikalen Holzlamellen, auf einen Platz, dessen Entstehung einigen glücklichen Fügungen zu verdanken ist. Wo bisher eine mit Koniferen bewachsene, von Autos gesäumte Brache lag, hat Helmut Pointner nun einen kleinen befestigten Platz geschaffen, aus dessen Mitte sich ein Laubbaum erhebt. Er wird an seinen freien Kanten von einer Stahl-Holz-Konstruktion gefasst, die den Haupteingang auf der einen und den Zugang zur Kapelle auf der anderen Seite beschirmt. Der Platz liegt zur Gänze auf öffentlichem Gut, wurde in Zusammenarbeit mit dem Magistrat der Stadt Wien errichtet und gibt dem Straßendorf Essling, was es dringend benötigt: vielfach nutzbaren öffentlichen Raum.
Das oberösterreichische Büro „Two in a box“ hat schon ein breites Spektrum von Bauaufgaben gelöst: mit Einfühlungsvermögen, ökologischem Bewusstsein – und Verständnis für Budgetvorgaben.
Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Scheren aller Art öffnen sich. Die Ungleichheit nimmt zu. Diese Entwicklung ist selbst im Baugeschehen zu beobachten. Eine angesichts der überschaubaren Größe Österreichs überraschend fruchtbare Produktion baukultureller Spitzenleistungen wird zwar international hochglänzend reflektiert; doch die erdrückend große Mehrheit unserer gebauten Umwelt folgt, vom Anspruch der Hochkultur vollkommen unberührt, in vielerlei Hinsicht nicht einmal den Geboten des Hausverstands.
Gewöhnlich beschwört man angesichts einer von krassen Gegensätzen geprägten Lage die ausgleichende Kraft des Mittelstandes. Christian Stummer und Andreas Fiereder, Gründer des im oberösterreichischen Ottensheim ansässigen Architekturbüros „Two in a box“ sehen sich in dieser Rolle. Sie legen großen Wert auf ein gutes Gesprächsklima mit ihren Bauherren, deren Wünsche sie ebenso respektieren wie die Budgetvorgaben. Um Letztere einzuhalten, nehmen sie wohl Änderungen und Abstriche an ihren Planungen in Kauf, doch ohne das Ziel qualitätsvolle Architektur aus den Augen zu verlieren. „Two in a box“ haben vom privaten und sozialen Wohnbau über Gewerbebauten bis zu öffentlichen Gebäuden ein breites Spektrum von Bauaufgaben gelöst. Viele ihrer Aufträge waren das Ergebnis gewonnener Architekturwettbewerbe.
Der konstruktive Holzbau gehört zu den Schwerpunkten, die „Two in a box“ gerne setzen, wo dies möglich ist. So überzeugte etwa ihr Vorschlag, den Neubau des Kindergartens Doppl-Hart in Massivholzbauweise auszuführen, Wettbewerbsjury und Bauherrschaft gleichermaßen. Die Gemeinde Leonding sah darin die Möglichkeit, den eigenen, über das Landesübliche hinausgehenden Qualitätsanspruch deutlich zu steigern: Das hinter dem seitens der Gemeinde geforderten Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und LED-Leuchten stehende ökologische Engagement wird durch die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffes Holz unterstrichen. Dem durch die Anordnung eines zusätzlichen kleinen Ruheraumes für jede Gruppe ausgedrückten Wunsch nach möglichst hohem Nutzungskomfort für die Kinder entsprechen „Two in a box“ mit einer übersichtlichen, zweihüftigen Anlage, in der alle Gruppen- und Bewegungsräume gleichwertig nach Süden orientiert sind. Das klug austarierte Wechselspiel von Besonnung und Beschattung, die mit Tageslicht erfüllten Erschließungszonen, die Vielfalt der Blickbeziehungen, nicht zuletzt das Hervorheben der optischen, akustischen und haptischen Qualitäten des Holzes, kurzum den Mehrwert, den die Architekten durch ihre Detailarbeit geschaffen haben, gibt es gratis dazu.
Die Notwendigkeit, räumliche Qualität als kostenlose Über-Erfüllung funktioneller Vorgaben zu erschaffen, war bei einem anderen Bau von „Two in a box“ besonders deutlich zu spüren: das Green Belt Center in Windhaag, eine multifunktionale Anlage, die dem Naturraum auf der Fläche des einstigen Eisernen Vorhangs gewidmet ist, musste mit besonders knappem Budget verwirklicht werden. „Two in a box“ haben die angespannte wirtschaftliche Situation bei gleichzeitig im Thema angelegtem ökologischem Schwerpunkt in einen Holzbau übersetzt, der aus seiner Sparsamkeit kein Hehl macht und sichdie Freude an der Gestaltung des Möglichen dennoch nicht nehmen lässt.
Dieser außen mit einer Schalung aus sägerauer Weißtanne, innen jedoch mit Grobspanplatten verkleidete Neubau ist einem historischen Mühlviertler Waldhaus zur Seite gestellt, das mit minimalen Eingriffen der neuen Nutzung angepasst wurde. Er übernimmt mit einem Lift- und Treppenturm die vertikale Erschließung beider durch Brücken verbundener Häuser. Haupteingang und Kassa liegen in dem nach beiden Seiten offenen Verbindungsbau. Der Zubau schafft im Erdgeschoß Raum für ein Foyer und einen Vortragssaal. Die oberen Geschoße setzen – durch Lufträume untereinander verbunden –den Weg nach oben zu der Aussichtsplattformin Szene, die einen Rundblick in den umgebenden Naturraum bietet.
Eine Möglichkeit, die finanziellen Aufwendungen ihrer Bauherren in größtmöglichem funktionellem, aber auch kulturellem Nutzen abzubilden, sehen „Two in a box“ in der umfassenden Betreuung ihrer Baustellen, die auch die Kostenermittlung und Bauabwicklung bis zur örtlichen Bauaufsicht umfasst. Nicht selten übernehmen sie sogar Teiledes Projektmanagements und ersparen damit ihrer Bauherrschaft die Entscheidung, obsie die Gestaltungshoheit über den Planungs-und Kostenverlauf tatsächlich gegen die Bequemlichkeit, sich eines Generalübernehmers zu bedienen, eintauschen wollen.
Im Fall des Gemeindezentrums Lichtenberg waren es drei Auftraggeber, die Gemeinde, ein Gastronom und eine Bank, derenunterschiedliche Anliegen „Two in a box“ in einem Haus zusammenführten. Das Ergebnis, ein auf einem massiven Erdgeschoß ruhender Holzbau, zeigt das Talent der Architekten, Nutzungen dicht in ein kompaktes Volumen zu schlichten und doch jenes Maß an Licht und Luft einzuplanen, das für das Empfinden räumlicher Großzügigkeit entscheidend ist. Davon profitieren alle Bereichedes Hauses gleichermaßen, während ihre vonHolz und hellen Grau- bis Beigetönen grundierte Ausgestaltung der jeweiligen Nutzung angepasst ist. Gleichzeitig mit dem an allen Tagen der Woche belebten Gebäude ist als Fortsetzung seines teilweise zweigeschoßigenFoyers ein multifunktionaler Ortsplatz entstanden, der neben der Dorflinde und den notwendigen Installationen für Maibaum undChristkindlmarkt sogar eine Mitfahrbucht fürdie zahlreichen in Lichtenberg wohnhaften Pendler bietet.
Ist das Gemeindezentrum Lichtenberg von seiner Multifunktionalität geprägt, so mussten „Two in a box“ bei der Planung des Musikpavillons Bad Ischl nur einer Nutzung, dem Musizieren für das im Kurpark flanierende Publikum, den richtigen Ausdruck verleihen. Der von ihnen gewählte elliptische Grundriss formt den Pavillon im Verband mit einem nach hinten geneigten Dach zu einem markanten Objekt, das auf einem unsichtbaren Betonsockel über der gekiesten Fläche des Parks zu schweben scheint. Die innen zur Gänze mit Weißtanne ausgekleidete Form wird außen durch eine selbst im Bereich von Belichtungsöffnungen weitergeführte vertikale Weißtannenlattung geschlossen. Hinter dem Paravent dieser Schalung, der an der Nordwestseite mit einer zweiten Schicht den Künstlereingang umfängt, bleiben auch die Zugänge zu der öffentlichen WC-Anlage verborgen, die im östlichen Bereich des Pavillons Platz gefunden hat. Nur die trichterförmig nach hinten verjüngte Bühne mit ihrem als Gegenbewegung zur Decke in flachen Stufen ansteigenden Boden ist aus dieser fein gearbeiteten hölzernen Skulptur herausgeschnitten: ein Raum, der kann, was er können soll, und das verkörpert, was er ist.
Pferdeställe sind in der Regel selten für feierliche Zusammenkünfte konzipiert. Das brachliegende Restaurant in den ehemaligen Ställen des Schlosses Lamberg in Steyr hatte daher großen Veränderungsbedarf. Ein gelungenes Beispiel für das Erreichen hoher räumlicher und kultureller Qualität.
Es gibt viele Beweggründe, sich gute Architektur zu leisten. Als die Österreichischen Bundesforste die Erstellung eines Businessplanes für das brachliegende Restaurant im Schloss Lamberg in Steyr bei ihr in Auftrag gaben, analysierte Herta Neiss, Geschäftsführerin des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz, nicht nur die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Standortes. Sie wies in ihrer Studie auch mit Nachdruck darauf hin, dass das Erreichen hoher räumlicher und kultureller Qualität Voraussetzung des Geschäftserfolges sein würde. Der zuständige Vorstand der Bundesforste, Georg Schöppl, stellte im Einklang mit dem Businessplan ein dem Unterfangen würdiges Budget zurVerfügung und beauftragte mit den in Steyr ansässigen Hertl.Architekten ein Architekturbüro, das seine Sensibilität im Umgang mit historischer Bausubstanz bereits unter Beweis gestellt hatte. Das ist gerade im Bereich der Gastronomie, wo man nur allzu oft auf die kosmetische Wirkung vermeintlich dekorativen Trödels zählt, keine Selbstverständlichkeit.
Nun ist das Schloss Lamberg so etwas wiedie Essenz der Stadt Steyr, deren malerische Vielfalt von ihrer Lage am Zusammenfluss von Enns und Steyr geprägt wird. Mit seiner dreieckigen Grundrissformzeichnet das auf dem Felsen nordwestlich desStadtplatzes liegende Gebäude diese topografische Besonderheit nach. Aus einer mittelalterlichen, 1727von einem Brand zerstörten Burg hervorgegangen, ist das Schloss ein Werk des oberösterreichischen Barockarchitekten Johann Michael Prunner. Die von ihm errichtete Schlosskapelle in dem der Enns zugewandten südöstlichen Trakt wird heute vom Magistrat der Stadt als Standesamt genutzt und ist als Ort für Eheschließungen sehr beliebt. Mit der in den ehemaligen Stallungen im Südwesttrakt untergebrachten Gastronomie stehen nun auch angemessene Räume zum Feiern von Festen zur Verfügung.
Der Anspruch, den die Gesamtanlage mit ihrer privilegierten Lage, der barocken Architektur und der bis in die Zeit der Ungarnstürme zurückreichenden Geschichte erhebt, ist hoch. Diesem Anspruch heute ebenso gerecht zu werden wie der legitimen Erwartung, zeitgemäßen Komforts zu entsprechen und gleichzeitig den nicht minder berechtigten Forderungen des Denkmalschutzes, ist eine Leistung, die gerade angesichts der ursprünglichen Nutzung der Räume nicht zu unterschätzen ist. Denn wenngleich die seinerzeit darin untergebrachten Pferde wohl keine Ackergäule waren, sondernteure, mit hochpreisigen Autos vergleichbare Prestigeobjekte: Pferdeställe sind in der Regel ebenso wenig für feierliche Zusammenkünfte konzipiert wie Garagen. Es bestand also erheblicher Veränderungsbedarf, der über die technische Sanierung des Vorgefundenen weit hinausreichte.
Diese ging bis an die Grundfesten des Bestandes: Das vom Pferdeurin kontaminierte historische Holzstöcklpflaster wurde entfernt, der Verputz an Wänden und Gewölben abgeschlagen und der Boden einen Meter tief abgegraben. Bei dieser Gelegenheit wurden die von Säuren zerfressenen Fundamente der tragenden Säulen wiederhergestellt, und es wurde ein zeitgemäßer, gegen Feuchtigkeit abgedichteter wärmegedämmter Fußbodenaufbau eingebracht. Auchnutzten Hertl.Architekten die Gunst der Stunde, um störende Einbauten zu entfernen und die dem Restaurant zugeordneten Räume auf ihre ursprüngliche Form zurückzuführen. Durch die Erweiterung der Fläche um bisher untergeordnet genutzte Räume stehen dem Betrieb jetzt zwei unterschiedlich gestimmte Speisesäle und eine Bar zur Verfügung, die von einer Catering-Küche versorgt werden. Die Küche kann über ein breites Tor direkt vomSchlosshof her beliefert werden. Der Haupteingang in das Lokal liegt nun zwischen den beiden Sälen in einem Raum, der sich über die gesamte Tiefe des Traktes erstreckt und sowohl über den Hof als auch über die den Schlossgraben flankierende Gartenterrasse zugänglich ist. Beiden Eingängen sind Windfänge zugeordnet, die mit jeweils beidseitig angeordneten, bis zum Ansatz der Gewölbe geführten Kästen als ebenso effizient wie diskret gestaltete Garderoben dienen. Die Türen der Windfänge sind aus Glas, sodass der Blick quer durch das Gebäude erhalten bleibt.
Auch in der Längsrichtung kommt die Flucht der Räume unverstellt zur Geltung. Die daraus gewonnene Großzügigkeit unterstreicht den festlichen Charakter, den wir von Säulenreihen unterteilten, mit Gewölben gedeckten Hallen a priori zuschreiben. Doch gerade überwölbte Räume sind akustisch höchst problematisch: ein Umstand, dem bei der Umdeutung historischer Gebäude häufig zu wenig Beachtung geschenkt wird. Eine den jeweiligen Saal fassende Lamperie – im frei möblierbaren Lambergsaal bis zur Unterkante der vorgefundenen Steinverkleidung mit den darin eingearbeiteten Pferdetränken geführt, im Fürstensalon als Rückenlehne der umlaufenden Sitzbank genutzt – dämpft den Schall und verbirgt überdies alle Leitungen, die für die Bereitstellung zeitgemäßen Komforts notwendig sind. Das Lokal verfügt somit auch über EDV-Anschlüsse und Bühnentechnik sowie über eine ausreichend dimensionierte Lüftungsanlage. Das alles ohne Störung des historischen Erscheinungsbildes erreicht zu haben setzt nicht nur akribische Detailarbeit seitens des Architekturbüros voraus, sondern auch dessen Fähigkeit, den eigenen Gestaltungswillen mit dem Charakter des Ortes in Einklang zu bringen.
Denn obwohl man dem neuen Restaurant im Schloss Lamberg auf den ersten Blick attestieren möchte, es sähe so aus, als wäre nichts geschehen: Es bedarf nicht einmal der Bilder zur Darstellung des Unterschiedes zwischen „vorher“ und „nachher“, um zu wissen, dass sich ein Gastronomiebetrieb des 21. Jahrhunderts auch gestalterisch von Stallungen der Barockzeit unterscheiden wird. Ausgehend vom neuen Eichenboden, der als Reminiszenz an das alte Holzstöckelpflaster gewählt wurde, haben Hertl.Architekten in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt ein neues Farbkonzept entwickelt, das mit seinen Beige-, Braun- und Grautönen die historische Gliederung der Raumhülle unterstreicht. Die durchwegs indirekt angelegte Beleuchtung hebt das Zusammenspiel von geschwungenen Linien und gewölbten Flächen zusätzlich hervor.
Während Lambergsaal und Fürstensalon hell gestimmt sind, ist die kleine Bar am Ende der Raumflucht in Anlehnung an die vorgefundene Holzverkleidung eine dunkle Holzschatulle, die in einer ihrer Wände erfrischend apfelgrün gehaltene Sanitärzellen verbirgt; und wer genau schaut, entdeckt auf den hinterleuchteten textilen Schirmen, mit denen die Theken der Bar und der Ausschank in einer Nische des Lambergsaales verkleidet sind, die Umrisse menschlicher Gestalten von der Hüfte abwärts. Sie sind die Antwort auf die zart in die helle Lamperie des Lambergsaales eingearbeitete Erinnerung an jene Pferde, die dort schon lange nicht mehr an der Tränke stehen.
So wohnlich kann der Altersheimbau heute aussehen: das neue Seniorenheim im Linzer Franckviertel – mehr als nur ein spitalsähnliches Pflegeheim.
Architektur kann hilfreich sein. Ob es nun um die Neuordnung des Schulalltags geht, um soziales Wohnen in der Großstadt oder um die Wiederbelebung ländlicher Ortskerne: Architekten leisten einen erheblichen Beitrag zur gedeihlichen Weiterentwicklung unseres Zusammenlebens. Nicht selten setzen sie dabei räumlich um, was im Bewusstsein ihrer Auftraggeber erst vage Formen angenommen hat. Viel häufiger aber geht es darum, ganz konkreten Ansprüchen an Funktionalität und Komfort innerhalb eines streng gesteckten finanziellen Rahmens gerecht zu werden.
In Oberösterreich gehört der Altersheimbau zu jenen Aufgaben, deren Nutzungsqualitäten in den vergangenen Jahren beständig verfeinert worden sind. Das in Wien ansässige Büro Kuba/Karl und Bremhorst Architekten wiederum zählt zu jenen Architekturbüros, die es verstehen, ihr von Projekt zu Projekt gewonnenes Wissen über eine Materie auch gestalterisch in jene Souveränität zu übersetzen, die dem hohen technischen und sozialen Ausstattungsgrad der jeweiligen Einrichtung entspricht. Mit dem kürzlich fertiggestellten Seniorenzentrum Liebigstraße im Linzer Franckviertel hat Kuba nicht nur die Erwartungen der Jury eingelöst, die seinem Wettbewerbsprojekt „hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität“ sowie „architektonisch klare Gestaltung“ attestierte. Es schaffte es, dem doch recht euphemistisch „Seniorenzentrum“ genannten Pflegeheim die Anmutung eines Krankenhauses zu nehmen. Das ist angesichts der geltenden Pflegestandards ein Unterfangen, das nur durch akribische Detailarbeit gelingen kann und für die Augen der meisten Nutzer unsichtbar bleibt.
Die Grundlage einer funktionstüchtigen Einrichtung ist die kluge Organisation des Alltags. Der Bedarf an Pflegeplätzen steigt ebenso wie die damit verbundenen Kosten; der Pflegeberuf ist kein Honiglecken, und es gibt daher: wenig Toleranz für sperrige Abläufe oder weite Wege. Eine bestimmte Mindestgröße ist Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb eines Pflegeheimes. Gleichzeitig sollen die Bewohner sich zu Hause fühlen, was angesichts von 120 Betten in einem Haus leichter gesagt als in gebaute Realität übersetzt ist. Kuba hat das Seniorenzentrum Liebigstraße als dreiflügelige Anlage konzipiert. Die drei in ihrer Ausdehnung dem städtebaulichen Maßstab des Umfeldes gut angepassten Flügel greifen nach Norden Westen und Osten aus. In den drei Obergeschoßen ist jeweils eine Wohngruppe für 40 Betten untergebracht. Die Dreiteilung reduziert die seitens der Bewohner gefühlte Größe der Einrichtung ebenso, wie sie die Wege für das Personal verkürzt, dessen Pflegestützpunkt in der Mitte des Grundrisses angeordnet ist.
Auch im Erdgeschoß bewährt sich die Teilung des Baukörpers, da sie mit einer klaren Trennung unterschiedlicher Funktionen einhergeht. Der Nord-Süd-orientierte Trakt springt an seiner westlichen Längskante und an seiner nördlichen Stirnseite hinter die Flucht der Obergeschoße zurück. So entsteht ein geschützter Bereich vor dem Haupteingang, der in der Innenecke angeordnet ist. Die sich dahinter öffnende Eingangshalle und der vertikale Erschließungskern liegen somit im Zentrum des Gebäudes. Die ein wenig schräg zum Seniorenzentrum an dessen Westseite verlaufende Liebigstraße begrenzt einen Vorplatz angemessener Größe, den ein Café und die Räume der Verwaltung überblicken. Auf der anderen Seite des Traktes liegen ein Mehrzwecksaal variabler Größe und der Andachtsraum in unmittelbarer Nähe der Eingangshalle. Im Ostflügel sind Therapieräume und die Küche untergebracht. Zu- und Anlieferung erfolgen ohne Störung des Betriebs über eine eigene Zufahrt von Norden her. Der südlichste, nach Westen zeigende Trakt wiederum beherbergt ein stark frequentiertes Tageszentrum, das sich wie die Therapieräume mit seinem allgemeinen Aufenthaltsraum zu einem von der Straße abgeschirmten Garten öffnet.
Das Haus ist äußerst kompakt organisiert. Dennoch hat es keine dunklen Gänge. In den Obergeschoßen hat Kuba jedem der drei Trakte an seiner Innenecke eine Loggia eingeschnitten, die jeweils einem Aufenthaltsbereich in der Größe eines Wohnzimmers zugeordnet ist. Die T-förmig ausgebildeten Erschließungszonen der einzelnen Trakte münden mit großzügigen Fenstern in Loggien oder direkt an der Fassade und sorgen so für Tageslichteinfall und Orientierung. Die Wände der in der Mitte der Erschließungsbereiche angeordneten Nebenraumzonen halten Abstand zur Decke und vermeiden so den Eindruck räumlicher Enge. Den drei Trakten ist jeweils ein Wohn- und Essbereich zugeordnet; Wohnküchen laden die Bewohner zur Mithilfe beim Anrichten der Mahlzeiten ein. Auch der Raum vor dem Pflegestützpunkt wird gerne genutzt. Die Zimmer entsprechen in Dimension und Ausstattung den in Oberösterreich geltenden Normen. Mit ihren tief gesetzten Parapeten gewähren sie auch bettlägerigen Menschen Ausblick ins Freie. Kleine Briefkästen in den Nischen vor den Zimmertüren sollen der Persönlichkeit des Einzelnen zumindest symbolisch Präsenz verleihen.
Die mit hellem Holz, unaufdringlich hellen Böden und einer vereinzelten, mit Stoff bezogenen Bank dem Begriff „wohnlich“ so weit wie möglich angenäherte Stimmung im Haus wird von den Kunstprojekten mitgetragen. Walter Kainz und Marion Kilianowitsch haben mit ihren Werken – einem Eichenrelief und einem Metallbild – den Andachtsraum ruhig und meditativ gestimmt. Großformatige Holzintarsien mit Linzer Stadtansichten von mia2/Gnigler/Wilhelm Architektur unterstützen Gedächtnis und Orientierung im Haus; und die von Gerhard Brandl in den Natursteinboden der Eingangshalle gravierten Teppiche erinnern die Bewohnerinnen und Bewohner vielleicht ebenso an daheim wie Margit Greinöckers Guglhupf-Skulptur an der dem Haupteingang gegenüberliegenden Wand.
Kuba aber hat mit großem Planungsaufwand dafür gesorgt, dass haustechnische Einrichtungen wie etwa die Lüftungsanlage in diesem höchst energieeffizient angelegten Gebäude im Hintergrund bleiben und kein Feuerlöscher die Harmonie der Aufenthaltsbereiche stört. Und dennoch: Im Seniorenzentrum Liebigstraße finden ausschließlich Menschen mit hoher Pflegebedürftigkeit Aufnahme. Die Frequenz ist diesem Umstand entsprechend deprimierend hoch. Das allerdings ist ein Aspekt der Bauaufgabe, den auch hervorragende Architektur nicht lösen kann
In Größe und Entstehungsgeschichte nicht vergleichbar, unterstreichen zwei Objekte in Linz die städtebauliche Ungebundenheit ihrer Institutionen. Mitten in der Natur: über den Neubau der Anton Bruckner Privatuniversität und des Gastronomiebetriebs „TeichWerk“.
Zwei neue Gebäude bereichern seit Kurzem die Hochschulszene von Linz: der vom Linzer Architekturbuero 1 geplante Neubau der Anton Bruckner Privatuniversität undein „TeichWerk“ genanntes Gebäude, das dieWelser Architekten Luger & Maul auf dem Gelände der Johannes Kepler Universität entwickelt haben. In Größenordnung, Entstehungsgeschichte und auch Architekturauffassung durchaus unvergleichlich, unterstreichen beide Objekte die städtebauliche Ungebundenheit ihrer Institutionen bei gleichzeitiger Nähe zur Natur.
Das Land Oberösterreich respektive die von ihm gegründete Errichtungsgesellschaft hat den ursprünglichen zentrumsnahen Standort der Bruckner Universität in Urfahr aufgegeben und ist mit dem Neubau den Hang des Pöstlingberges hinauf gewichen. Dort prägt das signifikant geformte Gebäude nun die Ansicht der Stadt; eine Wechselwirkung zwischen dem Universitätsbetrieb und seinem von vorwiegend kleinteiliger Wohnbebauung besetzten Umfeld ist jedoch nicht zu erwarten. Das im Herbst 2008 in einem EU-weiten Architekturwettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnete Architekturbuero 1 hat die Entscheidung der Universität zum Rückzug ins Grüne mit seinem Projekt auf unbeschwert heitere Weise interpretiert. Der von einem Vorhang aus unterschiedlich geneigten Lamellen umfangene Baukörper signalisiert zur Stadt hin Geschlossenheit, während er sich an seiner Südseite den Resten eines Schlossparks mit altem Baumbestand öffnet. So weit wie möglich nach Norden in die Kurve der Hagenstraße gerückt, schirmt das Gebäude den Grünraum der ehemaligen Hagengründe vom Verkehrslärm ab und bekräftigtdessen Zugehörigkeit zum Universitätsgelände. Während die Skulptur des Baukörpers das Gewicht der Institution zum Ausdruck bringt, nehmen ihm Neigung und Rhythmus derLamellen einiges an Schwere; als wollten sie sagen: Hier wird studiert, doch es geht um Musik, um Schauspiel, um Tanz!
Betritt man die Bruckner Universität über ihren Haupteingang von der Hagenstraße her, gelangt man in einen Erschließungsbereich, der mehrfach seine Richtung wechselnd das Haus durchfließt und die drei oberirdischenGeschoße bis unter sein gläsernes Dach miteinander verbindet. Damit löst der Innenraum ein, was die Fassade verspricht: Aus dem Strom der Bewegung entsteht ein großes, luftiges, helles Ganzes, in dem eine bunte Vielfalt von Nutzungen ungestörte Ufer und Inseln bildet. Indem es die Mitte des Körpers in den beiden Obergeschoßen mit der Bibliothek besetzt und die kleinen Zellen der Unterrichtsräume und Büros entlang der Fassade angeordnet hat, ist es dem Architekturbuero 1 gelungen, Belichtung und Orientierung im Haus klug zu lösen. Auf der Eingangsebene sind in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang und dem Foyer vier in Größe und Ausstattung unterschiedliche Veranstaltungssäle angeordnet.
Der große Konzertsaal bildet das westliche Kopfende des Gebäudes und wird durch den darüber liegenden Verwaltungsbereich zusätzlich vom Rest des Hauses abgeschirmt. Die somit gewährleistete schalltechnische Trennung ist allerdings für alle Unterrichts- und Vortragsräume, ja für die Institution als Gesamtheit von großer Bedeutung. Nicht minder wichtig sind die akustischen Qualitäten der Räume für sich, die der jeweiligen Nutzung angepasst werden mussten. Hier macht sich die Entwurfsentscheidung zur organischen Form mit Räumen bezahlt, deren aus dem rechten Winkel fallende Wände dasunter Musikern gefürchtete Flatterecho hintanhalten. Ein heller, nach Bedarf justierbarer textilerVorhang und ein dahinter verborgener Tiefenabsorber in jedem Unterrichtsraum runden die schalltechnischen Maßnahmen gestalterisch wohlüberlegt ab. Den Lamellenvorhang hat das Architekturbuero 1 in der Mitte der Südfassade etwas zur Seite geschoben. Dank dieser Geste und der in eine Terrasse mündenden Freitreppe verbindet sich das Foyer mit dem Park, wird die Anlage zum Campus; mit Blick auf Linz, doch deutlich entrückt.
Vielleicht wurzelt die Standortwahl für die Anton Bruckner Universität ja in einer Linzer Tradition. Denn schon die aus den 1960er-Jahren stammende Johannes Kepler Universität wurde am nordöstlichen Rand der Stadt im Park eines Herrenhauses als Campusuniversität errichtet. Einige der Gebäude sind in Würde gealtert, andere überzeugen heute nicht mehr. Die Anlage bedarf jedoch der Auffrischung, um dem Anspruch, Forschung und Studium mithilfe eines inspirierenden Umfeldes zu fördern, wieder gerecht zu werden. Mit dem „TeichWerk“, dessen Errichtung Rektor Meinhard Lukas als gebautes Zeichen einer wissenschaftlichen Qualitätsoffensive an den Beginn seiner Amtszeit gesetzt hat, hat die Universität einenGastronomiebetrieb bekommen, der auch als kultureller Veranstaltungsort geeignet ist. Da es viel mehr um informelle Begegnungen denn bloße Verpflegung geht, nimmt das „TeichWerk“ einen prominenten Platz an der Hauptzugangsachse auf dem zentralen Teich ein, um den die Gebäude und Freiflächen desCampus gruppiert sind.
Das „TeichWerk“ ist beinahe ein Schiff. Jedenfalls schwimmt es auf dem Wasser und könnte bei Bedarf auch andere Positionen auf dem Teich einnehmen. Doch eigentlich ist es ein luftiger Pavillon, der mit unaufdringlicher Eleganz die Anstrengungen seiner nur wenige Monate währenden Planungs- und Errichtungszeit ebenso überspielt wie den Druck eines äußerst knappen Budgets. Auf stählernen Hohlkörpern ausbalanciert und über zwei Stege mit dem Ufer verbunden, ruht das lang gezogene, an seinen Stirnseiten abgerundete Rechteck einer hölzernen Plattform. Sie wird von einer durchsichtigen Reling gefasst und von einem Dach mit filigran ausgebildetem Rand beschirmt. Eine metallene Box zur Aufnahme der nötigen Haustechnik im nördlichen Bereich des „TeichWerks“ verleiht dem von schlanken Säulen getragenen Aufbau schiffsähnliche Konturen.
Auf dem Dach befindet sich ein weiterer Aufenthaltsbereich. Der Raum unter dem Dach wird zu etwa zwei Drittel von teils gläsernen, teils hölzernen, an ihren Außenseiten mit Aluminiumpaneelen belegten Wänden umfangen. Großzügige Schiebeelemente im Bereich der Glaswände und die zur Gänze zu öffnende Südseite des Innenraumes ermöglichen eine variable Nutzung des mit Küche, Sanitärzellen und Bühnentechnik ausgestatteten „TeichWerks“. Von Luger & Maul mit Verständnis für die räumlichen Voraussetzungen gelingender Kommunikation entwickelt, bringt es die Vorstellung von der Inspiration des Geistes durch die Natur in einer Vielzahl unterschiedlichster Konstellationen auf den Punkt.
Hier ein traditioneller Ort mit Kirche, Gemeindeamt, Gasthof – und einer neuen Mitte als Besonderheit. Da ein Stationsgebäude – das an Gebirge und Felsen erinnert. Zum Charakter von Beton: zweimal Besuch in Oberösterreich.
Die Gemeinde Handenberg mag mit ihren 1300 Einwohnern nicht groß sein und ihre Lage weit im Westen des oberösterreichischen Innviertels nicht unbedingt zentral. Doch die Dorfgemeinschaft von Handenberg ist höchst lebendig und hat sich über einen mehrere Jahre dauernden Prozess zielstrebig ein neues Zentrum erarbeitet.
Die Mitte des Ortes wird, ganz traditionell, von Kirche, Gemeindeamt und Gasthof gehalten. Der dazwischen aufgespannte Platz hatte aber nach Abbruch eines Kaufhauses an seiner Westseite jede Kontur verloren. Den auf Anregung des oberösterreichischen Ortsbildbeirates ausgeschriebenen Architekturwettbewerb zur Gestaltung des Ortsplatzes hat das Büro Heidl Architekten aus Linz gewonnen. Seine Maßnahmen haben Handenberg nicht nur einen äußerst funktionstüchtigen öffentlichen Raum beschert, sondern auch eine Sehenswürdigkeit, die der Annahme ländlich ist gleich rückständig elegant das Gegenteil beweist.
Der barocke Turm der in ihrem Ursprung gotischen Pfarrkirche beherrscht nach wie vor den Hügel, auf dem das Zentrum Handenbergs liegt. Die dem heiligen Martin geweihte Kirche ist vom Friedhof umgeben, in dessen Umfassungsmauer ein historisches Portalgebäude eine Nord-Süd-Achse zum Gemeindeamt bildet. Die Ostflanke dieses Raumes schließt nun eine Wand aus Sichtbeton, entlang der eine lang gestreckte hölzerne Bank zum Sitzen einlädt. Dahinter wendet sich eine Grünfläche mit bereits vorgefundenem Busch- und Baumbestand dem Gasthaus zu. Im Westen des zur Gänze mitKleinsteinen gepflasterten Dorfplatzes ist durch den Abbruch des Kaufhauses eine Besonderheit von Handenberg zum Vorschein gekommen: ein kleiner, über einen unterirdischen Strom vom nächsten Hügel her gespeister Teich, der durch das Gebäude und hohe Hecken den Blicken der Allgemeinheit für lange Zeit entzogen war. Heidl Architekten und die ebenfalls in Linz ansässige Landschaftsplanerin Barbara Bacher haben sein östliches Ufer durch einen hölzernen Steg vom Platz her zugänglich gemacht; bepflanzte Böschungen und ein auch den Platz umfassender Kreisbogen aus Eichen werden für Schatten und jenen Grad an „Natürlichkeit“ sorgen, der informellen Begegnungen einen angenehmen Hintergrund schafft.
Den Übergang von diesem Grünraum zu dem repräsentativ wirkenden Bereich des Platzes zwischen Amt und Kirche markiert ein einprägsames Bauwerk: ein konstruktiv von Werkraum Wien entwickelter Winkel aus Stahlbeton kragt über zwölf Meter von Norden nach Süden aus und beschirmt eine Grundrissfläche von etwa 80 Quadratmetern. Seine aus dem Boden aufsteigende Wand zieht die Grenze zwischen Platz und Gehsteig. Sie ist an beiden Seiten unterschiedlich, an der Innenseite des Winkels nach Maßgabe der daran befestigten Sitzbank geneigt.
An der Mauer zum Friedhof nimmt eine weitere Bank dieses Motiv auf. Der an seiner schlanksten Stelle nur 15 Zentimeter starke Winkel ist ohne jeden Kompromiss aus Stahlbeton gefertigt. Wasserdicht sowie gegenüber Frost und Tausalz beständig, verbirgt er hinter seinen leicht überhöhten Kanten die Entwässerung des Daches, die ohne Folien und Verblechungen einzig durch die Ausbildung eines leichten Gefälles über zwei in der Wand geführte Abfallrohre funktioniert. An der Untersicht des Daches sind LED-Leuchten in das sorgfältig geplante Fugenbild derSchalung integriert. Dieübrige Platzbeleuchtungbeschränkt sich auf eine indirekte, an den Fuß der begrenzenden Wände und Bänke gekoppelte Lichtführung.
Nur wenige Kilometer entfernt, in der unmittelbar an der Grenze zu Deutschland gelegenen Marktgemeinde Ostermiething ist ein weiteres Beispiel zeitgenössischer Architektur zu sehen, das sich den Charakter des Betons in ähnlicher Intensität, jedoch auf ganz andere Weise zunutze macht. Die Salzburger Lokalbahnen, die für den vom Salzburger Büro Udo Heinrich Architekten entwickelten Lokalbahnhof Lamprechtshausen mit dem Bauherrenpreis 2012 der ZV geehrt wurden, haben Udo Heinrich Architekten als Gewinner eines geladenen Architekturwettbewerbes ein weiteres Mal mit der Errichtung eines Stationsgebäudes beauftragt, diesmal am Ende ihrer neuen, nach Ostermiething verlängerten Strecke. Während das kühne Flugdach in Handenberg die verblüffenden konstruktiven Möglichkeiten des Stahlbetons und sein Potenzial zur „reinen“ Geometrie in den Vordergrund stellt, betont das Stationsgebäude in Ostermiething den Gesteinscharakter des Baustoffes. Seine aus Beton gegossene Plattform und ihre von fünf Pavillons getragene Überdachung lassen an Gebirge und Felsen denken. Die ihren Nutzungen entsprechend unterschiedlich ausgeformten Pavillons falten sich zu einer Landschaft von Graten und Giebeln, in die das schlanke Bahnsteigdach aus Stahlbeton seinen beruhigenden Horizont legt.
Näher kommend erkennt man, dass man es mit einer durchkomponierten Abfolge von „Steinsetzungen“ in gesteigerten Verfeinerungszuständen zu tun hat: das Buffetgebäude ganz vorne am Wendepunkt der ankommenden Züge und der daran schließende Wartebereich für die Reisenden sind polygonale Kristalle mit glatt geschliffenen Wänden, die von – mitunter gläsern gefassten – Tageslichtkörpern begleitet werden. Weiter dem Südosten zu wird die Geometrie der Pavillons einfacher; der Bearbeitungsgrad der Betonoberflächen und damit ihre Rauheit nimmt zu.
Während der Personalbereich und die WC-Anlagen noch eine relativ hohe Komplexität und feiner strukturierte Oberflächen aufweisen, scheint der abschließende, technische Infrastruktur bergende Block mit seiner einfachen Geometrie und der tief gespitzten Wandstruktur erst skizzenhaft umrissen zu sein. Er markiert die fließende Grenze der Bahnstation zum Landschaftsraum, der mit geschottertem Schienenstrang aus der Ferne kommend einzieht. Es ist durchaus denkbar, dass das so geschaffene poetische Element des Ortes im Nebel des werktäglichen Pendelverkehrs nicht von sämtlichen Reisenden in gleicher Tiefe gewürdigt wird; die funktionellen Qualitäten der ebenso feinsinnig wie robust gestalteten Anlagen liegen jedoch für alle Nutzerinnen und Nutzer gewiss auf der Hand.
Alten- und Pflegeheime sind häufig Mahnmale: Sie künden von einer Gesellschaft, die Hinfälligkeit und Tod verdrängen will. In Hartkirchen, Oberösterreich, ist das anders.
Kunst am Bau ist keine glückliche Bezeichnung. Schreibt sie doch eine Reihung fest, die ebenso den zeitlichen Ablauf der Dinge benennt wie deren Wert. Zuerst ist der Bau. Dann kommt – vielleicht – die Kunst. Da ist viel Wahres dran. Dennoch: Den von Förderungsgebern für Kunst vorgesehenen Bruchteil der Baukosten nach Abrechnung derselben für eine ergreifende Darstellung des heiligen Florian aus der Werkstätte des ortsansässigen Holzschnitzers zu verbraten ist auch jenseits kunstaffiner Zirkel längst nicht mehr Brauch. Gerade Architekten, die ihre eigene Aufgabe nicht im bloßen Bereitstellen technisch, wirtschaftlich und rechtlich unanfechtbarer Anlagen sehen, trachten danach, bildende Kunst frühzeitig in ihre Planungskonzepte zu integrieren.
Da nicht alle Entscheidungsträger öffentlicher Bauvorhaben Erfahrung im Umgang mit zeitgenössischer Kunst haben, ist in solchen Fällen häufig ein erhebliches Maß an Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Projekt zum Neubau des Bezirksalten- und -pflegeheims Hartkirchen ist es dem Vöcklabrucker Architekturbüro Gärtner + Neururer und der Künstlerin Martina Schürz-Neururer gemeinsam geglückt, Architektur und bildende Kunst so zu verbinden, dass der daraus erwachsende Mehrwert dem aus immerhin sechs Bürgermeistern zusammengesetzten Vorstand des Sozialhilfeverbandes Eferding ersichtlich war.
Gärtner + Neururer haben in den vergangenen Jahren einige Erfahrung im Bau von Altenheimen gesammelt, die sie in die Lage versetzt, diese durch eine Vielzahl von Vorschriften im höchsten Maß regulierte Bauaufgabe nicht nur organisatorisch zu bewältigen, sondern dem engen Rahmen auch immer wieder hohe räumliche Qualität einzuschreiben. Das Bezirksalten- und -pflegeheim liegt am Rand der etwa 4000 Seelen zählenden Gemeinde Hartkirchen im oberösterreichischen Hausruckviertel auf einem Bauplatz ohne Einschränkungen durch benachbarten Bestand.
Dieser Umstand begünstigte die Entwicklung eines höchst ökonomischen Grundrisses, der kurze Wege für das Personal mit einer klaren Struktur zur Orientierung der Bewohnerinnen und Bewohner verbindet. Das dreigeschoßige Gebäude greift mit drei Trakten nach Osten, Süden und Norden. Das Erdgeschoß fasst allgemein genutzte Räume: Veranstaltungssaal, Kapelle, die Büros der Verwaltung, Therapie- und Personalbereiche sowie die Küche mitsamt ihren Nebenräumen. Deren Versorgung erfolgt von der Nordwestseite, während der Haupteingang im Südosten des Gebäudes liegt.
Über einen Windfang gelangt man in eine von Saal und Kapelle flankierte Halle und wahlweise über eine einläufige Treppe oder mittels Aufzug hinauf in die beiden Geschoße mit den Zimmern. Diese sind in den drei Flügeln jeweils entlang eines durch Türnischen strukturierten Mittelgangs aufgereiht, der mit einem raumhohen Fensterelement an seinem Ende den Bezug zum Außenraum herstellt. An ihrem entgegengesetzten Ende weiten sich die Gänge zu Aufenthaltsbereichen, denen Loggien zugeordnet sind. In der Mitte des Baukörpers, aus der die drei Zimmertrakte ihren Ausgang nehmen, sind die Pflegestützpunkte angeordnet. Auch hier haben die Architekten den Raum als Begegnungszone gestaltet, die sich mit breiten Glaselementen im zweiten Stock auf eine Loggia, im ersten Obergeschoß auf eine Terrasse öffnet. Denn an der Nordseite des Gebäudes wurde das nur sanft gewellte Gelände zu einem kleinen Hügel angeschüttet, der von Demenz betroffenen Menschen nun den ebenerdigen Ausgang in einen kleinen Garten ermöglicht.
So weit, so menschenfreundlich. Gärtner + Neururer haben den – nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht – rigorosen Vorgaben mit einem hellen, freundlich wirkenden Gebäude entsprochen, in dem sich Ordnung und Kleinteiligkeit zum Nutzen von Bewohnerinnen und Beschäftigten die Waage halten. Den aus vielerlei Notwendigkeiten erwachsenen, an Krankenhausbauten gemahnenden Details wie den breiten, für Bettentransporte geeigneten Türen oder den Handläufen an den Wänden haben sie, wo immer sich die Gelegenheit bot, Situationen entgegengesetzt, die vom einst Gewohnten erzählen sollen: eine Sitzgelegenheit in einer holzverkleideten Nische hier, einen gemauerter Ofen mit umlaufender Bank dort; den Ausblick in die Landschaft, in der man einmal daheim gewesen ist.
Mit ihrer künstlerischen Intervention versucht Martina Schürz-Neururer, diesen Gedanken weiterzutragen. So hoch das Niveau der Institution Alten- und Pflegeheim in pflegetechnischer Hinsicht auch sein mag, sosehr man sich um das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner bemüht: Sie bleiben Gefangene ihrer Gebrechlichkeit und die Heime Mahnmale, vorzugsweise an die zersiedelten Ränder einer Gesellschaft gestellt, die Hinfälligkeit und Tod nicht sexy findet.
Martina Schürz-Neururer begegnet diesem grimmigen Befund mit Lebensfreude und Humor. Sie greift auf eigene Kindheitserinnerungen im umgebenden Landschaftsraum zurück und verwandelt sein signifikantestes Kennzeichen in ein Ornament: die säuberlich gezogenen Reihen der Gemüsebeete, die auf diesen ertragreichen Böden praktisch allgegenwärtigen Krautköpfe, mit deren abstrahiertem Bild sie unter Beibehaltung geometrisch strenger Ordnung die Stirnseiten der drei Gebäudeflügel überzogen hat. Sie hat in den Vollwärmeschutz des Hauses ein Symbol für Wachstum und Fruchtbarkeit gewoben und so eine Hülle fabriziert, die in mehr als einer Hinsicht wärmt; die ein Signal der Verbundenheit mit dem Landstrich und seinen Lebensformen sendet, im Namen von Menschen, die immer noch Teil des Ganzen sind.
Im Inneren des Hauses hat Martina Schürz-Neururer das Ornament weiter zu einem Musterrapport zerlegt, der die Eingangsnischen der Zimmer ziert. Auf der Basis eines sorgfältig differenzierten Farbkonzeptes verbessern die in den verschiedenen Trakten und Stockwerken unterschiedlich ausgeformten Muster ein weiteres Mal die Möglichkeit, sich im Haus zurechtzufinden. Gleichzeitig erinnern sie an das in dieser Gegend noch gebräuchliche Weißen und anschließende Walzen der Wände und vermitteln so die Ahnung eines vielleicht schon vergessenen Gefühls: daheim zu sein.
Die Gemeinde Pucking, Oberösterreich, erfreut sich eines neuen Feuerwehrgebäudes: Wolf Architekten gelang der schwierige Spagat zwischen bedingungsloser Funktionalität und inspirierendem Raum.
Die Kassen sind leer. Diese Botschaft kommt nicht überraschend. Neu hingegen ist unser Selbstverständnis, in Zeiten des Mangels zu leben. Um der Spirale aus gedrückter Stimmung und ausbleibendem Aufschwung etwas entgegenzusetzen, drehen wir die Medaille der gefühlten Bedürftigkeit kurz um: Nennen wir den Umgang mit dem dünner werdenden Strom der Mittel nicht zaghaft, sondern verantwortungsvoll, und schauen wir uns an einem einfachen Beispiel an, ob wir vom Verlust der wirtschaftlichen Sorglosigkeit nicht auch profitieren können.
Die oberösterreichische Marktgemeinde Pucking etwa ist eine von vielen recht ähnlich anzusehenden österreichischen Landgemeinden. Durch ein hervorragend ausgebautes Straßennetz bestens an den wirtschaftlich maßgeblichen Zentralraum angebunden, ist Pucking für Betriebe und Eigenheimbesitzer gleichermaßen attraktiv. Nicht der ursprüngliche – immerhin noch lebendige – Ortskern prägt das Bild der Gemeinde, sondern die verblüffende Gestaltungsvielfalt der entlang der L563 ausgestreuten Gewerbebauten und Lärmschutzwände, hinter welchen, offenbar unverdrossen, Wohnhäuser in Deckung gehen.
Diesem Umfeld zeigt das in Grieskirchen ansässige Büro Wolf Architektur anhand eines Feuerwehrhauses, wie man öffentlichen Raum ohne den geringsten Verlust an eigenem Nutzen ordnen kann. Der Neubau, der nur aufgrund der Zusammenlegung zweier Standorte seitens der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, erhebt sich, um die Tiefe eines geräumigen Vorplatzes zurückgesetzt, mit seinem Herzstück, der Fahrzeughalle, parallel zur Straße. An die nordöstliche Ecke setzt der Schlauchturm ein eindeutig lesbares Zeichen; im Westen verleiht ein zweites Geschoß den Einsatz- und Vereinsräumen das gebührende Gewicht. Darüber hinaus wird die Zufahrt von einem frei gestellten Pavillon markiert, in dem die Künstlerin Anneliese Schrenk ein historisches Feuerwehrfahrzeug in Szene gesetzt hat. Die Parkplätze für die Privatautos der Feuerwehrleute säumen die Kante dahinter und die von der Straße abgewandte Längsseite des Hauses.
Diese nicht zuletzt dem Ortsbild wohltuende Ordnung von Gebäude und Außenanlagen setzt sich im Inneren des Gebäudes fort. Sie basiert auf den gründlichen, im Vorfeld eines geladenen Architektenwettbewerbes angestellten Überlegungen der Feuerwehr zu ihren eigenen funktionalen Anforderungen. Die in allen Details durchdachte Wegführung unterstützt im Einsatzfall zweifelsfreie Kommunikation und rasches Handeln; sie erleichtert aber auch die Wartung der Anlage, sie wirkt sich positiv auf das Vereinsleben aus, und sie spart viel Geld. Denn Wolf Architektur hat weit mehr als die bloße Umsetzung des gegebenen Organisationskonzeptes geleistet. Das Haus kommt nahezu ohne Erschließungsflächen aus, besitzt jedoch dank einer Vielzahl kleiner Abweichungen vom Gewöhnlichen eine Nutzungsqualität, die mit den streng begrenzten Budgets des Genres üblicherweise nicht erreicht wird. Gleichzeitig hat Wolf Architektur aus der Verdichtung der Abläufe und ihrer Übersetzung ins Gebaute erheblichen gestalterischen Mehrwert gezogen.
Die bedingungslose Funktionalität der Anlage findet in einer ebenso konsequent durchgehaltenen Komposition geometrisch einfacher Körper ihre Entsprechung. Die Verbindung zwischen Außen und Innen wird durch Einschnitte gekennzeichnet, die das Volumen gliedern. So werden die sieben gläsernen Tore der Fahrzeughalle durch das vom Schlauchturm bis zur Einsatzzentrale reichende Vordach beschirmt, die Glasfassade des Schulungsraumes ist einer Dachterrasse zugeordnet, und auch der Haupteingang im Einschnitt an der Südwestecke des Gebäudes wird durch seine Lage ebenso geschützt wie zeichenhaft hervorgehoben. Die Einsatzzentrale darf mit einem über die Ecke geführten Fensterband deutlich sichtbar über Vorplatz und Fahrzeughalle wachen. Weniger prominente Räume wie Büros oder Werkstätten müssen auch belichtet und belüftet werden.
Doch hier bescheidet man sich mit Fenstern, die hinter gelochten Feldern in der feingliedrigen Trapezblechfassade mehr zu ahnen als zu sehen sind. Wolf Architektur hat einige Energie aufgewendet, um handelsübliche Produkte wie die Metallverkleidung aus der Banalität ihres sonst üblichen Einsatzes zu lösen. Die Ausbildung der Belichtungsfelder in der Fassade, aber auch die Detaillierung der Ecken und Anschlüsse, hat ebensowenig Mehrkosten verursacht wie die vom Architekturbüro hartnäckig verfolgte unsichtbare Leitungsführung in der aus unverkleideten Betonfertigteilen und Trapezblechen konstruierten Fahrzeughalle.
Dieser Umstand und wohl auch die Sicherheit, mit den eigenen, vorwiegend auf Funktionalität ausgerichteten Anliegen ernst genommen zu werden, hat die Bauherrschaft dazu bewogen, Wolf Architektur in Gestaltungsfragen auf ein in ähnlichen Zusammenhängen unübliches Niveau zu folgen. Ob Sichtbeton und schwarze Holzwerkstoffplatten nun eher dank ihrer asketischen Anmutung oder doch aufgrund ihrer wartungsfreien Robustheit überzeugen, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Der allem vorangegangene Entschluss der Gemeinde Pucking, die Aufgaben der Bauherrschaftselbst wahrzunehmen und nicht bei einem gewerblichen Bauträger abzuladen, hat das fruchtbare Zusammenspiel von Nutzern und Planern jedenfalls begünstigt und vieles ermöglicht, was anderswo mit einem „das haben wir noch nie so gemacht“ abgeschmettert wird.
Das mag der Ankauf einer speziellenWaschmaschine für die Einsatzkleidung, der Bau eines Platzes zum – übungsweisen – Abfackeln von Autowracks oder die Errichtung eines Schlauch- und Übungsturmes gewesen sein; aber auch der „Luxus“ eines Eingangsbereiches, der die ihm eingeschriebene Verknüpfung aller Wege in lichte Großzügigkeit zu fassen versteht. So verfügt die Freiwillige Feuerwehr Pucking-Hasenuferund mit ihr die Gemeinde Pucking nun über ein Haus, das den Geboten der Sparsamkeit gerecht wird, ohne seinen kulturellen Anspruch preiszugeben: Einsätzen, Schulungen und Übungen wird eine reibungslos funktionierende Bühne und der Gemeinschaft inspirierender Raum geboten. Mehr muss ein Gebäude auch in guten Zeiten nicht leisten.
Im oberösterreichischen Gallneukirchen wurden Kirche und Pfarrhof von Herbert Schrattenecker einer radikal-behutsamen Restaurierung unterzogen. Ergebnis: ein Ort mild gestimmter Ruhe, an dem weder Zeitgeist noch Mode eine Rolle spielt.
Seit Jahrhunderten stehen die katholische Kirche und der dazugehörende Pfarrhof im Zentrum von Gallneukirchen. Daran hat weder das rasche Anwachsen der ehemaligen, zur Stadt erhobenen, Marktgemeinde im Speckgürtel von Linz etwas geändert noch der gesellschaftliche Bedeutungswandel, den Religion seit der Entstehung von Ort und Pfarrgemeinde zweifellos erfahren hat. Dieser hat die Pfarre – sie ist mit ihren etwa 12.000 Seelen immerhin die größte der Diözese Linz – nicht daran gehindert, ihre uralte Verantwortung für die Gemeinschaft wahrzunehmen. Nach der 2007 abgeschlossenen Kirchenrenovierung hat sie eine umfassende Sanierung des Pfarrhofes in Angriff genommen, die den öffentlichen Raum Gallneukirchens nun entschieden bereichert.
Beide Maßnahmen hat der aus Oberösterreich gebürtige und in Wien ansässige Architekt Herbert Schrattenecker geplant. Wüsste man nicht, wie radikal manche seiner Eingriffe waren, man könnte annehmen, Kirche und Pfarrhof wären immer schon so selbstverständlich Stirn an Stirn in leichtem Winkel zueinander gestanden, die südliche Kante eines annähernd dreieckigen Platzes flankierend, dessen Westseite das Rathaus säumt. Tatsächlich hat es an dieser Stelle niemals einen Platz gegeben. Historische Beschreibungen erzählen von Gräben, Stegen, Friedhofsmauern und hölzernen Verbindungsgängen; aber auch von den Schweine-, Kuh- und Pferdeställen des Pfarrhofes, die das Erscheinungsbild des Ortes prägten.
Schon mit der Renovierung der Kirche hat Herbert Schrattenecker die ersten Maßnahmen gesetzt, diese – durchaus physisch – besser zugänglich zu machen. Doch erst durch den Rückbau des über eine Vielzahl baulicher Anläufe entstandenen Pfarrhof-Konglomerates in ein gut proportioniertes und außen wie innen leicht lesbares Gebäude hat die Kirche ein Vis-à-vis bekommen, das ihrem Haupteingang an der Westseite den notwendigen (Außen-)raum lässt. Bereits im ersten Bauabschnitt konnte Herbert Schrattenecker die unbefriedigende Eingangssituation der Kirche durch den Abbruch der beiden massiven Stiegenhäuser zur Empore an der Westfassade deutlich verbessern. Diese Maßnahme ermöglichte die Anordnung zweier zusätzlicher Eingänge, die das große Tor in ihre Mitte nehmen. Ein weit ausladendes Vordach – als Tragwerk raffiniert mit der zweiten Empore verbunden und gekonnt unspektakulär in seiner Anmutung – beschirmt alle drei Zugänge und verleiht so wesentlichen Vorgängen wie dem Sich-Versammeln und dem Noch-Verweilen räumlichen Ausdruck.
Auch das Innere der in ihrem Ursprung mittelalterlichen Kirche entspricht nun wieder den Intentionen und Anforderungen des Gottesdienstes. Nach dem teilweisen Rückbau der ersten und der konstruktiven Erneuerung der zweiten Empore, dem Öffnen der vermauerten Obergaden an der Nordseite, einer behutsamen Neuordnung von Emporenzugängen, Bankreihen, Altarraum und Taufort; kurzum: Kraft einer gründlichen, nicht zuletzt der Einbindung in das hügelige Gelände gewidmeten Überarbeitung ist die Pfarrkirche ein barrierefrei zugänglicher, in unterschiedlichen Konstellationen nutzbarer Ort geworden, in dessen mild gestimmter Ruhe weder Zeitgeist noch Mode eine Rolle spielen.
Der Wandel des Pfarrhofes vom vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Gehöft mit angeschlossenen Wohnräumen zu einem Pfarrzentrum mit all seinen organisatorischen und seelsorgerischen Aufgaben ist bis vor Kurzem wohl ohne rechte Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Nutzung, Erscheinung und Bedeutung vor sich gegangen. Umso größer muss die Versuchung gewesen sein, hier Polaritäten wie alt/neu oder historisch/zukunftsweisend in eindrucksvollen Kontrast zueinander stellend gehörig auszukosten. Herbert Schrattenecker aber ist offensichtlich an der Wirksamkeit seiner Maßnahmen interessiert, nicht an ihrer – vorzugsweise verblüffenden – Wirkung. So war ihm bei der Sanierung des Pfarrhofes etwa das Schaffen von Öffnungen in den dicken Wänden des Hauptstiegenhauses ein wichtiges Anliegen. Tatsächlich haben diese den Weg durch das Gebäude mit Tageslicht erhellt und die Orientierung im Haus deutlich leichter gemacht. Ohne Kenntnis der beengten und düsteren Vergangenheit geht der Eingriff in einem über die Jahrhunderte scheinbar organisch gewachsenen Ganzen jedoch auf. Mit welchem Aufwand an Einfühlungs-, Vorstellungs- und nicht zuletzt Überzeugungsvermögen das heute so selbstverständlich scheinende Ergebnis erzielt worden ist, bleibt unsichtbar. Mit der Erinnerung an das Vorher wird das Bewusstsein für diese Leistung schnell verblassen.
Im Leben der Pfarre allerdings, deren kulturelles Engagement als Bauherrschaft an dieser Stelle hervorgehoben werden soll, ist der Wandel zum Besseren täglich unmittelbar präsent: Fundamente, erdberührte Böden und aufgehende Mauern wurden trockengelegt, eine höherwertige Nutzung der zum Teil aus dem Mittelalter stammenden Räume des untersten Geschoßes somit möglich. Sämtliche Fenster wurden durch dreifach verglaste Kastenfenster ersetzt. Eine innen liegende, mineralische Dämmung der Außenwände schont die denkmalgeschützte Fassade. Geheizt wird mit Erdwärme, nicht mehr mit Öl. Die Wohnungen für Pfarrer und Kaplan wurden auf zeitgemäßen Stand gebracht. Sie sind nun, wie alle anderen Bereiche des Pfarrzentrums – der Mehrzwecksaal, die Büros und auch die verschiedenen Gruppenräume – ohne gegenseitige Störung unabhängig voneinander zugänglich. Nach Einebnung der Niveausprünge innerhalb der Geschoße erschließt überdies ein Aufzug die drei Ebenen des Pfarrzentrums barrierefrei.
An der Nordseite des Bestandes hat Herbert Schrattenecker einen Teil der überlieferten Bausubstanz abgetragen. Dies und die Errichtung eines einheitlichen Daches mit durchgehender Traufe haben aus dem Vorgefundenen einen klaren Körper geformt. Der Haupteingang des Pfarrzentrums liegt, wahlweise über eine Rampe oder eine Stiege vom neuen Platz im Norden her erschlossen und somit zeichenhaft hervorgehoben, in einem schmalen Zubau. Dieser antwortet mit seiner Struktur von Pfeilern und Balken auf das gotische Strebewerk der Kirche, deren Flucht er mit seiner Nordostecke übernimmt. Durch die sorgfältig detaillierte Dachentwässerung vom Bestand getrennt, ist er deutlich als Zubau erkennbar. Doch gerade für diesen einzigen neuen Trakt hat Herbert Schrattenecker alte Ziegel und behauene, aus dem Abbruch des Pfarrhofes gewonnene Steine als Mauermaterial gewählt. Die hier eingesetzte, Jahrhunderte alte, Handwerkskunst und das historische Baumaterial wirken in Kombination mit den Überlagen aus eingefärbtem Sichtbeton und den Eichenholz-Schiebeläden der Fenster wie die Zusammenfassung einer Botschaft: Tradition und Innovation ermöglichen, klug in Zusammenklang gebracht, Qualität ohne Ablaufdatum.
Wenn Bewohner ein Projekt kapern: In Marchtrenk gestaltete das Büro Dornstädter Architekten einen Kindergarten mit großem Entwicklungspotenzial.
Marchtrenk, im oberösterreichischen Hausruckviertel gelegen, ist mit seinen mehr als 12.000 Einwohnern die größte Stadt des Verwaltungsbezirkes Wels-Land. Tendenz: weiter steigend. Das deutet auf ein ausgewogenes Verhältnis der Grundstückspreise zum Gebotenen. Das da wäre: die Lage mitten im wirtschaftlich florierenden Großraum zwischen Linz und Wels, zu dem zwei Autobahnanschlüsse und ein Bahnhof eine direkte Verbindung halten. Auch finden sich mehr als 500 Betriebe mit mehreren tausend Arbeitsplätzen in Marchtrenk sowie ein respektables Angebot an sozialer Infrastruktur.
Was man – noch – nicht bekommt für das Geld: gut gestalteten öffentlichen Raum. Den hat man in der Gemeinde, die während des Ersten Weltkrieges ein Lager für Kriegsgefangene stellte und nach dem Zweiten Weltkrieg einer großen Zahl von Vertriebenen aus Siebenbürgen und Donauschwaben zur neuen Heimat wurde, bisher vielleicht für Luxus gehalten. So ist auch die Roseggerstraße in Marchtrenk Teil eines stellenweise recht schütteren Teppichs frei stehender Siedlungshäuser, in den nur der alte, einst zur Versorgung des Kriegsgefangenenlagers errichtete Wasserturm ein bescheidenes Zeichen setzt. Nun haben aber die Bewohner der Siedlung wesentlich mehr Gemeinschaftssinn, als man angesichts dieses wenig urban anmutenden Stückes Stadt glauben möchte. Sie kaperten kurzerhand das Projekt zum Neubau eines Kindergartens, um ihr Wohnumfeld mit angemessenen Begegnungsräumen nachzurüsten. Das im nahen Traun ansässige Architekturbüro Dornstädter Architekten entwickelte dazu einen mehrstufigen Plan, dessen erster Bauabschnitt, der Kindergarten, kürzlich bezogen wurde. Er schließt die Südflanke des äußerst großzügig bemessenen Grundstücks der Volksschule 2 zur Roseggerstraße hin.
In weiterer Folge sollen die Volksschule selbst und der später hinzugefügte Turnsaaltrakt saniert werden. Ein Zubau im Bereich des bestehenden Verbindungsganges wird das Raumangebot erweitern, um die Nachmittagsbetreuung der Kinder zu ermöglichen. Gleichzeitig versprechen diese Maßnahmen die keineswegs überflüssige Verbesserung des derzeitigen Erscheinungsbildes der Anlage. Anstelle eines desolaten Nebengebäudes der Schule soll ein multifunktionaler Versammlungsraum an der Ecke Roseggerstraße/Neufahrnerstraße den Gemeinschaft stiftenden Charakter der hier versammelten Einrichtungen unterstreichen. Das Büro Dornstädter Architekten hat in der Struktur des Kindergartengebäudes naturgemäß die Zukunft des Ortes vorweggenommen, nicht ohne die Qualitäten der Gegenwart zu würdigen.
Was beibehalten worden ist: eine am Alltag orientierte Schwerpunktsetzung auf die Funktionstüchtigkeit von Räumen und Raumfolgen und die unaufgeregte Bescheidenheit in der Wahl der Mittel. Neu hingegen ist das Bekenntnis zu umfassender und qualitätsvoller Gestaltung, die bei der Beziehung der Räume zueinander beginnt und mit der sorgfältigen Ausarbeitung der Details endet.
Der Kindergarten ist um eine 15 Meter breite Ballspielwiese von der Roseggerstraße weg nach Norden gerückt. Mit seiner westlichen Kante greift er die östliche Flucht des Volkschulgebäudes auf. Parallel zur Nordfassade wird später der Erweiterungsbau der Volksschule stehen. Eine zukünftig gemeinsam bespielte Freifläche davor nutzt im Zusammenhang mit dem an dieser Stelle in den Kindergarten geschnittenen Atriumhof die räumliche Nähe der beiden Institutionen. Damit soll eine Verbindung geschaffen werden, die heutigen Erziehungs- und Bildungskonzepten besser entspricht als die bisher praktizierte strikte Trennung der Häuser.
Der Kindergarten ist ein unprätentiöses eingeschoßiges Gebäude mit einem asymmetrisch den rechteckigen Grundriss überspannenden Satteldach, das auch die den Räumen im Süden vorgelagerte Terrasse vor Witterung schützt. Auf den ersten Blick unterscheidet sich sein Auftritt also kaum von jenem der Einfamilienhäuser rundum. Doch anstelle schmucker Ziegel oder unverwüstlicher Platten bedeckt intensiv bepflanzter Humus den Kindergarten: So wird dieser mit dem nahenden Frühling zum grünen Hügel im reichlich ebenen Landschaftsraum. Auch die zweimal geknickte Dachfläche, die den Weg der Kinder von der Straße bis zum Haupteingang an der Westseite des Hauses beschirmt, ist ein augenzwinkerndes Indiz dafür, dass die scheinbare Harmlosigkeit der gewählten Form wohlüberlegt ist und – anders als üblich – mit der Ausformung der Innenräume korrespondiert. Tatsächlich reichen diese allesamt bis unter die Dachkonstruktion, die durch den Hof an der Nordseite und drei kleinere Einschnitte entlang der Südfassade strukturiert wird. Da sich die Organisation des Grundrisses mit dem Auf und Ab der Dachlandschaft präzise deckt, unterstreicht diese den jeweiligen Charakter der unterschiedlichen Nutzungsbereiche.
Über den Haupteingang an der Westseite des Hauses und den dahinterliegenden Windfang gelangt man in eine multifunktionale Halle. Linker Hand erschließt ein kurzer Gang das Büro der Leiterin, den Personalraum und die Küche. An ihrer Nordseite wird die Halle vom Atriumhof flankiert. Ihre südliche Kante wird von drei Gruppenräumen begrenzt, die jeweils über einen niedrigeren eingeschobenen Körper mit Garderobe und Nasszelle zugänglich sind.
Der den ganz Kleinen gewidmete Trakt des Hauses ist nach Osten orientiert: Ein breiter Gang im rechten Winkel zur Halle erschließt die drei Gruppenräume der Krabbelstube auf der einen und einen Bewegungsraum auf der anderen Seite. Alle Erschließungsflächen verfügen über mindestens eine großzügige Öffnung ins Freie. Auch die Gruppenräume sind über den Filter ihrer Terrassen mit dem Umfeld verbunden. Verschiebbare transluzente Sonnenschutzelemente an der Kante des Daches verhindern eine Überhitzung auf der Südseite und verleihen dem Außenraum Intimität.
Die Dachausschnitte über den niedrigeren Garderobenbereichen lassen Licht von oben einfallen, was der Orientierung zugute kommt. Auch im Inneren des Kindergartens hat das Büro Dornstädter Architekten die Einschnitte aus der großen Form zum Aufbau von Blickbeziehungen – etwa zwischen den Spielpodesten der Gruppenräume und der Halle – und zur Schaffung abwechslungsreicher Belichtungssituationen genutzt. Bei der Wahl der Materialien und Farben hingegen hat es sich weitgehend zurückgenommen: Der außen mit einer hell lasierten vertikalen Fichtenholzschalung mit großer Sorgfalt verkleidete massive Holzbau ist – unter beträchtlichem Planungsaufwand – an seiner Innenseite zur Gänze unbehandelt sichtbar geblieben und spricht mit seinen schönen Oberflächen auch Tast- und Geruchssinn an. Helle Holzböden in den Aufenthaltsräumen und schlichter geschliffener Estrich in den Erschließungsbereichen vervollständigen bereits eine Hülle, in der sich der Alltag in ungebremster Farbigkeit entfalten kann.
Ein Wohn- und Geschäftshaus aus dem 16. Jahrhundert; dazu ein Revitalisierungskonzept, das zeigt, wie ein historischer Ortskern umsichtig an unsere Zeit angepasst werden kann. Und ein Einkaufszentrum, das trotz Glücksversprechen nicht zum langen Verweilen einlädt. Alles zu sehen in Ried im Innkreis.
Ried im Innkreis ist zu Recht stolz auf seine historische Innenstadt; und hat dennoch ein Problem mit seinen schmucken Bürgerhäusern, die, dicht gepackt, schmale Gassen säumen und malerische Plätze rahmen. Was den kulturbewegten Sinn erfreut, ist nach heutigen Vorstellungen von Komfort oder auch nur in der Erfüllung technischer Standards in hohem Grade mangelhaft. Ungenügender Lichteinfall, zu schmale Gänge, gefährlich steile Stiegen drücken Nutzungsqualität und Vermietbarkeit der Objekte bis zum Leerstand herab. Gleichzeitig schwebt über allen Städten, denen die Mobilität ihrer Bürger noch kein schlüssiges Konzept wert war, die Frage: wohin mit den Autos? Die Antwort darauf liegt gerade in Ried, dessen Kern auf Sumpfland errichtet und daher nur spärlich unterkellert wurde, nicht auf der Hand.
Herbert Schrattenecker, Architekt in Wien, ist der Region seiner Herkunft, dem Innviertel, mit ebenso unkonventionellen wie feinfühligen Bauten verbunden geblieben. Er entwickelte für eines der ältesten Gebäude von Ried, das seit 1598 urkundlich belegte Wohn- und Geschäftshaus Nimeth, ein Revitalisierungskonzept, in dem die Forderungen nach Funktionalität und Wirtschaftlichkeit eng mit Überlegungen zu Konstruktion, Raum, Licht, Stadtbild und den Ansprüchen des Denkmalschutzes verwoben sind. Das Objekt besteht aus zwei schmalen, am Hauptplatz gelegenen Häusern, die über einen gemeinsamen Innenhof belichtet wurden und mit ihren daran schließenden Hinterhäusern bis zur Kirchengasse reichten. Ab etwa 1900 wurde die Bausubstanz in mehreren Etappen zu einem geschlossenen, in seinem Inneren kaum noch belichteten oder belüfteten Volumen verdichtet, das zum Zeitpunkt des Kaufs durch seine heutige Eigentümerin leer stand. Nur die Geschäftsräume im Erdgeschoß waren vermietet: ein Umstand, auf den bei der Planung und während der Bauausführung naturgemäß Rücksicht genommen werden musste.
Heute fasst die Anlage neben dem Geschäftslokal mit seinen Nebenräumen zwölf Wohnungen mit Nutzflächen zwischen 60 und 180 Quadratmetern. Ihnen sind jeweils private Freiräume – Loggia, Garten oder Terrasse – und ein Garagenplatz zugeordnet. Herbert Schrattenecker hat dem Haus durch den Rückbau seines Volumens Luft verschafft. Die Obergeschoße gruppieren sich erneut u-förmig um einen Innenhof, während im Erdgeschoß das ursprüngliche Durchhaus an der westlichen Grundgrenze wieder vom Hauptplatz zur Kirchengasse führt. Ein historisches und ein neues, von einem Lift ergänztes Stiegenhaus erschließen von dieser Passage aus die offenen Laubengänge vor den Wohnungen. Da nahezu das gesamte Erdgeschoß und Teile des dem Hauptplatz zugewandten Traktes unter Denkmalschutz gestellt wurden, legte Herbert Schrattenecker die Garage in die Mitte des ersten Obergeschoßes; sie ist über eine Rampe von der Kirchengasse erreichbar.
Auch die historisierende, aus dem 20. Jahrhundert stammende Fassade zum Hauptplatz hin ist als Denkmal geschützt und musste erhalten werden. Sie bildet die ursprüngliche Zweiteilung der Bausubstanz ab, was im Bereich der Vorderhäuser mit ihrer erhaltenen einstigen Trennmauer durchaus den gebauten Tatsachen entspricht. Wesentlich spannender ist der Auftritt des Hauses zur Kirchengasse hin. Die Revitalisierung der Liegenschaft war nicht zuletzt konstruktiv eine große Herausforderung. Herbert Schrattenecker meisterte sie, indem er im Bereich der neuen Gebäudeteile ein Geflecht aus Balken und schlanken Stahlbetonrippen über die aus dem Bestand weitergeführten tragenden Mauern legte. Er bediente sich also einer leichten, robusten und im Grunde seit Jahrhunderten gebräuchlichen Technologie, die kleine Abweichungen in den Grundrissen gut kompensiert. Diese Struktur und mit ihr die Lage der Geschoße zeichnen sich durch helle horizontale Faschen an der Fassade ab.
Im Bereich der Garagenauffahrt und des Durchhauses an der westlichen Grundgrenzehält der Neubau bewusst Abstand zum Nachbarn und gibt über eine große Öffnung den Blick ins Innere des Hauses frei: Tageslicht fällt von oben in die historische Passage; neben der Rampe steigt das neue Stiegenhaus in die Höhe; und über dem Rhythmus der Decke ahnt man im Hintergrund das lichte Volumen des Innenhofes. Der Hof gibt dem Haus eine kommunikative Mitte, die von seinen Bewohnern auch für gemeinsame Aktivitäten genutzt wird. Mit seinen Laubengängen, Nischen, Balkons weckt er die Erinnerung an historische Beispiele, ohne sein Entstehungsdatum zu verschleiern. Die Wahl derMaterialien – weiß verputztes Ziegelmauerwerk, Naturstein und Holz für die Böden der Aufenthaltsräume – vermittelt ebensolche Gediegenheit wie die sorgfältig auf größtmögliche Schlankheit ausgelegten Details.
Die Bauherrschaft hat nicht gegeizt und legte die Ausführungsqualität auf Augenhöhe mit dem räumlichen Anspruch des Objektes an. Herbert Schrattenecker wiederum stellte dieser Großzügigkeit seinen nimmermüden Planungseinsatz zur Seite. Das Ausbilden feiner Putz-Hohlkehlen an den Rippendecken der Wohnungen, die Anordnung einer zweiten Türe zur Vermeidung eines unnötigen Weges, die diskrete Anpassung des denkmalgeschützten Stiegenhauses an geltende Sicherheitsstandards und das Öffnen kleiner, wirkungsvoller Tageslichtschneisen: Alle Maßnahmen sind von der Freude an den unerschöpflichen Möglichkeiten der Raumgestaltung getragen und von der Klugheit, sie mit Bedacht und Sparsamkeit einzusetzen.
Während das revitalisierte Stadthaus Nimeth als ein über die Stadtgrenzen von Ried hinaus vorbildhaftes Projekt zeigt, wie historische Ortskerne behutsam an die Bedürfnisse unserer Zeit angepasst werden könnten, ist etwa zeitgleich ein 22.000 Quadratmeter umfassender Komplex entstanden,der Bemühungen dieser Art lauthals spottet. Das neue, keine 500 Meter weit vom Hauptplatz entfernte Einkaufszentrum gibt sich nicht mit der euphemistischen Bezeichnung „Weberzeile“ zufrieden. Mit unverhohlenem Desinteresse hält es der Stadt auch noch ein paar die Kleinteiligkeit der Vergangenheit linkisch vortäuschende Fassadenstücke entgegen. Gleich daneben greift der Trichter seiner Glasfassade nach jenen Passanten, die der Unwirtlichkeit eines dem Auto zur Gänze preisgegebenen Straßenraumes trotzen. Das Wichtigste ist schließlich die Tiefgarage: 800 Plätze, für zwei Stunden gratis! „Alles, was glücklich macht“ lautete das Eröffnungsmotto im August. Ja dann.
In Pregarten im Mühlviertel wurde ein Schulkomplex von Karl und Bremhorst Architekten völlig neu gestaltet. Veränderbare Klassenzimmer, Gruppen- und Arbeitsräume umschließen einen „Marktplatz“. Das Highlight: ein Hallenbad.
Die Stadt Pregarten im unteren Mühlviertel hat ein neues Bildungszentrum. Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 in Betrieb genommen, bietet es einer Polytechnischen Schule mitsamt ihren Werkstätten, einer Mittelschule, der Stadtbibliothek sowie der Volkshochschule Raum. Der von den Siegern eines internationalen Architekturwettbewerbs, den in Wien ansässigen Karl und Bremhorst Architekten, geplante Gebäudekomplex hat ein älteres Schulgebäude ersetzt; der Werkstätten- und der Turnsaaltrakt, welcher – eine Rarität! – ein Hallenbad einschließt, wurden als Bestand übernommen und sorgfältig erneuert in die Anlage einbezogen.
Nähert man sich dem Schulzentrum, das im Süden des Ortskernes fußläufig weniger als zehn Minuten vom Stadtplatz entfernt liegt, findet man sich im Alltag einer rasch gewachsenen ehemals ländlichen Gemeinde mit Autobahnanbindung in den Ballungsraum wieder: Eigenheime, kleinmaßstäblicher Geschoßwohnbau, das eine oder andere Gewerbeobjekt und ein Gehöft, das wohl schon bessere Zeiten gesehen hat, prägen das Umfeld. Karl und Bremhorst Architekten hat das Bildungszentrum mit einiger Behutsamkeit in diesen diffus anmutenden Stadtraum gesetzt.
Der Neubau ist in drei ineinander greifende zweigeschoßige Körper mit annähernd quadratischen Grundflächen gegliedert, die sich parallel zur Straße vom Bestand weg Richtung Norden aneinander reihen. Auch der Turnsaaltrakt wurde straßenseitig um ein Galeriegeschoß erhöht. So respektiert das Bildungszentrum den Maßstab der Nachbarschaft, allerdings ohne sich den hier gültigen Gestaltungsvorstellungen anzuschließen. Seine glatten weißen Körper mit ihren langen Fensterbändern und den korrespondierend eingeschnittenen Lufträumen vermeiden unschöne Sprünge und plumpe Details. Klarheit, Ruhe und Disziplin sind Begriffe, die man mit solcher Architektur verbindet.
Dieses in seinem Auftritt angelegte Versprechen löst das Bildungszentrum im Schulalltag mehrfach ein. Die Gliederung der Gebäude entspricht den unterschiedlichen Nutzungsbereichen der Anlage: Ihr Haupteingang liegt im mittleren der drei Neubauten, die den zur Straße offenen Eingangshof umschließen. Über einen gläsernen Windfang gelangt man in die von einem Atrium flankierte Aula. Dahinter liegen erdgeschoßig die Räume der Polytechnischen Schule, während der Baukörper rechts des Einganges zur Gänze der Mittelschule zugeordnet ist. Auf der linken Seite geht es zu den von beiden Einrichtungen genutzten Räumen wie der Lehrküche oder den Musik- und den Werkräumen. Die Stadt- und Schulbibliothek hat, über einen zweiten Eingang unabhängig vom Schulbetrieb erschlossen, ebenso in diesem Baukörper Platz gefunden wie die Schulküche und der daran grenzendemultifunktionale Essbereich. Dahinter geht es weiter zu den Turnsälen und zum Hallenbad, das an Vormittagen nur den Schülerinnen und Schülern für ihren Schwimmunterricht zur Verfügung steht. Der eingeschoßige Werkstättentrakt schließt die Reihe ab. Weiter im Süden sind noch die Gebäude, Becken und Grünanlagen des Freibades, der „Lagune“ von Pregarten, auf dem Grundstück verblieben.
Die deutliche Gliederung der Baumassen kommt nicht nur der Maßstäblichkeit des Bildungszentrums zugute, sondern erleichtert auch die Orientierung. Karl und Bremhorst Architekten hat überdies für eine hohe Variabilität der Räume gesorgt. Diese wird zunächst durch die Konstruktion gewährleistet: Der Skelettbau mit seinen schlanken, vorgefertigten Stahlbetonstützen und den weit gespannten Hohldielendecken konnte schnell und kostengünstig errichtet werden; er lässt spätere Änderungen der Raumaufteilung ohne großen Aufwand zu. Das ist insofern von Bedeutung, als die derzeitige Organisation der Grundrisse in überschaubaren Einheiten die räumliche Antwort auf ein neues, im Vorfeld des Architekturwettbewerbs von einem Expertenteam partizipativ entwickeltes pädagogisches Konzept ist.
Der enge Zusammenhang zwischen den Methoden des Lehrens und Lernens und dem dafür vorgesehenen Raum wurde für dieses Projekt also auch seitens der Schulbehörde in den Blick genommen. Die bisher die Raumprogramme des Schulbaues dominierende strikte Aufteilung in Klassenzimmer und Erschließungsflächen wurde zugunsten einer Gliederung aufgegeben, die dem Zusammenleben einer Gemeinschaft – zu der sich der oft weit in die Nachmittagsstunden dauernde Schulalltag ja längst entwickelt hat – besser gerecht wird: In ihren Grenzen veränderbare Klassenzimmer, Gruppenräume und Arbeitsräume für die Lehrenden umschließen eine „Marktplatz“ genannte Mitte, die von einem Innenhof ergänzt wird.
Diese Mitte dient als Arbeits-, Bewegungs- und Versammlungsraum und ermöglicht freies, mitunter klassenübergreifendes Unterrichten ebenso wie den Wechsel zwischen Lern- und Erholungsphasen. Die Gestaltung des Bildungszentrums bietet all diesen Szenarien einen ruhigen, heiteren Hintergrund. Eine diszipliniert klein gehaltene Palette an Oberflächen – weiße Wände, Naturstein- und Holzböden sowie Holzfenster – überlässt das Spiel mit Farben oder Formen den Nutzerinnen und Nutzern. Die Übergänge zwischen den Materialien sind ebenso sauber gelöst wie jene zwischen den Innen- und den Außenräumen. Das ist angesichts der Komplexität, die das in hohem Maß wärmegedämmte Gebäude den Wand- und Deckenaufbauten abverlangt, eine nicht zu unterschätzende Leistung.
Ein Gestaltungselement, mit dem Karl und Bremhorst Architekten die unterschiedlichen Charaktere der Räume unterstreicht, ist das Tageslicht. Während die Klassenzimmer und Arbeitsräume sich durchwegs nach außen orientieren, werden die Marktplätze vom warmen Licht der mit Holz ausgekleideten Höfe erfüllt und Binnenräume durch Reihen von Lichtkuppeln rhythmisch erhellt. Offenheit und Weitblick, aber auch Konzentration und Geborgenheit: Das Bildungszentrum Pregarten bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern einen Arbeits- und Lebensraum, der vieles möglich macht. Als Pilotprojekt für ähnliche Bauaufgaben hat es den Nachweis erbracht, dass sich Schule ungeachtet ihrer medienwirksam behaupteten Versteinerung weiterentwickelt. Es gibt allerdings noch viel zu tun.
In der Osttiroler Gemeinde Kals verbindet sich Tradition mit Zeitgenössischem auf würdige Weise. Das Architektenteam Schneider & Lengauer hat ohne Berührungsängste ein neues Kulturzentrum an einen alten Gasthof angedockt.
Verantwortung übernehmen – dieser Vorgang ist in der öffentlichen Wahrnehmung rar geworden. Dasüberrascht nicht, verbinden wir mit diesem Begriff heute doch eher Fehltritt und Schuld als Pflicht und Treue. Für qualitätsvolles Bauen allerdings ist Verantwortung im Sinne von Sorgfalt und Verlässlichkeit ebenso notwendig wie eine gehörige Portion an Mut und Zuversicht.
In der Osttiroler Gemeinde Kals am Großglockner trägt man diese Verantwortung seit 20 Jahren. Während andernorts gemeindeeigene Vorhaben zur Vermeidung jedweder Angreifbarkeit rasch an gewerbliche Bauträger weitergereicht werden, hat man in Kals die Aufgabe der Bauherrschaft auf sich genommen und die Gestaltungshoheit über die eigene Zukunft bewahrt.
Ein geladener, von der Tiroler Dorferneuerung begleiteter Architekturwettbewerb im Jahr 1995 stand am Anfang dieses Prozesses. Der früher dicht verbaute Ortskern von Kals war infolge einiger Gebäudeabbrüche zu einem unwirtlichen Autoabstellplatz verkommen. Man suchte Strategien zur Entwicklung einer neuen, lebendigen Ortsmitte. Die im oberösterreichischen Neumarkt im Mühlkreis ansässigen Architekten Peter Schneider und Erich Lengauer haben diesen Wettbewerb gewonnen und in jahrelanger Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern des Ortes die Umsetzung seiner einzelnen Bauabschnitte begleitet. Seither sind im Zentrum von Kals der multifunktionale Service- und Informationsstandort Glocknerhaus und das Haus de Calce mit der Gemeindeverwaltung, der Feuerwehr, Bergrettung und Bergwacht entstanden; das spätgotische Widum wurde behutsam für diePfarre revitalisiert; zuletzt hat Schneider & Lengauer mit dem Kulturhaus Kals ein Objekt fertiggestellt, das dem Zusammenleben der Einheimischen wie der Verbesserung destouristischen Angebotes dient.
Die Neubauten bilden gemeinsam mit der Pfarrkirche und dem Widum einen Kern, der zeigt, wie ein Ort sein Gesicht mit der Zeit verändern kann, ohne seinen Charakter preiszugeben oder sich hinter leeren Floskeln vermeintlich traditionellen Bauens zu verschanzen. Die Themen – der Raum zwischen den Gebäuden, die ebene Fläche, die man den steilen Hängen abgewinnt oder der Blick in den Landschaftsraum – sind über die Jahrhunderte ebenso gleich geblieben wie die Frage nach dauerhaften Materialien und Technologien, die Standort und Standpunkt gleichermaßen repräsentieren.
Die Antworten, die Schneider & Lengauer darauf gibt, sind ebenso bestimmt wie ruhig im Tonfall; sie zeigen keine Berührungsängste vor historisch gewachsenen Bauformen und kommen dennoch unmissverständlich aus der Gegenwart; das Spektakel ist ihnen sichtlich kein Anliegen, wohl aber die äußerst konsequente und somit doch wieder außergewöhnliche Durcharbeitung der Entwurfsgedanken. Das zuletzt fertiggestellte Kulturhaus Kals ist ein besonders schönes Beispiel dafür. Als Bauplatz diente der Standort des alten, nun abgebrochenen Gemeindeamtes in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem ursprünglich aus den 1930er-Jahren stammenden Gasthof. Der lang gestreckte Körper des Kulturhauses ist an seiner nordwestlichen Flanke mit dem Bestand des Gasthofes verbunden. Von hier aus schiebt er sich hinaus in die enge Kurve, mit der die Kalser Landstraße ihren steilen Anstieg nach Norden bewältigt. Mit seiner südwestlichen Stirnseite stellt sich das Kulturhaus parallel zum Widum, das sich giebelständig am Scheitel der Kurve erhebt. Der massiv gemauerte und weiß verputzte, von einem hellen Steinsockel abgesetzte Körper des Neubaues mit einer einzigen, asymmetrisch gesetzten Öffnung in der Giebelwand kommt der lapidaren Funktionalität des historischen Gebäudes ebenso nahe wie seiner aus der Reduktion erwachsenden Würde. Gemeinsam bilden Alt- und Neubau ein Tor, hinter dem sich der Raum zu einem Platz mitmehreren Ebenen weitet, an dem die prominenten Gebäude des Ortes liegen.
Das Kulturhaus birgt mehrere Funktionenund wird daher von mehreren Eingängen auf unterschiedlichen Ebenen erschlossen. Den Weg in den Gasthof hat Schneider & Lengauer durch die Anordnung einer großzügigen Terrasse geebnet. Darunter liegt, vonder Straße her barrierefrei erreichbar, das Foyer des etwa 300 Personen fassenden Johann-Stüdl-Saales. Der Saal umfasst das gesamte oberirdische Volumen des nach Südwesten freigestellten Traktes und ist bis zum First mit Zirbenholz, im Sockelbereich der Wände mit bosnischem Travertin verkleidet. Dieser in seiner Farbigkeit mit dem Holz harmonierende Stein prägt auch das Foyer und die Erschließungszonen in den beiden allgemein zugänglichen Geschoßen des Kulturhauses. Während auf der unteren Ebene die Räume des Gemeindearztes mit ihrem alsSeniorentreff ausgestatteten Wartebereich liegen, schließt im Geschoß darüber ein dem Gasthof zugeordneter Raum an die Galerie des Johann-Stüdl-Saales.
Hier greifen eine schlichte, den Raum fassende Sitzbank, die Wandverkleidung aus Zirbenholz und der gemauerte Ofen vertraute Motive auf. Die unbeirrt geradlinige Behandlung der Details und Einzelheiten wie die unterschiedlich großen Fenster mit ihren abgeschrägten Leibungen schieben der Allgegenwart des Gastronomiekitsches, sei er nun nostalgisch oder zeitgeistig inspiriert, einen festen Riegel vor. So ist es Schneider & Lengauer hier wie in der gesamten Anlage gelungen, dem legitimen Bedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer nach Gemütlichkeit ebenso gerecht zu werden wie dem eigenen Anspruch auf intellektuelle Redlichkeit und planerische Konsequenz. Möglich wurde dasdurch ihre Fähigkeit, in der Vielfalt heute zu Gebote stehender Technologien zu echter Gediegenheit zu finden – und durch dieWeitsicht ihrer Bauherren, die das als Wert erkannt und die entsprechenden Entscheidungen getroffen haben.
Alljährlich vergeben, alljährlich jede Aufmerksamkeit wert: die Bauherrenpreise – Anmerkungen zum heurigen Jahrgang.
Gestern war es so weit: Im Rahmen eines feierlichen Festaktes im Wiener Odeon wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des Bauherrenpreises der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs – ZV – bekannt gegeben. Es wurden jene Menschen geehrt, deren Beitrag zum Gelingen beispielhafter Architektur aus guten Gründen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden soll.
Der Bauherrenpreis der ZV ist ein prominenter Preis. Das liegt zunächst am hohen Qualitätsniveau, das die Ausschreibung fordert. Gesucht waren immerhin: „exzeptionelle Lösungen, die in intensiver Kooperation von Bauherren und Architekten realisiertwurden, die in architektonischer Gestalt und innovatorischem Charakter vorbildlich sind und darüber hinaus einen positiven Beitrag zur Verbesserung unseres Lebensumfeldes leisten“.
Um mit dem Auswahlverfahren nicht hinter die Ernsthaftigkeit des eigenen Anspruchs zurückzufallen, organisiert die ZV die Entscheidungsfindung in zwei Stufen: In jedem Bundesland besichtigte eine eigene Nominierungsjury die eingereichten Objekte – österreichweit heuer 110 an der Zahl – und nominierte maximal vier davon für den Bauherrenpreis. Die Hauptjury, bestehend aus der ZV-Präsidentin – der Architektin Marta Schreieck –, dem Architekturpublizisten Otto Kapfinger und dem Architekten Zvonko Turkali, machte sich dann auf ihre vier Tage währende Besichtigungsreise und wählte aus 27 vorgeschlagenen Objekten die sieben Preisträger des Jahres 2014 aus.
Die Architektenschaft treibt also einen erheblichen Aufwand, um Bauherren dafür zu ehren, ihre ureigenen Interessen gewahrt zu haben. Denn wem, als der Bauherrschaft selbst, ist denn zunächst gedient, wenn ein Projekt gut, ja vorbildlich gelingt? Das ist zweifellos richtig.
Dennoch ist der Rückzug vieler Entscheidungsträger auf die einfach berechenbaren Kennwerte eines Bauwerks in einer nahezu undurchschaubar komplex gewordenen Welt zumindest nachvollziehbar. Oder erklärt die Überfülle an technischen und kulturellen Möglichkeiten die Anspruchslosigkeit eines bestürzend großen Anteils heute agierender Auftraggeber? Solange ein Gebäude nicht einstürzt, seine Funktionen einigermaßen erfüllt und ungefähr das kostet, das man für seine Errichtung auszugeben bereit war, ist man zufrieden. Was erlaubt ist, das gefällt, und mit den Auswirkungen eines Projektes auf sein Umfeld setzt man sich nur auseinander, wenn man seitens einer Behörde dazu gezwungen wird.
Da sind die von der ZV ausgezeichneten Bauherren aus einem völlig anderen Holz geschnitzt: „Das Kennenlernen, die Wertschätzung, das gegenseitige Anhören und Zuhören und das uneingeschränkte Vertrauen bildeten die Grundlage für alle Entscheidungen.“ So schildert etwa Heinz Tesar die Zusammenarbeit mit den Halleiner Schwestern Franziskanerinnen, für die er den – nun ausgezeichneten – Neubau ihres Generalrats in Oberalm im Bundesland Salzburg geplant hat. Die Ordensfrauen haben die Wahl ihres Architekten mit Hilfe eines sorgfältig vorbereiteten Architekturwettbewerbes getroffen und dabei großes Augenmerk auf die umfassende Kommunikation ihrer Bedürfnisse gelegt.
Mit der Diözese Gurk ist eine zweite katholische Institution mit dem Preis der ZV ausgezeichnet worden. Die ebenfalls aus einem geladenen Architekturwettbewerb als Sieger hervorgegangenen Winkler + Ruck Architekten aus Klagenfurt haben den ehemaligen Probsthof in Gurk zur Schatzkammer umgedeutet. Der ausdrückliche Wunsch der Bauherrschaft, der Verwendung heimischer Baumaterialien wie dem Lärchenholz ebenso den Vorzug zu geben wie lokal ansässigen Handwerksbetrieben bei der Auftragsvergabe, zeigt ihr Verantwortungsbewusstsein für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung eines Projektes.
Diese einem Bauprojekt innewohnende Gestaltungsmacht hat sich die Gemeinde Ischgl, die heurige Preisträgerin in Tirol, zunutze gemacht. Die gesamte Dorfgemeinschaft hat den Bau des vom Innsbrucker Architekturbüro Parc geplanten Kulturzentrums mitgetragen und freut sich nun über einen Ort in ihrer Gemeinde, der weder dem Geschäft noch der Dienstleistung gewidmet ist.
Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbewusstsein für das Umfeld prägen das Handeln des burgenländischen Preisträgers, Johannes Stimakovits. Heri&Salli aus Wien haben für ihn den Neubau seines Firmengebäudes in Steinberg-Dörfl geplant. Face of buildings ist zwar auf die Detailplanung von Stahl-Glas-Fassaden spezialisiert. Der neue Firmensitz ist dennoch ein konstruktiver Holzbau geworden, dessen prägnant gefaltete Hülle aus vorgefertigten Elementen hauseigene Entwicklungen wie Schiebefenster oder Beschattungsanlagen experimentell mit dem Baustoff Holz umsetzt. Viel eher als Lebenswelt denn als Arbeitsstätte konzipiert, ist der Bau nicht zuletzt das Ergebnis einer regen Beteiligung der Mitarbeiter an den Entscheidungsprozessen.
Ein Kollektiv als Bauherrschaft – der Werkraum Bregenzerwald –, das gleichzeitig die Ausführung des eigenen Gebäudes in jahrelangem Austausch mit dem für die Planung gewonnenen Architekten, Peter Zumthor, realisiert und sich dabei als Pionier ebenso bodenständiger wie experimentierfreudiger Handwerkskunst erweist: Das ist der heurige Preisträger des Bundeslandes Vorarlberg.
Auch das eine der beiden Wiener Preisträger-Projekte ist mit der Hilfe von Eigenleistungen seiner Nutzer umgesetzt worden: die von Gaupenraub +/– geplante Vinzirast – mittendrin in der Währinger Straße. Der Verein Vinzenzgemeinschaft Sankt Stephan, Cecily Corti und Doris Kerbler haben ein leer stehendes, von Hans Peter Haselsteiner gespendetes Biedermeierhaus in eine Wohn- und Arbeitsstätte für obdachlose Menschen und Studierende verwandelt. Das angeschlossene Lokal ohne Konsumzwang führt auch einer breiten Öffentlichkeit vor Augen, dass hohe Planungsqualität und angemessene Bescheidenheit gut harmonieren.
Die Auszeichnung der Gemeinnützigen Bau-, Wohn-, und Siedlungsgenossenschaft Neues Leben für den Pan-Wohnpark in der Wiener Ernst-Melchior-Gasse schließlich würdigt eine ganz ähnliche Haltung. Die drei von Werner Neuwirth (Wien), von Ballmoos Krucker Architekten (Zürich) und Sergison Bates architects (London) geplanten Häuser bieten ihren Bewohnern unter der Einhaltung der üblichen Kostenlimits eine räumliche Vielfalt, die Begriffen wie Individualität und Gemeinschaft gleichermaßen gerecht wird.
Die nominierten und preisgekrönten Objekte des ZV-Bauherrenpreises 2014 werden in einer Sonderausgabe des Architekturmagazins „architektur.aktuell“ und im Rahmen einer Ausstellung (ab 17.November zunächstim Wiener Ringturm) der Öffentlichkeit vorgestellt.
Bauen Sie schon oder diskutieren Sie noch? Im neuen Kultur- und Schulzentrum Feldkirchen an der Donau schaffen Freiluftklassen und Wintergärten ein heiteres Flair für lustvolles Lernen und Arbeiten.
In Feldkirchen an der Donau ist kürzlich eine Geschichte zu Ende gegangen, die 2005 mit einem EU-offenen zweistufigen Architekturwettbewerb begonnen hat. Das Wiener Büro von Fasch & Fuchs hat diesen Wettbewerb für die Planung eines Schul- und Kulturzentrums gewonnen und in zwei Bauphasen realisiert. Insbesondere mit dem gestern feierlich eröffneten Schulgebäude ist ein Objekt entstanden, das der seit Langem schwelenden Debatte um Schule und Bildung in unserem Land so manche Spitze nehmen könnte: indem es lustvolles Lernen und Arbeiten räumlich sichtbar macht.
Die erste Bauphase galt der Erneuerung eines bestehenden Turnsaaltraktes, dem Probelokal der örtlichen Musikkapelle sowie dem Neubau einer Musikschule, die nun gemeinsam das Kulturzentrum bilden. Dieses liegt an einem großzügigen, durch das Verschwenken der Schulstraße nach Norden entstandenen Vorplatz, der allmählich bis zum Haupteingang im Obergeschoss des Kulturzentrums ansteigt. Die Musikschule hat, durch zwei begrünte Atriumhöfe auch in ihrer Mitte belichtet, unter diesem künstlichen Hügel Platz gefunden. Sie bildet gemeinsam mit dem auf der Eingangsebene gelegenen Musikheim und den im Süden anschließenden Turn- respektive Mehrzwecksälen eine vielfältig nutzbare Anlage, die den Ort Feldkirchen selbst ebenso bereichert wie die beiden in der zweiten Bauphase entstandenen Schulen.
Auch hier ist das Thema eines großen Ganzen, das dem Kleinen, individuell gestaltbaren, Raum zur Entfaltung bietet, als leitendes Motiv umgesetzt. Fasch & Fuchs haben die aus einem gut erhaltenen Bestand hervorgegangene Mittelschule und den Neubau der Volksschule in einem Haus zusammengefasst. Dieses folgt mit zwei Vorsprüngen, die aus der Geometrie der ehemaligen Hauptschule abgeleitet sind, etwa dem Verlauf der nach Norden verschwenkten Schulstraße. Der neu errichtete Trakt der Volksschule verfügt somit ebenfalls über einen großzügigen, von Bäumen beschatteten Vorplatz, der die Schulen mit einem angemessen repräsentativen, einladend wirkenden Außenraum im Gefüge des Ortes verankert.
Der Haupteingang der beiden Schulen liegt im Neubau. Durch den als Schmutzschleuse funktionierenden Windfang gelangt man nicht mehr, wie früher, in eine unwirtliche Zentralgarderobe. Vielmehr öffnet sich unmittelbar beim Eintritt eine luftige Halle über alle drei Geschosse und weiter durch ihr gläsernes Dach nach oben. Sie lädt mit einer in den ersten Stock ansteigenden Flucht von Sitzstufen ein, sich zunächst einmal niederzusetzen und vielleicht den Text zu entziffern, den der Künstler Hermann Staudinger in metallisch schimmernden Buchstaben auf die Brüstungen um den Luftraum geschrieben hat. Die Halle verbindet die beiden Schulen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. An ihren Rändern haben gemeinschaftlich nutzbare Zonen wie der Essbereich, die Schulbibliothek oder Räume für die Nachmittagsbetreuung Platz gefunden.
Der nach dem Abriss der desolaten Volksschule notwendig gewordene Neubau erstreckt sich westlich von Haupteingang und Halle. Im Erdgeschoß sind übergeordnete Nutzungen wie das Büro der Direktorin, der Aufenthaltsraum für das Personal, Werkräume und die Schulküche – im Schulzentrum Feldkirchen wird täglich frisch gekocht – untergebracht. Die beiden Obergeschosse sind den Klassenzimmern gewidmet, wobei diese Bezeichnung, am Gewohnten gemessen, hier nicht zutrifft. Vielmehr wird ein annähernd quadratischer Bereich an seinen Ecken von gläsern abgetrennten Räumen belegt, in denen die Schülerinnen und Schüler jeweils zweier Klassen zweier Jahrgänge ihre persönlichen Sachen, Sessel und Tische vorfinden.
Auch die Arbeitsplätze der Lehrenden, mit interaktiven Whiteboards auf der Höhe der Zeit ausgestattet, befinden sich in diesen Räumen. Dazwischen liegen wiederum gemeinschaftlich genutzte Zonen mit Teeküche, veränderbaren Schiebekästen und mobilen Sitzelementen. Ein eigener Arbeitsraum für die Lehrenden und die notwendigen Sanitär- und Nebenräume vervollständigen ein Raumangebot, das viel eher an eine große Wohnung als an eine Schule denken lässt. Eine Wohnung allerdings, wie sie wohl nicht jeder kennt: Das außen von einer feinen horizontalen Schalung umfangene Gebäude zeigt im Inneren ohne Scheu den Sichtbeton. Die Räume sind hell grundiert; kräftige Farbakzente erleichtern die Orientierung. Weiße Lamellen aus Dämmstoff hauchen einen zarten Rhythmus an die Decken, durch den kreisrunde Beleuchtungskörper und Lichtkuppeln fliegen.
Die heitere Stimmung im Haus ist nicht zuletzt dem starken Bezug zum Freiraum zu verdanken, den Fasch & Fuchs mit allen zu Gebote stehenden Mitteln hergestellt haben. In beide Längsseiten des Neubaues sind Loggien eingeschnitten, die mit Glaswänden zu Wintergärten verschlossen werden können. Breite beschattete Balkone über dem Haupteingang und zum Garten hin sowie geräumige, als Freiluftklassen nutzbare Loggien an der Stirnseite der Volksschule laden zum Aufenthalt im Freien ein. Die hier angeordnete Stiege erfüllt, wie ihr Pendant am gegenüberliegenden Ende des Schulzentrums nicht bloß ihre Funktion als Fluchtweg, sondern stellt auch eine gern genutzte Verbindung in den Garten dar.
Der östlich an die große Aula anschließende Trakt der ehemaligen, zur Mittelschule erhobenen Hauptschule wurde im Zuge der Bauarbeiten thermisch saniert. Seine von einem zentralen Stiegenhaus mit flankierendem Luftraum geprägte Grundstruktur blieb bestehen. Die vorgefundene Einteilung in Klassenräume wurde ebenfalls beibehalten, diese jedoch mit Glaselementen in ihren Eingangsbereichen stärker an die Erschließungszone angebunden. Denn das Schaffen neuer Wege und Beziehungen ist hier nicht nur im Großen, sondern auch in der Form vieler kleiner, mit erheblicher Detailgenauigkeit gestalteter Situationen präsent.
Es scheint, als hätten Fasch & Fuchs Erich Kästners Ansprache zum Schulbeginn – sie ist es, die die Brüstungen der Aula ziert – sehr ernst genommen. Das Kultur- und Schulzentrum Feldkirchen ist ein Haus ohne „abgesägte überflüssige“ Stufen, in dem man nach Herzenslust „treppauf und treppab“ gehen kann, wie in einem gelungenen Leben.
Und aus Ruinen hebt sich die Vergangenheit... Unmittelbares Nebeneinander von repräsentativer Geste und Verfall: Aus der Burg Reichenstein im Mühlviertel wurde nun das Burgenmuseum Reichenstein.
Es sind drei Gemeinden: Tragwein, Pregarten und Gutau, die sich das Gebiet der kleinen Ortschaft Reichenstein im oberösterreichischen Mühlviertel teilen. Das Selbstverständnis Reichensteins bezieht sich seit dem frühen Mittelalter auf die Burg, die der Ortschaft ihren Namen gibt. Sie erhebt sich – zum Teil Ruine, zum Teil bewohnt – über dem bewaldeten Felsen, den die mäandrierende Waldaist hier in einer großen Schlinge fasst. Ihre wie überdimensionierte Zinnen in den Himmel ragenden Mauerreste mit leeren, wiewohl von intakten Steingewänden gefassten Öffnungen auf der einen Seite des Burghügels und der von einem Zeltdach bekrönte Turm auf der anderen prägen das Ortsbild seit je. Die letzte große Veränderung Reichensteins ist weitgehend unsichtbar geblieben. Wir haben es nicht mehr mit der Ruine, sondern mit dem Oberösterreichischen Burgenmuseum Reichenstein zu tun, das im Laufe einer langjährigen Projektierungs- und einer infolge sorgfältiger archäologischer Erhebungen ebenfalls ausgedehnten Bauphase entstanden ist. Eine aus den Architekten Christian Hackl, Norbert Haderer, Herbert Pointner und Harald Weiß gebildete Projektgemeinschaft hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt einen Zubau entwickelt, der die Anlage durch neue Räume zum Museum ergänzt, ohne ihr über Jahrzehnte vertraut gewordenes Erscheinungsbild stark zu verändern.
Die erste urkundliche Erwähnung einer befestigten Anlage auf dem Gipfel des Felsens datiert aus dem Jahr 1230. Ein einfacher Wehrturm wurde bald durch ein lang gestrecktes Wohnhaus, ein Wirtschaftsgebäude und eine vorgelagerte Ringmauer ergänzt. Zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts entschloss man sich zum weitgehenden Abbruch und errichtete eine neue, wesentlich größere Burg, die jedoch in ihrer Kompaktheit nach wie vor die beengten Platzverhältnisse auf dem Felssporn widerspiegelte. Aus dieser Epoche stammt die heute noch intakte Burgkapelle. Dem großzügigen Ausbau der Burg zu einem Renaissance-Schloss ab dem späten 16. Jahrhundert war weniger Glück beschieden: Der Initiator der Umgestaltung, Ritter Christoph Haym, wurde kurzerhand vom Anführer seiner ob der hohen Steuern zur Finanzierung des ehrgeizigen Projektes erbosten Bauern ermordet; und obwohl bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts der Wandel von der Wehranlage zum repräsentativen Adelssitz dann doch vollzogen war, mussten die Neubauten an der Südwestseite des Burghügels – wohl dem unsicheren Baugrund geschuldet – bald wieder abgebrochen werden.
Mit dem Wegfall einer Nutzung begann der Verfall der Anlage. Die gezielte Entfernung der Decken und Dächer im frühen 19. Jahrhundert besiegelte den Niedergang zur Ruine. Die Schlosskapelle jedoch wurde weiter als Pfarrkirche genutzt, das unmittelbar anschließende „Aiststöckl“ als Schulgebäude und der ehemalige Torbau mit seinem markanten Turm als Wohnung des Pfarrers. So sind die Gebäude in bemerkenswert gutem Zustand erhalten geblieben. Im Jahr 1988 formierte sich ein Verein zur Sanierung der erst 1948 unter Denkmalschutz gestellten Ruine. Man errichtete – historisierend – einenTreppenturm und rang der alten Hauptburg mit Hilfe von Betonkonstruktionen wieder einige gedeckte Räume ab.
Die Aufgabe, ein Museum in dieses heterogene und zum damaligen Zeitpunkt keineswegs vollständig erforschte Gebilde zu fügen, beantwortete die Projektgemeinschaft Hackl/Haderer/Pointner/Weiß mit mehreren Entwürfen. Doch erst der Vorschlag, das Volumen des gesamten Neubaues im Hügel zu versenken, fand die Zustimmung des Bundesdenkmalamtes. Eine Probebohrung zur Prüfung des Baugrundes war auf keine nennenswerten Einbauten gestoßen. Umso größer war die Überraschung, als bei weiterführenden Grabungsarbeiten ebenso massive wie gut erhaltene Mauern, Bögen und Gewölbe zum Vorschein kamen. Diese galt es nun für immer abzubrechen oder in den Neubau zu integrieren, wozu man sich – eine vollständige Neuplanung in Kauf nehmend – entschied.
Die Raumfiguration wurde den historischen Bauteilen angepasst, diese wurden so weit wie möglich auch in tragender Funktion eingesetzt. Das Museum findet in einer Halle Platz, deren flaches Dach im Einklang mit dem Bestand von Ost nach West abfällt und die Fläche des Burghofes nahezu verdoppelt. Ihr ist im Süden eine Terrasse vorgelagert, deren Parapet von einer der alten Burgmauern gebildet wird. Die Südfassade des Museums mit dem Haupteingang und jener Teil der östlichen Stirnseite, der aus dem Gelände ragt, werden von einer unregelmäßig vertikal geteilten Lärchenholzfassade gebildet, in der vereinzelte Glasschlitze den Blick in die Landschaft freigeben. An der Ostseite der Halle führt eine Gitterstiege aus rostfarben beschichtetem Stahl – kostengünstiger als echter Rost! – auf das Niveau des Burghofes, der an seinem westlichen Ende auch über eine auf begrünten Stützmauern ruhende Rampe erreichbar ist. Die tragende Stahlbetonkonstruktion des Neubaues ist dunkelgrau gestrichen; dunkel ist auch der hölzerne Boden, der durch feuchtigkeitsdurchlässige Kiesstreifen von den vorgefundenen Mauerteilen getrennt bleibt; dunkel die eingebauten Stahlteile wie die Treppe, die den kleinen Einschub eines Obergeschoßes an der hohen Ostseite des Museums erschließt und weiter hinauf zum Burghof führt.
Die historischen Bauteile hingegen werden mit Ausstellungsstücken aus der Sammlung des Museums mit Licht in Szene gesetzt. Damit wird die doppelte Bedeutung der Einrichtung unterstrichen: In Reichenstein hat man nicht nur Gelegenheit, sich anhand der jeweiligen Ausstellung über gesichertes Wissen zu informieren. Die hier praktisch unverändert erhaltenen Fundstücke laden nach wie vor zu ihrer Erforschung ein. So ist etwa die ursprüngliche Nutzung eines sechseckigen Steinbeckens mit darunter liegendem, auffallend niedrigem Gewölbe – sind es Teile eines mittelalterlichen Badehauses, einer dekorativen Brunnengrotte? – noch nicht restlos geklärt.
Reichenstein hat als Ort für kulturelle Veranstaltungen eine lange Tradition, die neue Impulse aus dem Museumsbau erhält. Das unmittelbare Nebeneinander von repräsentativer Geste und Verfall und die enge Verbindung von Architektur und Landschaftsraum schaffen, jetzt noch deutlicher um den Dialog von Alt und Neu bereichert, eine Atmosphäre, der man sich nicht leicht entziehen kann.
Eine Aussichtsplattform mit Weitblick und ein revitalisierter Heustadel, beides in der Unesco-Welterberegion Hallstatt/Salzkammergut: Und was bedeutet „Weltkulturerbe“ eigentlich? Eine Annäherung.
Weltkulturerbe: In diesem Begriff schwingt vieles mit. Was den einen als wirksamer Schutzmechanismus wertvollen Kulturguts erscheint, dient den anderen als schlagkräftiges Instrument zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs, während wieder andere den Blick vor allem auf die Einschränkungen richten, die so eine der ganzen Welt vermachte Erbschaft mit sich bringt. Bautätigkeit im Weltkulturerbe bedarf jedenfalls einer positiven Stellungnahme seitens der Unesco. Zwei Objekte am Hallstättersee zeigen, wie unterschiedlich man die Frage nach dem angemessenen Bauen auf weltkulturgeweihtem Boden beantworten kann.
Steigen wir zunächst auf den Salzberg – wir können auch die Seilbahn nehmen; denn die Aussichtsplattform, die der Linzer Ingenieur Erhard Kargel im Bereich des Einganges zum historischen Salzbergwerk für die Salzwelten GmbH Hallstatt geplant hat, ist vom Seeufer kaum sichtbar: ein schlanker Flügel aus Stahl, der sich, mit einer im Flugzeugbau häufig eingesetzten Farbe beschichtet, nur zart vor dem Himmel abzeichnet. Der Eindruck, dass wir es hier mit einem Minimum an Bauwerk bei gleichzeitig maximalem Ausdruck seiner Funktion zu tun haben, verfestigt sich, sobald wir die Plattform aus der Nähe sehen. In der Verlängerung einer vorgefundenen Stützmauer über dem Grundriss eines schlanken Dreiecks entwickelt, lehnt sie sich, verblüffend fragil anmutend, weit in den Abgrund hinaus. Ein Hohlkasten aus Stahlblech, an der Bergseite durch das Gegengewicht einer Betonplatte gehalten, wird im Querschnitt wie im Grundriss zur Spitze hin immer schlanker. Ein feines Netz aus Edelstahl zeichnet die Kontur der Plattform nach. Leicht nach innen geneigt, vermittelt es Besuchern Sicherheit, ohne das Panorama zu verstellen. So treten wir hinaus, um den „Weltkulturerbeblick“ zu genießen. Dabei tut es gut zu wissen, dass die Verjüngung der Tragkonstruktion nach vorne ebenso der Stabilität dient wie die Dreiecksform des Grundrisses: An der Spitze hat nur ein Mensch Platz, während weiter hinten, dem Auflager zu, mehrere stehen können.
So schauen wir also hinunter auf Hallstatt und den von abrupt aufragenden Bergen umschlossenen See. Gegenüber, an seinem östlichen Ufer, liegt, von einer bewaldeten Halbinsel verdeckt, eine Hütte. Ursprünglich als Heustadel errichtet, wird sie seit Jahrzehnten nicht mehr als solcher, doch nach wie vor im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des umliegenden Grundstückes genutzt. Ihre längst überfällige Revitalisierung war selbst für das in ähnlichen Aufgaben höchst erfahrene Architekturbüro Luger & Maul aus Wels keine leichte Aufgabe: Die Organe der Unesco konnten sich mit keinerlei Änderung des von außen wahrnehmbaren Erscheinungsbildes der Hütte anfreunden. Denn dieses ist Bestandteil des Weltkulturerbes. So befindet sich nun hier, auf dem Gemeindegebiet von Obertraun, der wohl am aufwendigsten revitalisierte Heustadel der Welt. Mögen die Nutzungsanforderungen auch bescheiden sein: Ein trockener Boden, intakte Wände und eine stabile Dachkonstruktion sind als Voraussetzungen heute nicht mehr verhandelbar. So haben Luger & Maul sich nach genauer Vermessung des Bestandes daran gemacht, diese unter Wahrung des ursprünglichen architektonischen Ausdrucks zu schaffen. Die vier brüchig gewordenen Steinpfeiler an den Ecken der Hütte wurden fachgerecht restauriert und innen mit einer verputzten Vorsatzschale aus Glasschaum gedämmt; der Boden der Hütte wurde abgegraben, gedichtet und gedämmt wieder aufgebaut; die Wände zwischen den Steinpfeilern wurden als gedämmte Holzkonstruktion mit einer vertikalen Schalung aus Lärchenholz ergänzt; und die drei Fenster in ihrer vorgefundenen Größe wurden ebenfalls aus Lärchenholz erneuert.
Über das Innere der nun mit Holzschindeln gedeckten und bis zu den geschnitzten Zierbrettern an den Ortgängen dem „Original“ entsprechenden Hütte wurde seitens der Unesco nicht befunden. Es ist – Erhard Kargels Aussichtsplattform nicht unähnlich – dem Gedanken der Reduktion auf das Wesentliche verpflichtet. Ein Tisch, eine Bank, eine Kochstelle, ein Schlafplatz sowie ein WC und eine Dusche haben auf etwa 35 Quadratmeter bebauter Fläche Platz gefunden. Der Raum wirkt dennoch hell und großzügig. Die Sorgfalt, mit der Luger & Maul ihn gestaltet haben, übersteigt die ursprünglichen Ansprüche der Anlage bei Weitem, ohne den Rahmen des Ortes zu sprengen. Im Gegenteil: Hier – wie auch in der sachte verfeinerten Ausformung der Hülle – werden alte Traditionen nicht bloß oberflächlich nachgeäfft, sondern tatsächlich aufgegriffen und weiterentwickelt. Jedes Detail des in möglichst ungestörter Geometrie vollkommen mit geölter Weißtanne ausgekleideten Raumes trägt ebenso zur Funktionalität bei wie zur Vervollkommnung des Gesamteindrucks. Der von den Fenstern schlicht gerahmte Blick in die Landschaft gehört nun als ganz wesentliches Element dazu.
Was wir heute am Hallstättersee als Weltkulturerbe bewahren wollen, ist in Gebäuden und Anlagen festgeschriebener Alltag von Bergbauern und Bergleuten. Was wir in Form malerischer Ausblicke genießen, brachte für sie in hohem Maß Mühsal und Bedrohung mit sich. Den Zeugnissen ihrer längst versunkenen Welt mit Respekt zu begegnen bedeutet auch, sich am Vorbild ihrer Klugheit, ihres Erfindungsreichtums und nicht zuletzt ihres ästhetischen Anspruchs zu orientieren. Erhard Kargel hat mit seiner Aussichtsplattform gezeigt, wie man ein Bauwerk ganz ohne Leihgaben aus dem Formenvokabular vergangener Zeiten harmonisch in die alpine Landschaft fügt; Luger & Maul haben mit der von ihnen revitalisierten Hütte eine nicht minder schwierige Aufgabe gemeistert: das scheinbar Historische ohne Abgleiten in den Zynismus zu gestalten.
Auf dem Rückweg nach Hallstatt zweigen wir noch kurz von der Hauptstraße Richtung Seeufer ab. Hier befindet sich seit Kurzem das im „authentischen Baustil des Salzkammergutes“ errichtete „Resort Obertraun“. Gut und gerne 30 „Chalets“ genannte Doppelhäuser hat hier jemand ohne jede Ambition zur Bildung nutzbarer Außenräume in bautechnisch nicht nachvollziehbarer Mischung aus verputzten und mit Holz verkleideten Fassaden auf die Wiese geworfen. Auch so kann man Weltkulturerbe interpretieren. Für die Unesco jedenfalls scheint das kein Problem zu sein.
Neue Wirtschaftlichkeit oder Armseligkeitsgebot? Anmerkungen zum sozialen Wohnbau – und zu einem aktuellen Vorschriftenkatalog aus Oberösterreich.
Wem würde es heute noch einfallen, an der Wahrheit des branchenübergreifend allgegenwärtigen Satzes: „Wirhaben kein Geld“ zu zweifeln? Und wie sollte ein Mangel, der vom beständigen Anziehen der Abgabenschraube über Sparmaßnahmen im Bildungswesen bis zum Zurückfahren der Entwicklungshilfe offenbar so vieles begründet, vor dem geförderten Wohnungsbau haltmachen?
Wer wollte es also Manfred Haimbuchner, dem oberösterreichischen Landesrat für Wohnbau, Naturschutz und Sparkassenaufsicht verdenken, wenn sein Ressort einen Standardausstattungskatalog gebiert, dessen Umsetzung in den grundlegenden Funktionen des Wohngebäudes zu gravierenden Einsparungen führen kann, ohne die Qualität des Wohnens selbst negativ zu beeinflussen?
Lesen wir doch das Papier – die Ausschnitte sind kursiv geschrieben –, während wir uns einen Wohnbau der letzten Jahre anschauen. Etwa die 2012 fertiggestellte Anlage der GWG an der stark befahrenen Linzer Humboldtstraße. Das in Linz ansässige Büro R2 Architekten hat die beiden einander gegenüberliegenden Häuser geplant. Sie fassen neben 28 Mietwohnungen eine Kinderbetreuungseinrichtung und eine Tiefgarage. Beide Häuser haben sechs oberirdische Geschoße. Das ist gut, denn es sind grundsätzlich mindestens drei oberirdische Geschoße ohne Dachgeschoß, also EG + 1.OG +2.OG + allfälliges Dachgeschoß zu errichten. Ob das Zurücksetzen der Dachgeschoße in Zukunft gestattet wäre? Kann doch der Ausnahmefall, im Randbereich des Grundstückes an eine vorhandene, niedrigere Bebauunganzugrenzen, hier nicht bemüht werden. Die zweigeschoßige Nische, mit der das Haus Humboldtstraße 3a und 5 dem Kindergarten eine witterungsgeschützte Haltebucht einräumt, ist dann mit Sicherheit nicht mehr genehmigungsfähig. Große Vor- und Rücksprünge in der Fassade sind zu vermeiden.
Auch der seichte Glaserker im ersten Obergeschoß, aus dem die Kinder Ausschau in den Straßenraum halten können: verboten. Glasflächen, für deren Reinigung technische Hilfsmittel wie Hebebühnen, Steiger und dgl. erforderlich sind, dürfen nicht ausgeführt werden. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass Teile des Glases bedruckt oder gar emailliert sind; ein Luxus, den die neuen Richtlinien unterbinden werden. Aber wozu sich mit Kleinigkeiten am Rande aufhalten? Die Fassaden beider Häuser sind mit metallisch schimmernden Platten belegt. Mit dieser robusten und relativ leicht zu säubernden Hülle gelingt zwar das Kunststück, dem bislang von Sexshops und Wettspelunken geprägten Straßenzug ein Stück seiner ursprünglichen Gediegenheit zurückzugeben. Doch was zählt schon die beharrliche schrittweise Reparatur innerstädtischer Problemquartiere! Vorgehängte Außenwandverkleidungen mit Blech, Keramik usw. dürfen nicht ausgeführt werden. Fassadenbegrünungen– an den Hofseiten gesichtet! – dürfen nur in Ausnahmefällen (Vorgabe der Baubehörde) ausgeführt werden.
Immerhin haben die R2 Architektenselbst im Licht der neuen Standards einiges richtig gemacht: Einfache, funktionale Grundrisse sind zu planen; auf die Verwendung von Standardmöbeln ist zu achten. Auf ein einfaches statisches Konzept in wirtschaftlicher Hinsicht ist zu achten. Eine Teilunterkellerung ist anzustreben. Die hierum fünf Zentimeter überschrittene Ausführung der Raumhöhen von 250 cm ist in anderenBundesländern üblich undsollte nicht das große Problem sein. Aber: Passivhausqualität?! Dämmstärken nur in jenem Ausmaß, wie dies zur Erreichung des vorgegebenen Mindestenergiestandards notwendig ist. Gingen wir in diesem Sinn weiter durch die Häuser, die in aller Bescheidenheit ihren Bewohnern Raum, Licht und Luft einräumen, wir fänden mit Sicherheit noch zahlreiche weitere Verstöße gegen das neue oberösterreichische Armseligkeitsgebot, das – selten wirkt das Wort so drohend – offen ist: allfällige Ergänzungen bzw. Änderungen werden bei Bedarf vorgenommen.
Und wir haben uns noch nicht mit Wege zur Wirtschaftlichkeit II befasst! Hier wird nun endlich in Zahlen gegossen, woran sich Generationen von Architektinnen und Architekten scheinbar erfolglos abgemüht haben. Der wahre soziale Wohnungsbau lässt sich nämlich, jawohl, berechnen! Aus dem Verhältnis von Flächen – den nutzbaren und den allgemeinen, den Dachflächen, Fensterflächen, Fassadenflächen und so weiter – zueinander; in steter Rückkoppelung mit der Anzahl der Wohneinheiten. Für die Zuordnung zu einer Größenklasse gilt die Anzahl der baubewilligten Wohnungen unabhängig von der zuerrichtenden Anzahl von Baukörpern. Viel Freude beim Entwerfen! Schon möglich, dass solche Rahmenbedingungen zu kreativen Höhenflügen inspirieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass der soziale Wohnungsbau nun endgültig den kulturell weniger zimperlichen Bauträgern mitsamt ihren Planern überlassen werden wird, ist allerdings größer; und der Verdacht, dass der Anstrengung nicht einmal aus wirtschaftlicher Sicht Erfolg beschieden sein wird, leider mehr als berechtigt. Keller und Tiefgarage: kein Wand- und Deckenanstrich.
Glaubt wirklich jemand, mit Repressalien dieser Art das Ruder der Kostenentwicklung herumzureißen, sodass Wohnen leistbar bleibt? Ist schon jemand auf die Idee gekommen, sich dem Thema ein wenig umfassender und womöglich unter Einbeziehung der Expertinnen und Experten, der verantwortungsbewussten Bauträger und der Architektenschaft nämlich, zu widmen? Sieht jemand den Zusammenhang zwischen der Qualität innerstädtischen Wohnungsbaues und dem auch ökonomisch längst nicht mehrverkraftbaren Anwachsen der Speckgürtel? Wie wäre es, die verfügbaren Fördermittel gezielt gegensteuernd einzusetzen?
Denn für mich steht hier der Mensch im Mittelpunkt. Ist das Quartier, das den Einkommensschwächsten täglich ihre Armut vor Augen stellt, nicht eher ein Pulverfass als ein Mittelpunkt? Niemand, der auch nur im Entferntesten die Wahl hat, wird freiwillig in die auf unbewehrten, unverputzten Teilkellern mit Schwindrissen ruhenden und in jeder Hinsicht auf das Geringste heruntergerechneten kompakten Baukörper ziehen. Die mäßige Bepflanzung der Restflächen und die Außenbeleuchtung: Minimalausführung werden daran nichts ändern. Wir sind hier die Avantgarde des österreichischen Wohnbaus. Um einen solchen Anspruch stellen zu können, Herr Landesrat, mussman mehr leisten, als auf den Stapel bereits geltender Normen ein weiteres Regelwerk zu legen, in dem vor allem eines zum Ausdruck kommt: das tiefe Missverständnis, Baukultur mit Luxus gleichzusetzen. Die Frage, wie man Steuermittel klug und zur Mehrung des Allgemeinwohls einsetzen kann, ist auch im sozialen Wohnungsbau höchst komplex. Doch wer auf Weiterwursteln setzt, riskiert, dass demnächst jemand unter lautem Hallo verdammt einfache Antworten gibt.
Hoher Anspruch für Normalverbraucher: Auch geförderte Wohnbauten profitieren von gelungener Architektur. Nahe dem Stadtgeschehen, aber dennoch Privatsphäre – neu in Wels.
Braucht sozialer Wohnungsbaudenn die Architektur? Ist doch von der allgemeinen Ausstattung einer Anlage über die Mindestgrößen der Räume bis zu den bauphysikalischen Kennwerten der Bauelemente ohnedies alles von den jeweiligen Wohnbauförderungsstellen vorgeschrieben.
Manche Bundesländer machen durch die Vorlage der Projekte in Gestaltungsbeiräten sogar die Einhaltung ästhetischer Mindeststandards zur Bedingung für die Vergabe von Förderungsmitteln. Was könnte da noch schiefgehen? Oder anders gesagt: Wie viel Innovationsspielraum bleibt denn da selbst für engagierte Architekturbüros? Hertl Architekten aus Steyr haben für die Linzer Wohnungsgesellschaft EBS in Wels ein Wohngebäude geplant, das sich allen Vorgaben der Branche inklusive dem allgegenwärtigen ökonomischen Druck beugt und dennoch ein erfrischend eigenständiges Bild bietet.
Das Haus erhebt sich viergeschoßig an der Kreuzung der Anton-Bruckner- mit der Wallererstraße. Die Gegend ist von Wohnbauten kleinen und mittleren Maßstabes und durch die Konzentration mehrerer Schulen geprägt; nicht weit entfernt, im Norden, liegt das Welser Krankenhaus; die historische Innenstadt im Süden, jenseits der Bahntrasse, ist selbst zu Fuß in ungefähr 20 Minuten erreichbar; ein angenehmes Wohnumfeld also, das die Entscheidung, hier geförderte Eigentumswohnungen zu errichten, plausibel macht.
Der Bauplatz selbst ist nicht groß. Das über einem rechteckigen, parallel zur Anton-Bruckner-Straße ausgerichteten Grundriss entwickelte Gebäude füllt ihn, unter Einhaltung der Abstandsbestimmungen, fast zur Gänze aus. Ein Eckhaus mit geringen Distanzen zu den Nachbarn verlangt nach genau jenem kompakten Körper, den die Sparsamkeit in Errichtung und Betrieb des Hauses längst geboten hat. Hertl Architekten haben daher das gesamte Raumprogramm, auch die privaten Freiräume, mit einer rundum gleichen Hülle gefasst.
So gewinnt das Haus Volumen, Eindeutigkeit und eine heiter gestimmte Imposanz. Die mit leichter Hand über die Fassaden verstreuten Öffnungen unterschiedlicher Größe signalisieren Eigenständigkeit bei gleichzeitiger Akzeptanz der auch hierorts den Ton angebenden gedämmten und verputzten Außenwand. Erst auf den zweiten Blick sieht man, wie groß der Spielraum ist, den das scheinbar absichtslose Muster den Architekten in seiner Ausarbeitung gelassen hat: Die Öffnungen sind in Größe und Lage sorgfältig auf die Himmelsrichtungen und die Anforderungen der hinter den Fassaden liegenden Räume abgestimmt.
Der Haupteingang in das Haus liegt an der annähernd von Ost nach West verlaufenden Anton-Bruckner-Straße. Eine kleine Loggia wird von einem Fahrradabstellraum, dem Müllraum und dem Stiegenhaus flankiert. Die Eingangsebene ist weitgehend den Gemeinschaftsräumen, darunter einer dem Kinderspielplatz benachbarten Waschküche, vorbehalten. Nur an der Südwestecke haben Hertl Architekten eine Wohnung mit einem kleinen eigenen Garten angeordnet.
Der Erschließungskern liegt in der Mitte der Nordfassade. Die zweiläufig um einen Aufzug geführte Stiege ist natürlich belichtet. Sie erschließt jeweils vier Wohnungen im ersten und im zweiten sowie drei Wohnungen im dritten Obergeschoß. Daraus ergibt sich eine im Vergleich zur Größe des Objektes erhebliche Vielfalt an Wohnungstypen, die eines gemeinsam haben: eine eigene, nach Süden orientierte Loggia, die dank der durchgehenden Lochfassade echte Privatheit bietet. Die kleineren Wohnungen liegen alle an der Südseite des Hauses, die größeren schauen nach jeweils drei Himmelsrichtungen, was an sich schon eine im Wohnbau selten gewordene Qualität darstellt.
Die Grundrisse sind, wie das Haus selbst, äußerst kompakt, alltagstauglich und tatsächlich barrierefrei konzipiert. Hier fehlt kein Raum, weder für die Schuhe und Mäntel noch für das Bügelbrett oder den Staubsauger; Hertl Architekten haben aber auch keinen Kubikzentimeter vergeudet. Doch vermitteln gerade die geräumigen Wohnküchen im unmittelbaren Zusammenhang zu den Loggien den Nutzerinnen und Nutzern ein Gefühl der Großzügigkeit, das gut zur gediegenen Ausstattung des Objektes passt. Helle Holzböden, unauffällige Keramikoberflächen in den Nassräumen und Fenster aus Kunststoff gehören mittlerweile zwar ebenso zum Kanon des geförderten Wohnungsbaues wie die unvermeidliche Tiefgarage; doch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Unterstützung von Heizung und Warmwasseraufbereitung heben den gebotenen Komfort doch deutlich über den Durchschnitt.
So ist also zu hoffen, dass die eine oder andere Familie ihre Kinder hier nicht der Not, sondern der Neigung gehorchend großziehen wird: Dieses Haus bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern jedenfalls eine faire Chance, die aus der Dichte der Stadt erwachsenden Vorteile zu genießen, ohne den legitimen Wunsch nach angemessener Privatheit hintanstellen zu müssen.
Wohnbauten dieser Art sind von großem Wert, will man versuchen, die verheerenden Folgen der umfassenden Zersiedelung Österreichs einzudämmen. Es fällt wohl sehr schwer, den vielen Menschen, die sich das Heil vom eigenen Heim im Grünen erhoffen, zu sagen: Träume, was du willst, aber nicht (mehr) auf Kosten der Allgemeinheit. Zu groß ist nicht zuletzt der Leidensdruck, den städtebaulich fragwürdige und in ihrer Ausgestaltung unbrauchbare Wohnbauten ausüben.
Die immer enger werdenden Budgets haben die Situation nicht verbessert: Es finden sich inzwischen namhafte Architekturbüros, die Wettbewerbsbeiträge mit Schlafzimmern ohne Fenster abliefern. Aus dieser Doppelmühle fehlgeleiteter Fördergeldströme auf der einen Seite und sich selbst gebärenden Mangels auf der anderen könnte man sich vielleicht mit einem beherzten Schlag befreien; oder durch das beharrliche Setzen vieler kluger Züge, wie das Wohnhaus der Hertl Architekten für die Linzer EBS einer ist.
Sie sehen: Architektur macht den Unterschied. Gerade in Situationen, die angeblich ohne Alternative sind.
Welche Räume für den Nachwuchs geeignet sind, weiß man inzwischen. Wie man diese erlangt, ist dagegen noch nicht ganz gesichert – doch gibt es bereits positive Versuche. Ein Besuch in Linz.
Was erwarten wir von der Institution Schule? Wo und von wem sollen Kinder und Jugendliche betreut und erzogen werden, wenn ihre Eltern dafür keine Zeit haben? Das Dienstrecht der Lehrer - ob alt oder neu - wird diese Fragen nicht beantworten. Doch Schulerhalter und Gemeinden reagieren auf die unleugbar vorhandenen Bedürfnisse der Bevölkerung und nehmen mit der Bereitstellung angemessener Räume die Antworten teilweise vorweg. So hat die Stadt Linz mit Schulbeginn 2013 ihr Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen um fast 500 Plätze erhöht. Ein Besuch im Schülerhort Spaunstraße zeigt, wie hoch die Stadt respektive ihre ILG genannte Immobiliengesellschaft den Wert räumlicher Qualität im Umgang mit einem gesellschaftlich sensiblen Thema ansetzt.
Geplant haben den Neubau des Schülerhortes Grabner/Konrad Architektinnen, ein junges, in Linz ansässiges Team, das die ILG mit seinem Erweiterungsbau des Bundesrealgymnasiums Linz Hamerlingstraße auf sich aufmerksam gemacht hat. Den Gewinnerinnen eines seitens der Bundesimmobiliengesellschaft ausgeschriebenen Architekturwettbewerbes ist es gelungen, den zusätzlichen Raumbedarf in einer bereits weitläufigen Anlage zu decken und diese gleichzeitig klarer und übersichtlicher zu gestalten.
Das Schulgebäude zeigt dem Stadtraum nun eine neue, die unterschiedlichen Bauetappen ruhig fassende Fassade. Die großzügige, von einer Glasfuge erhellte Loggia vor dem Haupteingang findet in einer von störenden Einbauten befreiten Halle ihre Fortsetzung, die den Blick in einen überraschend weiten Grünraum freigibt. Dieser wird von neuen, in das Gelände eingesenkten Baukörpern gegliedert, in denen die Schulbibliothek, Musikräume sowie ein teilbarer Mehrzwecksaal untergebracht sind. Von eingeschnittenen Atrien erhellt, bereichern diese Räume den Schulkomplex mit ihrer kontemplativ gestimmten Heiterkeit.
Neben der Sanierung und Erweiterung eines Gymnasiums für mehr als 850 Schülerinnen und Schüler nimmt sich der Neubau eines Hortes mit sechs Gruppenräumen klein und einfach aus. Umso mehr Detailgenauigkeit haben Grabner/Konrad in die Planung fließen lassen. Der Schülerhort liegt in einem „Neue Welt“ genannten Stadtteil von Linz, der von kleinmaßstäblichen Wohnhäusern und ihren Gärten geprägt ist. Ein wenig von der namengebenden Spaunstraße abgerückt, gibt das Gebäude einen Teil seines Bauplatzes dem öffentlichen Raum zurück und lässt Platz für eine fußläufige Verbindung zu Sportplätzen in der Nähe.
Die gewählte Grundrissform eines nicht ganz regelmäßigen Ypsilons gliedert sowohl den Außen- als auch den Innenraum und stellt die Wahrung des Maßstabes sicher: Die drei Stirnseiten des Schülerhorts entsprechen in ihren Proportionen jenen der Wohnhäuser, allerdings ohne sich ihrer Architektursprache zu bedienen. Das zweigeschoßige, als konstruktiver Holzbau errichtete Gebäude ist mit einer Schalung aus vertikalen Lärchenholzlatten verkleidet, aus der weiße glatte Aluminiumrahmen unterschiedlich tiefe Außenräume schneiden.
Einer dieser Rahmen markiert den Haupteingang an der Nordwestecke des Gebäudes, der über eine gedeckte Vorzone und einen gläsernen Windfang in die Erschließungszone des Schülerhortes führt. Diese weitet sich, eine Kurve nach Südwesten beschreibend, nach innen auf und dient den Kindern als zusätzlicher Bewegungsraum. Die einläufige Treppe an der straßenseitigen Fassade führt unmittelbar vom Eingang in das Obergeschoß. Auf beiden Ebenen öffnet sich das breite Ende der Erschließungszone gläsern zum Garten. Hier nehmen die Kinder mittags das Essen ein, das in der Küche im Erdgeschoß gewärmt wird. Der deutliche Bezug zum Außenraum ist ein wichtiges Motiv der Raumgestaltung: Alle Gruppenräume, die beiden Bewegungsräume und auch der Aufenthaltsraum der Betreuerinnen haben einen Ausgang entweder auf eine der Loggien oder in den Garten. Dank der Ausblicke und der klaren Organisation der Grundrisse orientiert man sich leicht in diesem Haus. Die konsequent ab einer Höhe von 1,40 Metern verglast ausgeführten Trennwände der Räume tragen zur Wahrung der Zusammenhänge bei, ohne die nicht minder wichtige Komponente der Geborgenheit preiszugeben.
Geborgenheit und helle, aufgeräumte Übersichtlichkeit geben die Grundstimmung des Gebäudes wieder, in dem Volksschulkinder jene Stunden verbringen, in denen weder Schule noch Elternhaus für sie zuständig ist. Mit entsprechend großer Sorgfalt sind Grabner/Konrad auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Erzieherinnen eingegangen. Den Großteil der zur Ordnung eines Alltags zwischen Spielen, Lernen und Üben, zwischen Ruhe und Aktivität notwendigen Stauräume haben sie in Wandeinbauten integriert. Darin finden aber auch mit farbigem Filz ausgekleidete Rückzugsnischen Platz und Laden, die erst beim Herausziehen ihren Inhalt mit zarter Farbigkeit unterstreichen.
Weiß gemalte Decken und Wände und helles Holz - die tragende Mittelwand aus Brettsperrholz ist unverkleidet geblieben - bilden einen freundlich wirkenden, unaufdringlichen Hintergrund. Nur die WC-Anlagen sind in kräftigere Farben - Blau für die Buben, Grün für die Mädchen - getaucht. Kreisrunde, ebenflächig in die Akustikdecken integrierte Leuchten korrespondieren mit runden Lichtkuppeln und Glasausschnitten in der Decke zwischen Erd- und Obergeschoß. Netze dienen als Absturzsicherung im Bereich der Stiege und der Loggien. An dünnen Stahlseilen, durch Ausnehmungen im Boden der Loggien gefädelt, haben sich einige Schlingpflanzen schon vom Garten bis in den ersten Stock hinaufgearbeitet.
Es ist leicht möglich, dass es noch Jahre dauert, bevor sich die Wünsche unserer Gesellschaft in der Organisation des Schulwesens abbilden. Welche Räume dem Gedeihen unseres Nachwuchses förderlich sind, ist jedoch hinlänglich bekannt. Die von Architektinnen und Architekten für aufgeschlossene Auftraggeber erarbeiteten Beispiele räumlicher Qualität flächendeckend und organisationsübergreifend als Standard durchzusetzen könnte die schon lange schwelenden Konflikte zur Zukunft des Bildungswesens deutlich entspannen. Und den Betroffenen - Kindern, Lehrenden und Erziehenden - wäre damit sehr geholfen.
Entstehen Traditionen aus Nachahmung? Die Weiterentwicklung ursprünglicher Bauaufgaben bringt eine neue Bodenständigkeit hervor. Gefunden auf einem Bauernhof im Hausruckviertel.
Kaum einer Bevölkerungsgruppe wird so viel Beharrungsvermögen zugeschrieben wie dem Bauernstand. Kaum ein Gebäudetypus ruft so verlässlich Bilder von dicken Mauern, mächtigen Dächern und massiven Holzquerschnitten in unserer Vorstellung wach wie der Bauernhof. Das in Wels ansässige Architekturbüro Luger & Maul beschäftigt sich seit Beginn seiner Tätigkeit vor bald 25 Jahren immer wieder mit der Weiterentwicklung traditionsgebundener Bauaufgaben. Das Anwesen, das sie für eine Landwirtsfamilie im oberösterreichischen Hausruckviertel geplant haben, zeigt, wie weit diese Entwicklung bereits gediehen ist.
Luger & Maul haben das Gehöft im Grünland, jedoch am Rand des Siedlungsgebietes der Gemeinde Finklham in das hügelige Gelände gefügt. Eine Zufahrt zweigt von der Straße ab und führt ein kurzes Stück den nach Westen abfallenden Hang hinauf zu einem weiten ebenen Platz, den eine Sichtbetonwand mit großen Radien aus dem Gelände schneidet. Aus etwa der Mitte dieses Platzes erhebt sich, mit der östlichen Stirnwand an den Hang gerückt, das eine Kernstück des Hofes: die Maschinen- und Manipulationshalle. Ihr über eine Grundfläche von gut 300 Quadratmetern und eine Höhe von mehr als zwei Geschoßen aufgespanntes Volumen wird an den Schmalseiten von zwei Sichtbetonscheiben begrenzt. Die Längswände aus Holz ruhen auf einem betonierten Sockel und werden von je zwei einander gegenüberliegenden Holztoren durchbrochen. Ein Vordach ist auf beiden Seiten knappoberhalb der Toröffnungen über die gesamte Länge der Fassade gespannt. Es ist wie das Dach der Halle aus Holz konstruiert. Die Halle ist zum Teil unterkellert.
Neben ihr liegt, durch einen niedrigen Garagentrakt verbunden, das vergleichsweise fragil anmutende Wohnhaus. Es erhebt sich zweigeschoßig im rechten Winkel zur Halle über einem lang gezogen rechteckigen Grundriss und gewinnt durch seine Lage an der Böschungskante zur Straße hin einiges an Imposanz. Auch im Wohntrakt haben Luger & Maul zwei Bauweisen kombiniert: Seine der Halle im Norden zugewandte Längswand ist als massive, nur von zwei Öffnungen durchbrochene Mauerscheibe ausgebildet, die als schmales U den Rücken des Hauses umfängt. Davor, im Süden, erhebt sich ein konstruktiver Holzbau. Der Eingang in das Haus befindet sich im eingeschoßigen Verbindungstrakt, der die Eingangszonen mit tiefen Vordächern beschirmt. So betritt man wahlweise das Büro des Betriebes oder den Wohnbereich der Familie. Das südliche Dach deckt einen Sitzplatz im Freien, der den Essplatz nächst der Küche erweitert.
Das umfassende Einbeziehen des Außenraumes in die Architektur ist ein Schlüsselthema der Anlage. Der Geste, mit der die Stützwand dem Hang auf der einen Seite ebene Fläche abgewinnt, antwortet auf der anderen Seite die rhythmische Abfolge raumhoher, von auskragenden Dächern beschatteter Glaselemente, die den Wohnräumen das ringsum sich ausbreitende Hügelland zu Füßen legen. Der Grundriss des Wohnhauses ist auf beiden Ebenen in einer nach Süden orientierten Zimmerflucht organisiert, die von der massiv ummantelten Zone im Norden erschlossen wird. Eine einläufige, parallel zur Längskante verlaufende Stiege verbindet die beiden Geschoße. Im Erdgeschoß haben Wohn- und Wirtschaftsräume Platz gefunden, wobei das Wohnzimmer an der Südwestecke des Hauses mit der davor ausgeweiteten Terrasse eine prominente Stellung einnimmt. Ihm entspricht im Obergeschoß ein großes Schlafzimmer mit eigenem Bad und Schrankraum. Doch auch die anderen Schlafzimmer bieten mit ihren Ausgängen auf den gedeckten Balkon höchste räumliche Qualität.
Das kulturelle Niveau der Anlage erschöpft sich allerdings nicht im Bereitstellen einer schönen Aussicht. Die kluge, in ihrer Intention vor allem alltagstaugliche Führung der Wege durch die Anlage etwa beruht auf einer sorgfältigen Planung der Lichtverhältnisse und Ausblicke. Der große Glasausschnitt, mit dem sich die Maschinenhalle auf der Höhe ihrer Vordächer zum Landschaftsraum öffnet, zeigt ein ähnliches Motiv wie der Blick durch die gesamte Länge des Wohnhauses, den eine Folge gläserner, orthogonal an die Fensterwand schließender Türen frei gibt. Das zart detaillierte Aufeinandertreffen von massiver Wand und Holzkonstruktion bezeugt wie die sorgfältig gestalteten Übergänge zwischen den Materialien der Innenräume das große handwerkliche Verständnis und den hohen Durcharbeitungsgrad der Planung. Es sind also die Verbindung vorausschauend durchdachterFunktionsabläufe, ihre Übersetzung in geeignete Technologien und nicht zuletzt das unbedingte Bekenntnis zu Ordnung und Form, die den Hof als Vorbild qualitätsvollen zeitgenössischen Bauens für die Landwirtschaft zeigen.
In diesem Zusammenspiel des Vernünftigen und Schönen liegen die gemeinsamen Wurzeln des neuen und des traditionellen Bauens. Wirtschaftlich erfolgreiche Landwirte heute haben Mitarbeiter, kein Gesinde. Ihre Geräte werden von Verbrennungsmotoren bewegt, nicht von Pferden. Der Misthaufen in der Mitte des Hofes hat sich erübrigt. Gültig geblieben sind Fragen nach dem Verantwortungsbewusstsein der Bauernschaft; nach einem Bekenntnis zu Qualität und Nachhaltigkeit auf vielerlei Ebenen, auch auf jener der Baukultur. Luger & Maul haben mit Rücksicht auf den Siedlungs- und Landschaftsraum, mit feinem Gespür für die Ausdruckskraft der Materialien und aus einem reichen Erfahrungsschatz zu Wechselwirkung von Funktionalität und ästhetischem Anspruch schöpfend gehandelt. Ihre Auftraggeber wiederum haben zum Gelingen des Vorhabens mehr als dessen bloße Finanzierung beigetragen. Entstehen Traditionen aus Nachahmung? Zuweilen hat diese Vorstellung etwas Ermutigendes an sich.
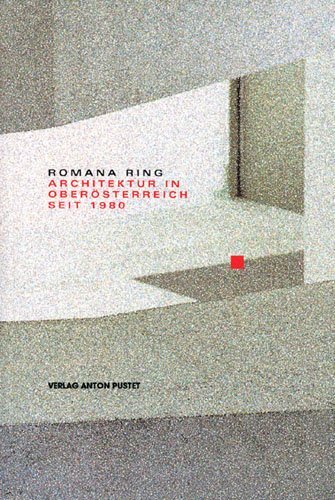
2004
Oberösterreich gilt als Land des Heimatstils – es hat aber auch bemerkenswerte neue Architektur zu bieten Das Land Oberösterreich gilt als dynamischer Wirtschaftsstandort. In seinen kulturellen Ambitionen scheint es jedoch eher der Vergangenheit zugewandt. Dieses Bild vermag der Band „Architektur in
Autor: Romana Ring
Verlag: Verlag Anton Pustet