Artikel
Am Ursprung des «neuen Moskau» steht der Gorki-Park
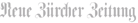
Moskaus bekannteste Grünfläche, der einstige Zentrale Park für Kultur und Erholung aus der Frühzeit der Sowjetunion, ist 90 Jahre alt. Auch die jüngste Politik der Verschönerung der russischen Hauptstadt ging vom Gorki-Park aus.
8. September 2018 - Markus Ackeret
Das Geburtstagsgeschenk passt in die neue Zeit. Pünktlich zu einer Woche voller Festivitäten, mit denen der Gorki-Park sein 90-jähriges Bestehen feierte, wurde Russlands angeblich grösster und modernster Kinderspielplatz auf dem Gelände eröffnet. An Gerät und Auslauf fürs Klettern, Schaukeln, Rutschen und Herumtoben hatte es auch zuvor nicht gemangelt. Aber es musste noch etwas Grösseres und Auffälligeres her – direkt neben dem Museum für zeitgenössische Kunst «Garage», einem gläsernen Bau des Niederländers Rem Koolhaas. Nicht weit davon stehen die grün gestrichenen Kuben, die Grüne Schule, ein Ort für kindliche Kreativität drinnen und draussen. Der Gorki-Park ist vermutlich so lebendig wie nie mehr seit den dreissiger Jahren. Aber die Botschaft hat sich, natürlich, geändert.
Spiegel der dreissiger Jahre
90 Jahre sind für Institutionen und Orte nicht unbedingt ein Anlass für grosse Feiern. Ohnehin ist in diesem Fall die Zahl 90 etwas zu hoch gegriffen. Der Moskauer Zentrale Park für Kultur und Erholung öffnete zwar tatsächlich 1928 seine Pforten, am Ufer der Moskwa, dort, wo die Krim-Brücke zwei Seiten des durch die Hauptstadt mäandrierenden Flusses verbindet. Nach dem Schriftsteller Maxim Gorki wurde er 1932 benannt. Seine eigentliche Bestimmung als ideologisch aufgeladener Ort und Teil der stalinistischen kulturell-politischen Erziehung zum «neuen Menschen» bekam er aber erst mit dem Moskauer Generalplan von 1935, dem stalinistischen Stadt- und Gesellschaftsumbau der dreissiger Jahre. Und im Mai 1937, dem Jahr des Grossen Terrors, wurde er zu dem, was jetzt am 90. Geburtstag gefeiert wird, und erlebte eine Art zweites Eröffnungsdatum.
Damals wie heute ging, zumindest symbolisch, vom Gorki-Park die Neuordnung der Stadt aus. 1928 war der «Park Kultury» – so heisst bis heute auch die 1935 eröffnete Metrostation – nicht nur Vorreiter für vergleichbare, wenn auch kleinere und unspektakuläre Orte in der ganzen Sowjetunion. Mit ihm begann der Stadtumbau Moskaus unter Stalin. 2011 war der Gorki-Park das erste Projekt einer Reihe von bis jetzt nicht abgeschlossenen Massnahmen zur Verschönerung und Renovierung Moskaus durch Bürgermeister Sergei Sobjanin, der im Herbst des Vorjahres ins Amt gekommen war. Auch dass nun die 90 Jahre gross gefeiert werden, ist so kurz vor Sobjanins kaum bestrittener Wiederwahl wohl kein Zufall.
Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts war Moskau eine Stadt im rasanten Wandel. Ohne gewaltige Anstrengungen und Anpassungen war dieser nicht zu bewältigen. 1926 waren zwei Drittel der Bevölkerung Zugezogene, die im Gefolge der Wirren der Revolution, der politischen Umwälzungen und des Bürgerkriegs in die Hauptstadt gekommen waren. Allein in der Dekade von 1929 bis 1939 verdoppelte sich die Einwohnerzahl auf vier Millionen. Die Stadt aber bestand vor dem ersten Fünfjahreplan 1928 noch immer zu 60 Prozent aus Holzhäusern. Der Kultur- und Erholungspark sollte einen «grünen» Ausgleich zum städtischen Moloch mit seinen «Schanghai» genannten Barackensiedlungen der Zugezogenen am Stadtrand bilden und zugleich ein Schmelztiegel werden, wo diese noch ungehobelten, zumeist bäuerlichen Frauen und Männer zu «zivilisierten» Sowjetbürgern erzogen werden sollten.
In der Debatte um den ideologisch richtigen sozialistischen Städtebau spielte der spätere Gorki-Park eine entscheidende Rolle als Beispiel für die Verbesserung der Lebensqualität. Die Flusspromenade am Fuss der Sperlingsberge, der bereits existierende Neskutschny Sad (Nicht langweiliger Garten) und die später gebauten Sportanlagen in Luschniki sollten zu einer Einheit werden. Die «grüne Stadt», von der manche Stadtplaner träumten, wurde nie realisiert, aber der Zentrale Park für Kultur und Erholung wurde in diesem Kontext weiterentwickelt – 1928 war er noch vor allem Aufmarschplatz für mannigfache politische Kundgebungen.
Das «glückliche Leben»
Mit dem Generalplan von 1935 wurde er zum «Kombinat des glücklichen Lebens». Die Betonung lag, von den Parteiideologen gewünscht, stärker auf der – propagandistisch und erzieherisch verstandenen – Kultur als auf der Erholung. Grosses Vorbild bei der Ausstattung waren, wie überhaupt für den zivilisatorischen Sprung der dreissiger Jahre im Stalinismus, die Errungenschaften Amerikas. Es gab Sportanlagen, inklusive Fallschirmspringer-Turm, aber auch offene Bühnen für Konzerte und Theater. Entscheidend war, wie der Historiker Karl Schlögel in seinem monumentalen Werk über «Das sowjetische Jahrhundert» schreibt, die Bewegung des Massenbesuchers: Auch die Erholung sollte zu einem kollektiven Erlebnis werden. Auf dem Höhepunkt von Angst, Misstrauen und Schrecken im Terrorjahr 1937 gab es im Park ein kurzzeitiges Entrinnen, eine trügerische Idylle und Freiheit im karnevalesken Kleid. Überall war politische Agitation, der Park bot eine Bühne für Manifestationen und ideologische Unterrichtung. Noch zum 50. Geburtstag des Gorki-Parks 1978 verwies ein kurzer Film auf die «universelle Bedeutung der aufklärerischen Einrichtung» dieser Anlage und darauf, dass Ideologie, Propaganda und Parklandschaft ineinander übergingen. Das beeindruckte auch die in den dreissiger Jahren in die Sowjetunion gereisten ausländischen Besucher.
Die Gesellschaft, für die der Park eingerichtet worden sei, habe sich in den späten fünfziger Jahren aufzulösen begonnen, schreibt Schlögel: Mit dem Ende des Stalinismus und mit Chruschtschows Bauprogramm zur Schaffung individuellen Wohnraums verlagerte sich die Idylle ins Private. Der Gorki-Park war ab dann nicht mehr der Austragungsort grosser Festivitäten, wenngleich etwa das charakteristische Eingangsportal erst 1955 fertig war. Er diente gleichwohl auch neuen Generationen zur Darstellung sowjetischer Errungenschaften – etwa des nie erfolgreichen Raumschiffs «Buran». Auch im Westen wurde er durch den gleichnamigen Roman, dessen Verfilmung und durch das Lied «Wind of Change» wieder ein Begriff. Aber der Höhe- und Glanzpunkt war überschritten, und seit den neunziger Jahren dämmerte die Anlage zusehends vor sich hin, ja vergammelte und wurde zum Schauplatz billiger Spektakel. Sie dokumentierte gleichsam die für immer vergangene Pracht der Sowjetunion.
Mit dem ganzen ideologischen Ballast eignete sich der Gorki-Park ideal für Sobjanins neues Programm der Verschönerung und Erneuerung Moskaus. Die Wiedergeburt knüpfte natürlich an diese Geschichte an, für die im Eingangsbereich ein neues Museum eingerichtet wurde. Aber die Renaissance des Parks spiegelt in erster Linie die gegenwärtige Gesellschaft, die das Schöne an der sowjetischen Vergangenheit wiederaufleben lässt und mit einer modernen Ästhetik und Designsprache verbindet. Viele Bauten und Anlagen wurden renoviert, während die billige Rummelplatz-Atmosphäre völlig verschwand. Stattdessen dominiert das Sportliche, Elegante, Herausgeputzte; schöne Spielplätze für Kinder, grosse Beachvolleyball-Felder, eine Anlage zum Boule-Spielen, Veloverleihe und eine Vielzahl an Cafés.
Entpolitisierung des Raums
Vorbildlich sind auch heute amerikanische und europäische Architekten. Der vor genau einem Jahr eröffnete Park Sarjadje auf dem Gelände des abgerissenen sowjetischen Hotels Rossija am Ufer der Moskwa beim Kreml ist ein von amerikanischen Gestaltern entworfener Landschafts- und Kulturpark. Genauso wie die Erfinder des Generalplans von 1935 Moskau zu einer lebenswerteren Stadt umgestalten wollten und ein bis heute prägendes, gigantisches Bauprogramm in Gang setzten, will auch Sobjanin Moskau vom Ruch des Molochs befreien.
Er liess ungeordnete Budenstädte an Metrostationen brachial abreissen, befreite Trottoirs von wild parkierten Autos und richtete im Stadtzentrum zahlreiche Fussgängerzonen ein. Strassen und Gehwege wurden neu gepflastert und Verkehrsströme durch den Bau von Brücken und Umfahrungsstrassen am Stadtrand entflochten. Das U-Bahn-Netz wächst so schnell wie nie zuvor. Auch architektonisch hat er Grosses vor: Die fünfstöckigen Plattenbauten der ersten Generation, jene, die unter Chruschtschow die private Idylle eröffneten, müssen neueren Bauten weichen.
Der moderne Gorki-Park ist gerade nicht mehr der Ort politischer Manifestationen, sondern das Gegenteil: Er erzieht zur Entpolitisierung. In einer der Ausstellungen im Park zum Jubiläum geben Mitarbeiter der Parkverwaltung ihre Gedanken dazu wieder. Der Park, sagt die junge Designerin Tatjana Schiljajewa, sei als Bildungsinstrument zur Kultivierung der Menschen in der Sowjetunion eingerichtet worden; er habe ihnen die neue Kultur «aufgedrängt». Heute mache er genau das Gleiche – und das sei toll.
Spiegel der dreissiger Jahre
90 Jahre sind für Institutionen und Orte nicht unbedingt ein Anlass für grosse Feiern. Ohnehin ist in diesem Fall die Zahl 90 etwas zu hoch gegriffen. Der Moskauer Zentrale Park für Kultur und Erholung öffnete zwar tatsächlich 1928 seine Pforten, am Ufer der Moskwa, dort, wo die Krim-Brücke zwei Seiten des durch die Hauptstadt mäandrierenden Flusses verbindet. Nach dem Schriftsteller Maxim Gorki wurde er 1932 benannt. Seine eigentliche Bestimmung als ideologisch aufgeladener Ort und Teil der stalinistischen kulturell-politischen Erziehung zum «neuen Menschen» bekam er aber erst mit dem Moskauer Generalplan von 1935, dem stalinistischen Stadt- und Gesellschaftsumbau der dreissiger Jahre. Und im Mai 1937, dem Jahr des Grossen Terrors, wurde er zu dem, was jetzt am 90. Geburtstag gefeiert wird, und erlebte eine Art zweites Eröffnungsdatum.
Damals wie heute ging, zumindest symbolisch, vom Gorki-Park die Neuordnung der Stadt aus. 1928 war der «Park Kultury» – so heisst bis heute auch die 1935 eröffnete Metrostation – nicht nur Vorreiter für vergleichbare, wenn auch kleinere und unspektakuläre Orte in der ganzen Sowjetunion. Mit ihm begann der Stadtumbau Moskaus unter Stalin. 2011 war der Gorki-Park das erste Projekt einer Reihe von bis jetzt nicht abgeschlossenen Massnahmen zur Verschönerung und Renovierung Moskaus durch Bürgermeister Sergei Sobjanin, der im Herbst des Vorjahres ins Amt gekommen war. Auch dass nun die 90 Jahre gross gefeiert werden, ist so kurz vor Sobjanins kaum bestrittener Wiederwahl wohl kein Zufall.
Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts war Moskau eine Stadt im rasanten Wandel. Ohne gewaltige Anstrengungen und Anpassungen war dieser nicht zu bewältigen. 1926 waren zwei Drittel der Bevölkerung Zugezogene, die im Gefolge der Wirren der Revolution, der politischen Umwälzungen und des Bürgerkriegs in die Hauptstadt gekommen waren. Allein in der Dekade von 1929 bis 1939 verdoppelte sich die Einwohnerzahl auf vier Millionen. Die Stadt aber bestand vor dem ersten Fünfjahreplan 1928 noch immer zu 60 Prozent aus Holzhäusern. Der Kultur- und Erholungspark sollte einen «grünen» Ausgleich zum städtischen Moloch mit seinen «Schanghai» genannten Barackensiedlungen der Zugezogenen am Stadtrand bilden und zugleich ein Schmelztiegel werden, wo diese noch ungehobelten, zumeist bäuerlichen Frauen und Männer zu «zivilisierten» Sowjetbürgern erzogen werden sollten.
In der Debatte um den ideologisch richtigen sozialistischen Städtebau spielte der spätere Gorki-Park eine entscheidende Rolle als Beispiel für die Verbesserung der Lebensqualität. Die Flusspromenade am Fuss der Sperlingsberge, der bereits existierende Neskutschny Sad (Nicht langweiliger Garten) und die später gebauten Sportanlagen in Luschniki sollten zu einer Einheit werden. Die «grüne Stadt», von der manche Stadtplaner träumten, wurde nie realisiert, aber der Zentrale Park für Kultur und Erholung wurde in diesem Kontext weiterentwickelt – 1928 war er noch vor allem Aufmarschplatz für mannigfache politische Kundgebungen.
Das «glückliche Leben»
Mit dem Generalplan von 1935 wurde er zum «Kombinat des glücklichen Lebens». Die Betonung lag, von den Parteiideologen gewünscht, stärker auf der – propagandistisch und erzieherisch verstandenen – Kultur als auf der Erholung. Grosses Vorbild bei der Ausstattung waren, wie überhaupt für den zivilisatorischen Sprung der dreissiger Jahre im Stalinismus, die Errungenschaften Amerikas. Es gab Sportanlagen, inklusive Fallschirmspringer-Turm, aber auch offene Bühnen für Konzerte und Theater. Entscheidend war, wie der Historiker Karl Schlögel in seinem monumentalen Werk über «Das sowjetische Jahrhundert» schreibt, die Bewegung des Massenbesuchers: Auch die Erholung sollte zu einem kollektiven Erlebnis werden. Auf dem Höhepunkt von Angst, Misstrauen und Schrecken im Terrorjahr 1937 gab es im Park ein kurzzeitiges Entrinnen, eine trügerische Idylle und Freiheit im karnevalesken Kleid. Überall war politische Agitation, der Park bot eine Bühne für Manifestationen und ideologische Unterrichtung. Noch zum 50. Geburtstag des Gorki-Parks 1978 verwies ein kurzer Film auf die «universelle Bedeutung der aufklärerischen Einrichtung» dieser Anlage und darauf, dass Ideologie, Propaganda und Parklandschaft ineinander übergingen. Das beeindruckte auch die in den dreissiger Jahren in die Sowjetunion gereisten ausländischen Besucher.
Die Gesellschaft, für die der Park eingerichtet worden sei, habe sich in den späten fünfziger Jahren aufzulösen begonnen, schreibt Schlögel: Mit dem Ende des Stalinismus und mit Chruschtschows Bauprogramm zur Schaffung individuellen Wohnraums verlagerte sich die Idylle ins Private. Der Gorki-Park war ab dann nicht mehr der Austragungsort grosser Festivitäten, wenngleich etwa das charakteristische Eingangsportal erst 1955 fertig war. Er diente gleichwohl auch neuen Generationen zur Darstellung sowjetischer Errungenschaften – etwa des nie erfolgreichen Raumschiffs «Buran». Auch im Westen wurde er durch den gleichnamigen Roman, dessen Verfilmung und durch das Lied «Wind of Change» wieder ein Begriff. Aber der Höhe- und Glanzpunkt war überschritten, und seit den neunziger Jahren dämmerte die Anlage zusehends vor sich hin, ja vergammelte und wurde zum Schauplatz billiger Spektakel. Sie dokumentierte gleichsam die für immer vergangene Pracht der Sowjetunion.
Mit dem ganzen ideologischen Ballast eignete sich der Gorki-Park ideal für Sobjanins neues Programm der Verschönerung und Erneuerung Moskaus. Die Wiedergeburt knüpfte natürlich an diese Geschichte an, für die im Eingangsbereich ein neues Museum eingerichtet wurde. Aber die Renaissance des Parks spiegelt in erster Linie die gegenwärtige Gesellschaft, die das Schöne an der sowjetischen Vergangenheit wiederaufleben lässt und mit einer modernen Ästhetik und Designsprache verbindet. Viele Bauten und Anlagen wurden renoviert, während die billige Rummelplatz-Atmosphäre völlig verschwand. Stattdessen dominiert das Sportliche, Elegante, Herausgeputzte; schöne Spielplätze für Kinder, grosse Beachvolleyball-Felder, eine Anlage zum Boule-Spielen, Veloverleihe und eine Vielzahl an Cafés.
Entpolitisierung des Raums
Vorbildlich sind auch heute amerikanische und europäische Architekten. Der vor genau einem Jahr eröffnete Park Sarjadje auf dem Gelände des abgerissenen sowjetischen Hotels Rossija am Ufer der Moskwa beim Kreml ist ein von amerikanischen Gestaltern entworfener Landschafts- und Kulturpark. Genauso wie die Erfinder des Generalplans von 1935 Moskau zu einer lebenswerteren Stadt umgestalten wollten und ein bis heute prägendes, gigantisches Bauprogramm in Gang setzten, will auch Sobjanin Moskau vom Ruch des Molochs befreien.
Er liess ungeordnete Budenstädte an Metrostationen brachial abreissen, befreite Trottoirs von wild parkierten Autos und richtete im Stadtzentrum zahlreiche Fussgängerzonen ein. Strassen und Gehwege wurden neu gepflastert und Verkehrsströme durch den Bau von Brücken und Umfahrungsstrassen am Stadtrand entflochten. Das U-Bahn-Netz wächst so schnell wie nie zuvor. Auch architektonisch hat er Grosses vor: Die fünfstöckigen Plattenbauten der ersten Generation, jene, die unter Chruschtschow die private Idylle eröffneten, müssen neueren Bauten weichen.
Der moderne Gorki-Park ist gerade nicht mehr der Ort politischer Manifestationen, sondern das Gegenteil: Er erzieht zur Entpolitisierung. In einer der Ausstellungen im Park zum Jubiläum geben Mitarbeiter der Parkverwaltung ihre Gedanken dazu wieder. Der Park, sagt die junge Designerin Tatjana Schiljajewa, sei als Bildungsinstrument zur Kultivierung der Menschen in der Sowjetunion eingerichtet worden; er habe ihnen die neue Kultur «aufgedrängt». Heute mache er genau das Gleiche – und das sei toll.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






