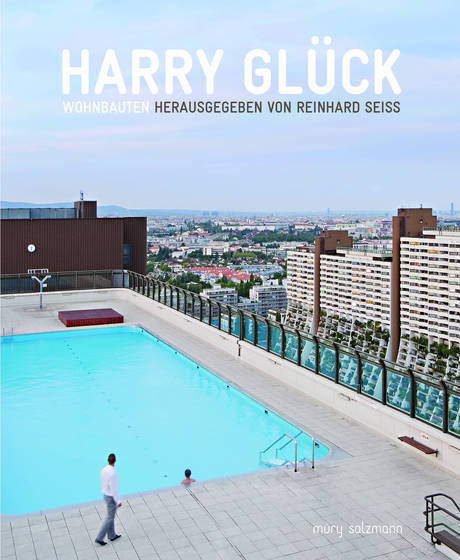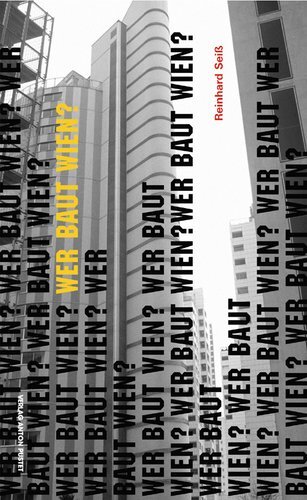Warum ist Österreich so schiach?
Glaubt man unserer Bundeshymne, sind wir ein „Volk, begnadet für das Schöne“. Baukulturell betrachtet kann dies nur mit Blick auf die Vergangenheit unwidersprochen bleiben, schreibt der Wiener Raumplaner und Filmemacher Reinhard Seiß.
Österreich hat seine Zukunft in vielen Bereichen den Bundesländern überantwortet. Zentrale Nachhaltigkeitsthemen wie Raumordnung, Bauordnung, Naturschutz oder auch der geförderte Wohnbau fallen in die Zuständigkeit der Länder, ebenso wie die Errichtung von Straßen – abgesehen von Autobahnen und Schnellstraßen. Aber auch die entstehen seltener aufgrund bundespolitischer Überlegungen als auf Zuruf der neun Landesregierungen. In fünf davon sitzen die Freiheitlichen bereits als Partner der Volkspartei, mit der gemeinsam sie ihre Klientel nachhaltigkeitspolitisch nicht gerade verschrecken. Wie das konkret aussieht, bekam die Öffentlichkeit vor zwei Jahren vor Augen geführt: Da stieß das damals noch grüne Umweltministerium mit seiner Initiative zur Eindämmung der horrenden Bodenvergeudung auf einhelligen landesfürstlichen Widerstand, angeführt vom schwarz-blau regierten Oberösterreich – und biss auf Beton.
Der Sektor Bauen und Mobilität verursacht aber nicht nur die Versiegelung des Landes, sondern ist auch für zwei Drittel der CO₂-Emissionen verantwortlich. Daher fordern Fachleute seit Langem eine Abkehr von der bisherigen Architektur, Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung. Nicht so die FPÖ – allein schon, weil sie den Zusammenhang zwischen unserem CO₂-Ausstoß und dem Klimawandel, ja sogar den Klimawandel an sich, in Frage stellt. Während Experten etwa das freistehende Einfamilienhaus samt politisch verordneter Doppel- oder Dreifachgarage mit einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung für unvereinbar halten, plädiert die FPÖ unisono mit der ÖVP weiterhin für ein Recht der Menschen auf ihre liebste Wohnform – wachsende Speckgürtel hin, zunehmende Autoabhängigkeit her.
Gleichzeitig steht die FPÖ immer wieder auf der Bremse, wenn es um Alternativen zum für viele nicht mehr erschwinglichen Einfamilienhaus geht. In Innsbruck, wo Bauland und Wohnungen so knapp und so teuer wie kaum sonst in Österreich sind, beschloss die Stadt jüngst für 23 größere, seit Jahrzehnten spekulativ gehortete Baulandflächen eine Zweckbindung für sozialen Wohnbau. Die Einzigen im Gemeinderat, die – im Sinne der betroffenen Grundeigentümer – dagegen stimmten, waren die Freiheitlichen, die von „Enteignung“ sprachen.
Gewerbehallen und Supermärkte schauen nicht nur in der Alpenrepublik unsäglich banal aus
Glaubt man unserer Bundeshymne, so sind wir ein „Volk, begnadet für das Schöne“. Baukulturell betrachtet kann dies freilich nur mit Blick auf die Vergangenheit unwidersprochen bleiben. Denn was sich heute landauf landab an gebauter Scheußlichkeit und ignoranter Verunstaltung findet, deutet vielmehr auf eine kollektive ästhetische Abstumpfung hin. Gut, Gewerbehallen und Supermärkte schauen nicht nur in der Alpenrepublik unsäglich banal aus. Aber deren Bauherren geht es auch nicht um Dauerhaftes oder gar Repräsentatives, sondern um Kostenminimierung – auf Kosten des Stadt- und Siedlungsbilds.
Dagegen ist von den 1,5 Millionen Einfamilienhäusern in Österreich ein jedes geradezu ein Lebenswerk, in das oft ein Vermögen fließt. Und was verraten die Hunderttausenden Eigenheime aus den letzten drei, vier Jahrzehnten über ihre Erbauer? Dass vielen der Gedanke an so etwas wie Einheitlichkeit oder Einordnung in ein Siedlungsgefüge völlig abhandengekommen ist. Vielmehr geht es darum, sich von allen zu unterscheiden, etwas Einzigartiges in die Landschaft zu stellen, der eigenen Individualität baulichen Ausdruck zu verleihen – ja, sich selbst in Ziegel oder Beton zu verwirklichen. Aedifico, ergo sum! Die Gemeinden wiederum haben längst damit aufgehört, den Häuslbauern irgendetwas vorzuschreiben. Als ob es ein Recht auf schlechten Geschmack gäbe – und auf seine bauliche Manifestation.
So lässt das stilistische Potpourri innerhalb einer einzigen Wohnsiedlung unserer Tage die gesamte bisherige Architekturgeschichte armselig aussehen. Die Baumarkt-Kreationen aus Kunststoff oder Aluminium jedweder Form und Couleur für Haustüren und Garagentore, Fenster und Außenjalousien, Vordächer und Zäune kennen keine Grenzen – und lassen Neubauten zigtausendfach zur Peinlichkeit geraten. Bei Umbau und Sanierung bestehender Substanz rauben sie den Altbauten ihre Seele. Und nein, in anderen vergleichbaren europäischen Ländern gibt es einen derartigen Wildwuchs nicht! Man muss unsere „Baukultur“ als Spiegel der Gesellschaft sehen – und kann sie nicht (allein) der Politik anlasten. Was man der Politik – und hier vor allem den Rechtspopulisten – allerdings zuschreiben darf, ist, dass sie seit Jahrzehnten ein Klima schafft, in dem Egozentrik über die Gesellschaft gestellt wird, also der Vorteil des Einzelnen über das Gemeinwohl. „Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome“ heißt es zu Beginn der Bundeshymne – laut Umfragen sind die Österreicher, wenn es um ihr Land geht, auf nichts stolzer als auf die Natur- und Kulturlandschaft. Und doch gehen wir unglaublich sorglos mit dieser Landschaft um: sei es durch die unaufhörlich wachsenden Verkehrswege, sei es durch die ungebremst fortschreitende Zersiedlung – nicht zuletzt durch Handel und Gewerbe auf der grünen Wiese. Obwohl Österreich schon jetzt von allen EU-Staaten die meisten Autobahn- und Schnellstraßenkilometer sowie die größte Einzelhandelsfläche pro Kopf hat.
Paradoxerweise geriert sich ausgerechnet die FPÖ, die dem Raubbau an Umwelt und Klima am wenigsten entgegensetzt, als „Heimatschutzpartei“. So wettern die Freiheitlichen in gleich mehreren Bundesländern gegen die Wind- und Sonnenenergiegewinnung – weil sie „Heimat und Landschaft zerstört“. In Kärnten initiierten die Freiheitlichen im Jänner ein Volksbegehren gegen Windräder auf Bergen und Almen, nachdem Windkraftwerke schon davor bloß dort genehmigt wurden, wo sie in einem Umkreis von 25 Kilometern von maximal zwei Prozent der Wohnbevölkerung des Landes gesehen werden können. Der freiheitliche Landesparteiobmann befand einfach, „dass Windräder nicht zu Kärnten passen“ – und das Votum ging knapp in seinem Sinne aus, weshalb nun faktisch ein landesweites Windkraftverbot herrscht. In Oberösterreich ist die FPÖ aus Sorge um Wildtiere gegen die Errichtung von Windrädern – und im Burgenland zum Schutz wertvoller Landwirtschaftsflächen gegen den Bau von Solaranlagen.
Tatsächlich fehlt bei der rasanten Ausweitung von Wind- und Solarkraftwerken allzu oft jede ästhetische Sensibilität. Und die sorglose Verbauung von fruchtbarem Ackerland ist nichts weniger als ein Verbrechen an der Zukunft. Doch wäre die einzige ernsthafte Alternative zur Stromgewinnung aus Wind und Sonne, unseren verschwenderischen Energiekonsum drastisch zu senken. Das steht allerdings nicht auf der politischen Agenda der Rechtspopulisten. Diese fordern vielmehr den Rücktritt vom Ausstieg aus Erdöl, Erdgas und Kohle. Und ihr Engagement für den Heimatschutz endet dort, wo sie ihre Interessen gegenüber Landschaft und Natur durchsetzen wollen. So unterstützte die FPÖ in Oberösterreich im Vorjahr Probebohrungen nach möglichen Gasvorkommen in einer Nationalparkregion, während sie sich in Niederösterreich für „Bio“-Fracking zur Förderung der dortigen Ölvorkommen stark macht.
Politik aus dem Bauch heraus
Ebenso wenig Thema ist der Heimatschutz für die Freiheitlichen beim Bau neuer Verkehrsachsen – selbst in noch unversehrten Landschaften. So fordern sie in Niederösterreich gleich zwei neue Autobahnen respektive Schnellstraßen in extrem dünn besiedelten Regionen: eine quer durchs Waldviertel und die andere von St. Pölten ins Mariazeller Land. Kein ernst zu nehmender Verkehrsplaner oder Regionalökonom würde diesen Projekten irgendeinen Nutzen zubilligen, der auch nur ansatzweise in Relation zu den damit verbundenen Kosten und vor allem Schäden stünde. Wer aber Politik aus dem Bauch heraus macht, den kümmern rationale Argumente wenig. Zumal die FPÖ auch in Niederösterreich eine Koalition mit der ÖVP bildet, mit der gemeinsam sie medienwirksam ein „Bekenntnis zum Individualverkehr“ abgegeben hat, finden derlei Ideen im Landtag trotz allem ihre Mehrheit. Während anderswo Arbeitslose oder Alleinerzieherinnen den Schutzinstinkt der Politik wecken, sind es in Niederösterreich Pendler und Spediteure. Und für ihre Notlage gibt es nur eine „rechte“ Lösung: neue Straßen! Insbesondere nach fünf langen Jahren „willkürlicher Straßenbaublockade“ durch das grüne Verkehrsministerium.
Dass der Berufsverkehr insbesondere in den Ballungsräumen auf die Bahn verlagert werden müsste und die Politik in der Verantwortung stünde, die Möglichkeit dafür zu schaffen, lassen die Wortführer des Autobahnausbaus ebenso unter den Tisch fallen wie die Notwendigkeit, den Gütertransport von der Straße auf die Schiene zu bringen. Lieber poltern sie gegen den „ideologisch bedingten Spritpreiswahnsinn“ und eine „CO₂-Sinnlossteuer“, die Autofahrer weit über Gebühr zur Kasse bitten würden. Dass alle wissenschaftlichen Berechnungen den Pkw- und Lkw-Verkehr als chronischen Subventionsfall entlarven, greifen nicht einmal die Medien gern auf.
Nicht nur Fachleute, sondern so gut wie alle vernunftbegabten Bürger schütteln den Kopf darüber, dass die FPÖ in regelmäßigen Abständen eine Erhöhung des Tempolimits auf Autobahnen fordert. Österreich liegt hier im europäischen Spitzenfeld, doch das ist den Freiheitlichen nicht genug. Während beider bisherigen schwarz-blauen Koalitionen führten die freiheitlichen Verkehrsminister auf ausgewählten Strecken höhere Limits ein, die von den nachfolgenden Regierungen angesichts fehlenden Nutzens aber altbekannter Nachteile wieder gesenkt wurden. Im Vergleich zu Tempo 130 steigen bei 150 km/h die CO₂-Emissionen um 19 Prozent, die Feinstaubbelastung um 31 Prozent und der Stickoxid-Ausstoß um 44 Prozent. Und ähnlich drastisch nehmen der Verkehrslärm und das Unfallrisiko zu.
Ungeachtet dessen brachte Herbert Kickl in den Koalitionsverhandlungen Anfang des Jahres erneut Tempo 150 aufs Tapet, unterstützt von freiheitlichen Landespolitikern. Niederösterreichs Parteichef Udo Landbauer meinte: „Ich stelle mich damit klar gegen die grüne Klimareligion, deren Evangelium Tempo 100 ist.“ Und Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner behauptete, Tempo 150 könne sogar „weitere Inflation verhindern“. Denn „Zeit ist Geld, heißt es im Volksmund. Vice versa bedeutet mehr Transportzeit auch höhere Kosten“. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Christoph Badelt kommentierte die Gedankengänge des Verkehrspolitikers vornehm zurückhaltend als „wirklich weit hergeholte Schlussfolgerung“. Intellektuelle Bloßstellung hält einen selbstbewussten FPÖ-Politiker aber nicht davon ab, der Öffentlichkeit beinah in Trump’scher Vereinfachungsmanier auch noch andere Zusammenhänge zu erklären: „Am täglichen Gütertransport hängt die ganze Wirtschaft. Bricht dieser zusammen, dann droht ein massiver Wohlstandsverlust mit einem existenzgefährdenden Versorgungsnotstand“, so Steinkellner.
Wie der Wunschzettel von Straßenbaulobby und Autofahrerclubs
Niemand sieht den Straßengütertransport vor dem Zusammenbruch. Die Freiheitlichen aber sind Meister darin, realitätsferne Horrorszenarien aufzubauen, um daraus mitunter irrwitzige Maßnahmen abzuleiten: So fordert der Landesrat in Sorge um den Lkw-Verkehr „Versorgungssicherheit durch die Abschaffung der CO₂-Abgabe, eine Preisdeckelung für Treibstoff sowie ein Aussetzen oder Senken der Mineralölsteuer“. Um solches auch umzusetzen, braucht es die FPÖ freilich gar nicht einmal mehr: Was ÖVP, SPÖ und Neos jüngst an verkehrspolitischen „Reformen“ präsentierten, liest sich wie der Wunschzettel von Straßenbaulobby und Autofahrerclubs: Abschaffung der Normverbrauchsabgabe für Klein-Lkw und Pick-ups mit Verbrennungsmotoren, Verdreifachung des Pendlereuros, Verteuerung des Klimatickets, Budgetkürzungen beim Schienenausbau, Infragestellung weiterer Regionalbahnen.
In der Steiermark haben die Wähler im Vorjahr die FPÖ zur stimmenstärksten Partei gemacht und sich damit ganz bewusst für eine Abkehr von einer nachhaltigen Entwicklung entschieden. Mit Sagern wie „Autofahren ist keine Schande“ gibt sich auch Neo-Landeshauptmann Mario Kunasek als Schutzpatron der Autofahrer – und tut alles, um sie vor „Klimaalarmismus und Autofahrerschikane“ zu bewahren. So lehnt sein Regierungsteam „Maßnahmen zur Ausgrenzung von Autofahrern“ ab, will im urbanen Raum nicht etwa dem Fahrrad oder der Straßenbahn, sondern „der Verfügbarkeit von Parkplätzen Priorität einräumen“ und pocht auf die „Gleichberechtigung der Pkw-Lenker mit anderen Verkehrsteilnehmern“.
Damit betreibt er in klassisch rechtspopulistischer Manier eine „Täter-Opfer-Umkehr“: Selbst in der linksregierten Landeshauptstadt, die zu den Vorreitern der Verkehrswende in Österreich zählt, okkupieren fahrende und parkende Kraftfahrzeuge nach wie vor einen überproportionalen Anteil am Straßenraum. Wenn Fußgänger und Radfahrer in Graz nun wieder mehr Platz bekommen, nehmen sie den Autos nichts weg, sondern erhalten einen kleinen Teil dessen zurück, was ihnen über Jahrzehnte streitig gemacht wurde. Anders sieht das die FPÖ: „Die Steiermark ist Autoland, und das soll sie auch bleiben!“
Abschaffung des Lufthunderters
Und die „Heimatschutzpartei“ belässt es nicht bei Worten: 20 Jahre lang galt auf den Autobahnen rund um Graz ein immissionsabhängiges Tempolimit von 100 km/h – als wirksame Maßnahme, um die aufgrund ihrer Kesselllage Feinstaub-geplagte 300.000-Einwohner-Stadt zu entlasten. Kurz nach seinem Amtsantritt kippte Landeshauptmann Kunasek diese Regelung unter dem Beifall freiheitlicher Verkehrslandesräte anderer Bundesländer, die Ähnliches planen oder bereits umsetzten. „Diese Entscheidung ist ein Ausdruck von Vernunft und Realitätssinn“, war Oberösterreichs Günther Steinkellner begeistert. „Die Abschaffung des Lufthunderters in der Steiermark zeigt, wie eine moderne Politik für die Menschen im eigenen Land aussehen kann, wenn Fakten statt Ideologie die Richtung vorgeben.“
Dass der Vorwurf der ideologie- statt faktenbasierten Politik ausgerechnet aus dem rechten Lager kommt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Umso vehementer erhebt die FPÖ ihn bei ihrem Reizthema Nummer eins – der Klimapolitik. Mit Begriffen wie „Klimaterror“ oder „Klimakommunismus“ entzieht sie sich jeglicher sachlichen Diskussion, die sie in Wahrheit gar nicht führen will – und prägt damit umso mehr den Nachhaltigkeitsdiskurs. Bei vielen Zielen sind die Freiheitlichen derweil an ihrer Erfüllung gescheitert, was sich angesichts wachsender Stimmenanteile aber bald ändern kann. Ihr größter „Erfolg“ bisher ist vermutlich jener, das Niveau der öffentlichen Debatte über Jahrzehnte dermaßen abgesenkt zu haben, dass politisch inzwischen so gut wie alles möglich ist.