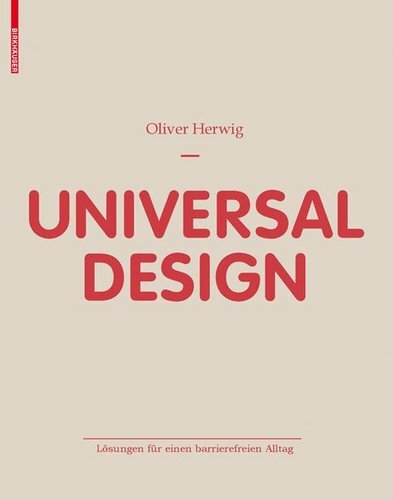Artikel
Vom Pantheon zum Pandämonium
Die «Autostadt» von Volkswagen in Wolfsburg
Direkt neben den traditionsreichen Wolfsburger Werkshallen errichtete die Firma Volkswagen einen Themenpark, auf dem sich alles rund um das Automobil dreht: Die 850 Millionen Mark teure «Autostadt» von Henn Architekten aus München besticht weniger durch herausragende Bauwerke als durch die Totalvermarktung eines Produktes.
Während der deutsche Expo-Pavillon in Hannover höchstens den Charme eines riesigen Autohauses versprüht, kreierte die Firma Volkswagen im nahen Wolfsburg gleich eine ganze Fahrzeug- Welt. Diese «Autostadt» übersetzt die Faszination der vier Räder in eine Choreographie von Gebäuden und Designstudien. Polarweiss, silbern und nachtschwarz erheben sich die Marken-Pavillons der Töchter Audi, Bentley, Lamborghini, Seat und Skoda inmitten einer 25 Hektar grossen Fjordlandschaft am Mittellandkanal. Diese können Autokäufer und Selbstabholer durchstreifen und sich anregen lassen zum Erwerb des einen oder anderen Extras. Am Ende des Parcours jedenfalls soll der Besuch im «Kundencenter» stehen, einem gläsernen Ellipsoid mit Riesenpylon, wo die Übergabe des Traumautos stattfindet. Es hat etwas von Flughafen und grosser Welt, wenn auf allen Displays der Fahrzeugtyp aufscheint, zusammen mit dem Namen des künftigen Besitzers. Während man in der «Wasserbar» Platz nimmt, ein wenig vom Glas mit Himbeersirup nippt und die Seele baumeln lässt, steht der Wagen in einem der beiden gläsernen Autotürme schon bereit. 800 Fahrzeuge warten dort permanent auf ihre Besitzer. Alle 40 Sekunden rollt ein werksneues Gefährt hinein, über Fahrstühle nach oben, 20 Stockwerke hoch, während ein anderes Richtung Kundencenter verschwindet.
Das weithin sichtbare Herz der «Autostadt» schlägt bisher im Zweizylindertakt. Doch sein Ausbau ist bereits geplant - hin zu 2000 Einheiten am Tag. Vier weitere Glastürme sollen sich einmal am Nordrand erheben, eine Phalanx des Fortschritts, die das dahinter liegende Werkgelände optisch überflügelt, wegdrückt. Mag diese alte Anlage auch noch den bestimmenden architektonischen Akzent setzen und von der Maschinenästhetik vergangener Zeiten künden, von Stahl, Schweiss und Russ, so ist die Autostadt längst weiter. Sie zelebriert nicht nur das Produkt, sondern präsentiert es als Teil einer allumfassenden Lifestyle-Welt. Das Informationszeitalter überrundet die Fertigung. Industrie wird Idyll, wird konsumierbares Lebensgefühl. Aufgabe der Architektur ist es, ebendieses Image zu überhöhen, Präsentations- und Projektionsfläche zu sein für die unter dem Dach von VW versammelten Marken: flexibel und international, doch zugleich aseptisch und leblos.
Insgesamt 850 Millionen Mark investierte VW in die zeitgleich mit der Expo in Hannover eröffnete «Autostadt». Trotz der Bezeichnung «Autostadt» sind die im Landschaftspark verstreuten Pavillons keineswegs urban. Eher gleichen sie barocken Lustschlösschen, ausgefeilten Impressionen inmitten eines gigantischen Spielfeldes. Jeder Pavillon hat seinen eigenen Auftritt. Denn während der Automobilproduzent unter seiner «Plattformstrategie» leidet, welche die gleiche Technik in verschiedenen Marken anbietet, was wiederum Käufer zu den gleichwertigen, aber preiswerteren Töchtern Seat und Skoda abwandern lässt, lieferte das Büro Henn Architekten aus München betont individuelle Pavillons. Die Devise lautete denn auch architektonische Vielfalt. Dabei taten es die Architekten den Konzern- Designern ähnlich, die über gleiche Bodengruppen verschiedenste Hüllen zaubern. Markensymbole sollten in greifbare Bauformen übersetzt werden - aus Audis Ringen entstand etwa ein elliptischer Pavillon mit zentraler Rampe, während Skoda mit der Assoziation «Tschechien - Märchenwelt» spielt. «Eine Botschaft aus einem kleinen Land hinter den Bergen» lautet denn auch der Titel der Begleitbroschüre. Zugleich glitzern in dem radialen Baukörper Tonnen von Bleikristall, was zu einer absurd-beschaulichen Gegeninszenierung zur sonst dominierenden Technik führte.
Seat hingegen probt spanisches Temperament und Lebensfreude. Bereits auf der Rampe zum Pavillon setzt rhythmische Percussion ein. Sie mündet in ein gehauchtes «Sssseat», das beim Überschreiten der Türschwelle erklingt. Wohl weil das durchbrochene S-Logo der Marke zu wenig Stoff für einen Pavillon ergab, griff man zu naturhafter Symbolik: Schnecke und Blatt, die sich zu einer amorphen Form verbinden. - Was bei Skoda nur angedeutet wird, perfektioniert Seat: die Sakralisierung des Fahrzeugs. Nach allerlei Vorhallen führt der Weg hinab ins Herz des Pavillons. Laserlicht empfängt den Besucher, kühles Blau tropft von den Wänden, und man fühlt sich um Tausende von Jahren zurückversetzt. In einem modernen Hypogäum taucht Seats Designkonzeptstudie aus einer kreisrunden Bodenöffnung auf: fliessende Formen, Aerodynamik pur, doch der automobile Gott gibt sich unnahbar hinter Glas.
Bentley entführt einen vollends auf eine mystische Reise: Mit ihrem tief in den künstlichen Hügel eingegrabenen Pavillon wirkt die Traditionsmarke wie in einer gigantischen Nekropole gefangen. Der Besucher schraubt sich in die Erde, vorbei an stampfenden Motoren und Video- Screens. Das Ensemble ist derart mit Symbolik aufgeladen, dass man ein Bersten und Knacken der Mauern zu hören glaubt. Seine Form gewinnt der Hügel in Anlehnung an die Rennstrecke von Le Mans, grüner Granit hingegen verweist auf ewige Markenwerte. Volkswagens «Weltforum der Automobilität» gerinnt hier zu einem Architektursetzkasten. Allein im Schiffsrumpf des «Zeithauses», einem Doppelgebäude mit ständiger Automobilpräsentation, zeigen die Architekten, wozu sie in der Lage sind: freie Formgebung statt symbolbeladener Repräsentationsarchitektur. Durch den langen Riegel des «Konzernforums» verlässt der Besucher ein Gelände, dessen Wunsch nach Bedeutung allerorten spürbar ist. Ein automobiles Pantheon hätte es werden sollen, doch ein architektonisches Pandämonium ist daraus geworden. Der Weg führt an einem gewaltigen Globus vorbei und über den Mittellandkanal, von dem man sich wünschte, er wäre Lethe.
Die Arena ruft
Münchens Olympiastadion soll dem Fussball geopfert werden
Nach jahrelangem Tauziehen verdichtet sich, was Auguren längst ankündigten: München erhält eine Fussballarena anstelle des alten Olympiastadions. Was einst Austragungsort der «fröhlichen Spiele» von 1972 war, die massgeblich dazu beitrugen, ein neues Bild Deutschlands in die Welt zu tragen, hat ausgedient. König Fussball übernimmt die Regie. Dabei gab es Versuche genug, das einzigartige Ensemble zu retten.
Doch selbst ein Sturmlauf von Architekten und Denkmalschützern (NZZ 22. 12. 98) zeitigte wenig Wirkung. Mehr noch: Günter Behnisch, Vater des weltberühmten Olympiadachs, wird nun selbst den Umbau durchführen. Was nach gezielter Selbstdemontage klingt, entbehrt nicht einer gewissen Tragik: Nach dem Bonner Plenarsaal von Behnisch, in dem sich künftig zahlende Kongressgäste einfinden werden, droht nun auch seinem Hauptwerk, dem zur Ikone stilisierten Olympiastadion, ein gravierender Identitätsverlust. Denn wie auch immer das Ergebnis des Umbaus ausfällt, das Alte wird irreversibel zerstört sein: Die Leichtathletikbahnen verschwinden, und das Stadionrund wird abgesenkt. Den beiden Münchner Bundesligavereinen schwebt ein moderner Fussball-Hexenkessel vor, vollständig überdacht und perfekt auf das 90-minütige Spiel abgestimmt. Die Kosten dafür bewegen sich mit 300 bis 400 Millionen Mark in der Höhe eines Stadion-Neubaus, auf den man damit freilich verzichtet. Mit bis zu 140 Millionen ist die Stadt München im Gespräch.
Drei Umbauvorschläge stehen zur Wahl: der sogenannte «Ring», der für das Olympiastadion einen zweiten, hohen Rang vorsieht, die «Schüssel»-Lösung mit neuen Tribünen sowie die «Westrang»-Variante, gemäss der unter dem bestehenden Olympiadach eine gewaltige Schräge errichtet werden soll. Schon die Namen lassen Schlimmes ahnen. Computersimulationen zeigen, dass sich der Charakter des Stadions durch das neue, transparente Runddach nachhaltig verändert. Eine Hälfte wird künftig unter zwei Dächern verschwinden, was Behnischs ursprüngliche Konstruktion weitgehend funktionslos macht. Das Stadion insgesamt gleicht einem Hybrid-Bau, hinter dessen Fassade die neuen Einbauten sichtbar werden. Was vom alten Stadion bleibt, der Name, passt nicht mehr zu der neuen Arena. Angesichts der gewaltigen Investition und der unwiderruflichen Zerstörung eines Architekturensembles von Weltgeltung darf Münchens Fussball gar nichts anderes als erstklassig bleiben. Sonst wäre die Arena die zweite Investitionsruine nach dem fehlgeschlagenen Umbau der Olympischen Radrennhalle zum Freizeitpark «Olympic Spirit».
Ufo über London
Ein preisgekröntes Bauwerk von Future Systems
Das neue Medienzentrum des Lord's Cricket Ground von Future Systems in London ist wohl die spektakulärste Architektur, die in diesem Jahr in Grossbritannien fertiggestellt wurde. Der Neubau, der vom Computerbildschirm bis zum Raumschiff die unterschiedlichsten Assoziationen weckt, wurde soeben mit dem Stirling-Preis des Royal Institute of British Architects ausgezeichnet.
London pulsiert, und wie in den Swinging Sixties erfasst der Umbruch ganze Quartiere. Das Neue durchdringt das Alte, wobei Traditionen teils brachial aufgebrochen, teils genial in die Zukunft verlängert werden. Der Hang zu architektonischen Experimenten ist stärker denn je. Doch kein Bauherr ging in den vergangenen Jahren so an die Grenzen wie «Lord's», jene nationale Cricket-Institution, die nicht mehr nur Sport-, sondern auch Architekturbegeisterte in den Nordwesten der Metropole lockt. Seit über einem Jahrzehnt arbeiten namhafte britische Baukünstler an der Sportarena und unterziehen sie einer permanenten Verschönerungskur.
Den Anfang machte 1986 Michael Hopkins mit dem «Mound Stand». Darauf folgte der «Grand Stand» von Nicholas Grimshaw. Doch nun scheint direkt neben dem gepflegten Rasen des Traditionsvereins ein Raumschiff gelandet. Teleskopbeine krallen sich in den Boden, darüber schwebt eine gewaltige, abgeschrägte Frisbee- Scheibe. In die Aluminiumhaut eingelassen sind Bullaugen und eine gläserne Beobachtungs- Lounge, von der aus sich das ganze Spielfeld überblicken lässt.
Das ultramoderne Medienzentrum, in der britischen Presse längst als «freundliches Ufo» gefeiert, bietet nicht nur Platz für 120 Reporter. Hier finden sich auch modernste Übertragungsräume, eine Bar und ein Restaurant. Dass die Sportberichterstatter nun selbst auf dem Präsentierteller sitzen, kann als augenzwinkernde Geste des Londoner Architekturbüros Future Systems verstanden werden, das 1995 mit diesem wahrlich futuristischen Entwurf siegreich aus dem Ausschreiben für den Neubau hervorgegangen ist. Sein Gebäude ist ein Ereignis, selbst für Londoner Verhältnisse. Die Aluminiumkurven des schwebenden Neubaus haben mehr mit modernem Industriedesign zu tun als mit konventioneller Architektur. Kein Wunder, dass in einer der jüngsten Publikationen von Future Systems eine ergonomisch geformte Kamera als Inspiration direkt neben dem Medienzentrum steht.
Das Äussere des riesigen Zyklopenauges ist so spektakulär wie die Art seiner Fertigung. Jan Kaplicky, Amanda Levete und der Projektarchitekt David Miller liessen die Aluminiumhülle kurzerhand von einer Bootswerft schmieden, zerlegen und vor Ort wieder zu einer riesigen organischen Skulptur zusammensetzen. So hat der Schiffsbau, der einst etwa Le Corbusier beflügelte, unmittelbar Einzug in die Bauwelt gehalten. Aus der grossen Metapher von damals wurde eine ingenieurtechnische Meisterleistung.
Die Realisierung dieses Chef-d'œuvre drohte freilich mehr als einmal den Kostenrahmen zu sprengen. Der Preis stieg schliesslich auf fünf Millionen Pfund - unter anderem auch deswegen, weil ursprünglich keine Klimaanlage vorgesehen war. Zudem mussten die Architekten von Future Systems mit ihrem Design auf die Besonderheiten des Marylebone Cricket Club Rücksicht nehmen. Um jede Blendung der Spieler auszuschliessen, entschieden sich die Architekten bei der Front für schräg nach unten abfallende Glasscheiben, die nur teilweise zu öffnen sind. Und sie liessen die Tribüne weitgehend unberührt, indem sie das Medienzentrum weit über die Ränge hievten, wo es tatsächlich zu schweben scheint.
Noch immer ist England ein guter Ort für Rituale. Dass freilich gerade der gezielte Bruch mit der Tradition stabilisierende Züge besitzt, beweist «Lord's» einmal mehr. Moderne Architektur scheint auf Lord's Cricket Ground zu gedeihen, je avancierter, desto besser. So gesehen ist selbst das futuristische Medienzentrum nur Teil einer grossen Inszenierung. Der Wagemut der Auftraggeber und die Innovationslust der Architekten wurden nun vor wenigen Tagen vom Royal Institute of British Architects mit dem begehrten Stirling-Preis honoriert.
Der grosse Brückenschlag
Milliardenprojekt verbindet Dänemark und Schweden
Europas Einigung schreitet voran. Und längst sind es nicht mehr nur Bürokraten, die das Tempo bestimmen, sondern Techniker und Ingenieure. Ganze Regionen und Länder rücken zusammen: Nach dem Tunnel unter dem Ärmelkanal, der das widerspenstige Albion gleichsam an den kontinentalen Haken nahm, und der Landverbindung über den Grossen Belt wartet der Brückenschlag über den Öresund mit neuen Superlativen auf. Zwischen Malmö und Kopenhagen geht die derzeit grösste Schrägseilbrücke der Welt ihrer Vollendung entgegen: Das vom binationalen CV- Konsortium realisierte Werk ist 1092 Meter lang und nahe an der technischen Obergrenze für derartige Konstruktionen. Die kombinierte Auto- und Eisenbahnverbindung verspricht Prosperität für Südschweden, das künftig noch enger mit der Region Gross-Kopenhagen verflochten sein wird. Das Wunderwerk der Technik überwindet in mehreren Etappen den 18 Kilometer breiten Sund. Auf dänischer Seite wurde eine künstliche Insel angelegt, von der aus ein Senktunnel zur Insel Peberholm führt. Hier erhebt sich eine Hochbrücke, deren Pylone mit 203,5 Metern das höchste Bauwerk Schwedens darstellen. Unter ihnen werden selbst Hochseeschiffe mühelos hindurchgleiten.
Im Mittelalter galten Brücken noch als direkte Verkörperung des gefahrvollen Wegs zum Heil, geschmückt von Kapellen und Heiligenbildnissen. Allerorts gefielen sie als fromme Werke, finanziert durch Ablässe, Stiftungen und Spenden. Heute denkt man wesentlich profaner und kündigt für die täglich erwarteten 11 000 Fahrzeuge Brückenzölle an. Wenn auch die Folgen für die Umwelt und die Region von über drei Millionen Einwohnern noch unabsehbar sind, scheint eines bereits festzustehen: Es werden neue Brückenschläge folgen, um die Hauptschlagadern des europäischen Warenverkehrs weiter auszubauen und zu vernetzen.
Von der Mega-Stadt zur Meta-Stadt
Die urbane Zukunft und ihre Planer - eine Tagung in Ulm
Das komplexeste Werk von Menschenhand steckt in der Krise. Mit einem Mal werden die Schattenseiten der Stadt sichtbar, die an ihrem rasanten Aufstieg zugrunde zu gehen droht: wie eine Supernova, die schliesslich unter der eigenen Schwerkraft zusammenbricht. In weniger als einer Generation werden zwei von drei Menschen in Ballungsräumen leben, die längst nicht mehr den Namen «Stadt» verdienen. Das europäische Modell hat damit ausgedient, und mit ihm die Planungssicherheit von Architekten und Kommunen. Es löst sich vor ihren Augen auf, kaum dass sie den Zirkel in die Hand genommen, den Computer hochgefahren oder den Aktendeckel aufgeschlagen haben. Der ökologische und logistische Kollaps der Megastädte hat begonnen. Und doch: nirgendwo scheint der Moloch Stadt lebendiger, nirgendwo regenerieren sich seine Glieder schneller als dort, wo er seine Bewohner verschlingt.
Liegt die Krise vielleicht woanders - begründet weniger in einer sich rasant ändernden Realität als vielmehr in unserer Wahrnehmung? Schon jetzt ist dem Phänomen «Stadt» nur noch als Metapher beizukommen: «Dschungel», «Krebsgeschwür» und «Organismus» mögen stellvertretend stehen für all jene biologistischen Bilder und Assoziationsketten, die den sozialen Raum, das Interaktions- und Experimentierfeld «Stadt», dadurch zu fassen suchen, dass sie es vollends aus dem rationalen Blickfeld entlassen und ihm den Charakter einer Naturgrösse verleihen.
Wie lautet die Diagnose der Architekten? Zunächst fällt auf, wie stark auch ihre Terminologie im Fluss ist und ihrerseits diskutabel wird: als gelte es, die eigene Basis zu sichern, bevor man Vorstösse ins Unbekannte unternimmt. Mit Sorge verfolgten Fachleute unlängst auf einer Tagung des IFG Ulm die Auflösung der Stadt durch physische Gewalt und falsche Ideologien. Aufgabe heutiger Architekten müsse es deshalb sein, so Helmut Spieker, weniger Einzelgebäude zu errichten als vielmehr Stadträume. Zugleich gelte es, Abschied zu nehmen von Planungsinstrumenten, die «sich vor allem dadurch auszeichnen, dass mit ihnen stets der zweite oder gar dritte Schritt vor dem ersten getan werde, die Festlegung der gebauten Zukunft durch konkrete Bebauungspläne, mit festen Bautypen, die sie bilden sollen». Er plädierte für offene Systeme, die «Spielraum lassen für individuelle Möglichkeiten der Nutzung und der Form, damit Vielfalt entstehen kann» und die zu revidieren seien, wenn neue Erkenntnisse dies verlangten oder nahelegten.
Offenheit und Vitalität des Urbanen charakterisieren auch Überlegungen des Zürcher Architekten Marc Angélil, wenn er die Stadt als Rhizom fasst, dessen wild wuchernde Wurzelsysteme jeder rationalen Ordnung widersprächen und als «neuer Typus pluralistischer Beziehungssetzungen» zu sehen seien: heterogen, mannigfaltig und voller asignifikanter Brüche. Noch einen Schritt weiter geht der Kölner Ulrich Königs, wenn er das urbane System und seinen bisher festgefügten Planungs- und Herrschaftsraum mit Entwicklungsprozessen im Internet konfrontiert. - Mit den zunehmend als grosse Simulation oder als virtuelle «Metastädte» verstandenen Metropolen ändert sich auch die Rolle der Architekten: vom Schöpfer zum Moderator, der den Prozess einer Stadtentwicklung hilfreich beobachtet, aber selbst nicht durch Herrschaftswissen Macht ausübt, sondern seine Kenntnisse bereitwillig weitergibt: eine Utopie, die alle Wünsche und Sehnsüchte des frühen Jahrhunderts von der klassenlosen Gesellschaft in die imaginären Weiten des Internets verlagert und dort wohl auch endgültig begräbt. Denn mit der fortschreitenden Kommerzialisierung des Netzes dürfte auch der Traum des herrschaftsfreien Raums zu einer Anekdote in Diskussionsforen werden.
Wesentlich realer als die Konkurrenz dieser Modelle scheint bereits heute der Wettstreit der Regionen und Stadtlandschaften in Europa, aber auch in Asien, Amerika und Afrika. Die allgemeine Globalisierung ist auch eine der Stadt und ihres bereits heute weltweiten Hinterlands. Dabei werden attraktive Standorte zunehmend danach gemessen, ob sie neben der notwendigen Infrastruktur auch Lebensqualität bieten, also nachhaltig mit den Ressourcen umgehen und die Kriterien der «Agenda 21» erfüllen. So ist die eben konstatierte Krise womöglich nur das allgemeinste Kennzeichen für «Stadt», ein Fingerzeig auf ihre Potenz und Wandelbarkeit.
An Haupt und Gliedern runderneuert
Bauten der Max-Planck-Gesellschaft
Die Max-Planck-Gesellschaft steht für solide Grundlagenforschung. Unter ihrer Federführung entstanden in den letzten Jahren aber auch mehrere Institutsneubauten mit oft anspruchsvollen Architekturkonzepten. Diese Gebäude sind nicht nur eine Investition in die Zukunft der Wissenschaft, sie bestimmen auch immer stärker den Auftritt der Institution nach aussen hin.
Der Grösse nach ist sie ein Gigant. Dem Alter nach aber eine Dame in den besten Jahren. Über 11 500 Mitarbeiter, 80 Institute und ein Etat von etwa zwei Milliarden Mark machen aus der 1948 gegründeten Max-Planck-Gesellschaft einen Forschungsriesen. Und zugleich ein unabgeschlossenes Projekt, das sich stets erneuern muss, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Um so mehr, als Hochtechnologie hohe Investitionen bei immer kürzeren Verfallszeiten bedeutet. Deshalb wurden in den letzten Jahren zahlreiche Institute mit neuen Gebäuden ausgestattet oder bestehende Einrichtungen renoviert. Modernste Technik in zeitgemässen Gehäusen - keine schlechte Aufgabe für Architekten, mit der Vorstellung des einsam vor sich hin brütenden Forschers aufzuräumen und den Instituten ein ansprechendes Erscheinungsbild zu verleihen. Wie etwa bei der Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotonstrahlung (Bessy II) in Berlin-Adlershof, wo direkt neben dem Teltow- Kanal ein futuristisches Ensemble entstand. Das Stuttgarter Architekturbüro Brenner & Partner schuf auf dem Gelände der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR für 196 Millionen Mark ein glänzendes Ufo mit 120 Metern Durchmesser. So überzeugend die Verpackungskunst hier ausfiel, so modisch-poppig gibt sie sich beim Institut für Physik in Dresden. Drei geschlossene Kuben wetteifern mit einem zackig in den Raum ausgreifenden, teilweise aufgeständerten Baukörper. Ocker und Violett dominieren, und Materialien prallen hart aufeinander. Eines jedenfalls steht fest: Die fast 130 Wissenschafter am physikalischen Institut zur Erforschung komplexer Systeme haben ein passendes Zuhause gefunden.
Münchner Kopfgeburt
Bei so viel Aufbruch in der Grundlagenforschung darf es nicht verwundern, dass auch der Überbau, die Münchner Zentrale, ein neues Haus verlangte. Es sollte ein krönender Abschluss werden, ein Zeichen modernen Wissenschaftsmanagements. Im historischen Ensemble von Hofgarten, Residenz und Marstall geriet der Bürokomplex freilich schnell zwischen alle Fronten der Kritik. 81,4 Millionen Mark liess man sich die Zentrale im Zentrum Münchens kosten. Nun füllen ihre Glasfassaden eine der prominentesten, gleichwohl jahrzehntelang vernachlässigten Baulücken der Altstadt. Umstritten war die Wahl von Anfang an. Schliesslich ging es um historischen Grund, um beste Innenstadtlage und den guten Geschmack. So offen und transparent die Glasfronten auch angelegt sind, dem Betrachter scheint es, dass sich das Gebäude förmlich einigelt und den in Beton gefassten Stadtgrabenbach zu einem veritablen Schanzwerk ausbildet. Selbst der Haupteingang heisst die Besucher nur bedingt willkommen. Schliesslich wacht davor Minerva selbst. Die göttliche Kopfgeburt hat der Peruaner Fernando de la Jara aus südafrikanischem Granit getrieben und als Profilstele samt Negativform beidseits des Eingangs postiert. Skylla und Charybdis könnten kaum abschreckender wirken.
Vielleicht liegt es an diesem Entrée, dass man kaum einen Blick auf die (an dieser Seite ohnehin von altem Baumbestand verdeckte) zweischalige Fassade wirft und gleich ins Innere stürmt. Dort folgt eine Überraschung. Das Gebäude öffnet sich zu einem grossen, alle Stockwerke durchmessenden Atrium, zu einem langgezogenen Dreieck, das noch dramatischer wirkt durch die perspektivisch verkürzte Freitreppe. Eine filmreife Inszenierung, die ein wenig an Hauptquartiere von Bond-Schurken erinnert. Tatsächlich ist das Spiel der vorgeschalteten Fassaden und schwebenden Plattformen wohlkalkuliert, eine Reminiszenz auch an die Kulissen des schräg gegenüberliegenden Nationaltheaters.
Gespiegelte Historie
Die drei Lichthöfe des Gebäudes wirken autark. Dabei antworten sie präzise auf die auseinanderstrebenden Baulinien des historischen Umfelds. Um den Marstallplatz wirksam abzuschliessen und doch nicht aus dem Raster von Residenz und Staatskanzlei zu fallen, entwickelten die Münchner Architekten Angelika Popp, Michael Streib und Rudolf Graf zwei unabhängige, gegeneinander versetzte Strukturen. Dem äusseren «U», das den monumentalen Fronten direkt gegenübersteht, wurde ein weiteres, um einige Grade versetztes «U» einbeschrieben. Eine formal bestechende Lösung. Was freilich als sanfte Umarmung von Klenzes Hofreitschule gedacht war, riegelt das Areal ab. Da helfen keine transparenten Fassaden, die das Ensemble je nach Tageszeit spiegeln, also auf sich zurückwerfen, oder ihm als dunkle Front gegenüberstehen. In dem Kokon aus Glas hingegen mag man noch vom Glanz der Residenz träumen, wo Teile der Hauptverwaltung jahrelang untergebracht waren.
Ein rechtes Gegengewicht zur Historie ist mit dem Neubau nicht entstanden. Dabei wurde hart um diesen Ort gerungen. Schliesslich hatte die Grossforschungseinrichtung mit der Rückkehr zu ihren Ursprüngen nach Berlin gedroht, wo einst die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft residierte, oder - weit weniger glaubwürdig - mit einem Umzug nach Bonn. 1992 sprang der Freistaat Bayern ein und bot das urbane Filetstück als zinsfreies Grundstück in Erbpacht. Das vom Krieg gezeichnete Areal sollte durch einen städtebaulichen Ideenwettbewerb und ein «zukunftsorientiertes» Verwaltungsgebäude erlöst werden. Prompt kam es zu einem Interessenkonflikt, als das Preisgericht den Architekten Graf, Popp und Streib zwar den ersten Preis des Realisierungsteils verlieh, sein städtebauliches Konzept aber auf Platz fünf verwies. Umgekehrt erging es den Berliner Architekten Hufnagel & Pütz, die den städtebaulichen Teil gewannen und beim Verwaltungsbau nur Dritte wurden. Beide Entwürfe erwiesen sich als grossenteils inkompatibel, und die angestrebte Einheit des Ensembles ging verloren. Dass gegen die gläserne Fassade heftig polemisiert und der Wettbewerbsentwurf schliesslich in einigen Punkten geändert wurde, mag dagegen nur noch als Episode innerhalb des ewigen Streits um das Bauen im historischen Kontext erscheinen.
«Abenteuer Forschung» heisst eine beliebte Sendung des ZDF. Früher lautete ihr Titel schlicht «Aus Forschung und Technik». Der kleine Unterschied macht deutlich, wie schwer die Vermittlung trockener Fakten geworden ist. Denn gefragt ist weniger der stille Forscher, der womöglich jahrelang an einem Detailproblem arbeitet. Vielmehr steht der geniale, exzentrische Macher im Mittelpunkt des Interesses. Und mit ihm griffige Formeln, die aus den Wirrnissen der Welt eine verständliche Ordnung ableiten. Da solche Vermittlung auf Bilder und Zeichen statt auf mathematische Grössen und Spezialterminologie setzt, erhalten die Phänomene eine ungleich grössere Bedeutung, als ihnen in der Theorie zukommt. Um so wichtiger wird das Gewand der Forschung, das Architekten ihrer Auftraggeberin Minerva umhängen.
Oliver Herwig
Völlig losgelöst
Design für den Weltraum
Es wird das teuerste Bauwerk aller Zeiten, und es befindet sich nicht einmal auf der Erde. 16 Nationen arbeiten an der Internationalen Raumstation ISS. Die ersten Module sind bereits im Orbit. Wie lebt es sich in der Schwerelosigkeit? Und wie antworten Designer auf die Herausforderungen des Weltraums? In München erforscht man ganzheitliche Lösungen für das All.
Im Weltraum, das heisst einige hundert Kilometer über der Erdoberfläche, scheinen 10 000 Jahre Zivilisation wie ausradiert. Alles beginnt von vorn. Den Anfang macht das Selbstverständliche. Denn im Gegensatz zu den leuchtenden Bildern der Science-fiction ist kein irdischer Tisch und kein Stuhl fürs All geeignet. Wie funktioniert eine Space-Dusche? Und wie die Toilette in der Schwerelosigkeit? Was ist beim Waschen zu beachten, wenn jeder Tropfen seine eigene Umlaufbahn einschlägt? Können Menschen kopfunter schlafen, oder ist die Frage nach der Orientierung irrelevant? Modernste Technik und viel Erfindergeist müssen zusammenkommen, wenn der Mensch im All überleben will. Bisher herrschte an Bord der Raumfahrzeuge die nackte Armut. Oder das Chaos - wie in der russischen Mir, die nur durch den Überlebenswillen wagemutiger Improvisationskünstler zusammengehalten wird. Abhilfe ist zumindest für die russischen Kosmonauten nicht in Sicht. Denn jedes Kilogramm, das mühsam ins All transportiert werden muss, schlägt mit etwa 40 000 Dollar zu Buche. Kein Wunder, dass selbst die Ingenieure der Nasa ganz zuletzt an Komfort dachten, als sie den Spaceshuttle entwarfen. Privatsphäre gibt es dort nicht, selbst die Toilette ist öffentlich. Das soll mit der Internationalen Raumstation ISS nun anders werden. Design lautet das Zauberwort.
Entwerfen heisst lernen
Während im All bereits die ersten ISS-Module zusammengefügt werden, arbeitet man an der Technischen Universität München unter Hochdruck am Aussehen eines ergonomischen Space- Habitats: Wohnen, schlafen, essen, arbeiten, duschen - alles steht auf dem Prüfstand und muss neu erfunden oder doch sinnvoll an die Schwerelosigkeit angepasst werden. Raumfahrttechniker und Architekten sind deshalb an dem Projekt gleichermassen beteiligt. In den vergangenen Jahren wurde am Lehrstuhl von Professor Eduard Igenbergs der «Munich Space Chair» entwickelt: eine Vorrichtung, mit deren Hilfe sich Astronauten fest im Raum verankern konnten. Drei Orbitalmodelle existieren von dem gleichermassen durch die Universität, die Industrie und den bayrischen Staat finanzierten Prototyp, eines davon im leckgeschlagenen Spectre-Modul der russischen Raumstation Mir.
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen konnte man sich am Lehrstuhl von Professor Richard Horden an komplexe Fragestellungen - wie eine Tisch-Stuhl-Kombination - wagen. Die «Micro Architecture Unit Munich» scheint für Aufgaben dieser Art prädestiniert. Denn hier gilt die Devise: «Touch the earth lightly.» Der poetische Satz ist Programm, wenn es darum geht, Material einzusparen und mit einem Minimum an Aufwand flexible und belastbare Lösungen zu entwickeln. Die Studenten «sollen lernen, komplexe Anforderungen einfach zu erfüllen», erklärt Lydia Haack, die zusammen mit ihrem Team am Tisch der Raumstation arbeitet. Für die angehenden Architekten scheint das schon Routine. Denn Teil ihrer Ausbildung besteht darin, eigene Projekte nicht nur zu tadelloser Papierform zu bringen, sondern diese auch selbst zu realisieren, also tatsächlich zu bauen, dafür Sponsoren zu finden und die Idee womöglich noch zu vermarkten. Entstanden sind auf diese Weise so unkonventionelle Arbeiten wie der «Kajak Testpoint» oder der «Silver Spider», ein fragiles Metallgerüst in Leichtbautechnik. Bei aufwendigen Entwicklungen wie dem Design der Raumstation ist die Finanzkraft der Uni freilich schnell überfordert. Privates Sponsoring ist gefragt.
Das Architekturstudio im vierten Stock der TU München bietet markante Blickachsen auf Frauenkirche und Zugspitze. Eine weitere geht neuerdings geradewegs nach oben, in Richtung Raumstation. «Wir alle lernen, was es heisst, für den Weltraum zu bauen», erklärt Horden, der im Oktober 1996 den Lehrstuhl für Entwerfen und Gebäudelehre übernahm. Demnächst wird der Titel in «Gebäudelehre und Produktentwicklung» geändert, denn nichts anderes unterrichtet man hier: eine Verbindung von Architektur und Produktdesign. Drei Projekte für die Raumstation - «Galley, Kochen/Essen», «Crew quarter/Private space, Mannschafts und Privatquartiere» und «Hygiene facility design, Körperhygiene» - sind in der engeren Wahl. Gerade durchlaufen sie verschiedene Testphasen, immer in der Hoffnung, einen Prototyp mit auf den für Juli angesetzten Parabelflug mit der «KC 135» zu nehmen. An Bord einer leergeräumten Boeing kann für 25 Sekunden Schwerelosigkeit simuliert werden, bis der Pilot den antriebslosen Sturzflug wieder abfängt. Während das Flugzeug aus grosser Höhe um mehrere tausend Meter fällt, müssen die Probanden unter Weltraumbedingungen testen, was es heisst, den Tisch zu besteigen, sich zu arretieren - und womöglich noch zu arbeiten.
Das Leben im All
Was im Weltall so leicht wirkt, muss durch äusserste Konzentration erkauft werden: Eine winzige Bewegung genügt, und schon schweben die Astronauten quer durch den Raum, weg von den Kontrolltafeln. Wer sich hier nicht «anschnallt», kommt leicht ins Trudeln. Der weiterentwickelte «Munich Space Chair», der in seiner jetzigen Ausführung aus Alu-Stangen an ein überdimensionales Spielzeug aus der Kinderstube erinnert, hat seine Feuertaufe bereits hinter sich. Unter Wasser - also unter weltraumähnlichen Umständen - wurden der richtige Sitz, die Passgenauigkeit und das Zusammenspiel der einzelnen Elemente geprobt. In seiner endgültigen Form wird er als filigranes Metallgestänge die wichtigsten Funktionen eines heimischen Sekretärs samt Stuhl übernehmen. Zwischen beweglichen Metallplatten werden Oberschenkel und Gesäss fixiert, die gleichfalls bewegliche Tischplatte ermöglicht dann konzentriertes Arbeiten in der Schwerelosigkeit.
Der Mensch ist ein geborener Raumfahrer. Zumindest scheint es so, wenn Astronauten schwerelos durchs All gleiten. Tatsächlich nimmt der schwebende Körper im Ruhezustand, der sogenannten «neutral position», eine fötale Stellung ein: die Knie leicht zum Körper gezogen, die Arme frei auf Höhe der Schultern schwebend. Eine gewohnte Ausrichtung nach irdischem Vorbild, mit ausgestreckten Beinen, wäre «dort oben» mit Anstrengungen verbunden. Nicht nur deshalb bedeutet Design für den Weltraum, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen. Zunächst fällt die Vorstellung von Schwere: «Bereits beim Bau der Pyramiden hielt man Masse und Gewicht für das Wichtigste. Und daran hat sich seit 5000 Jahren nichts geändert», erklärt Horden und fügt hinzu: «Unser Design ähnelt eher dem von Autos oder von Flugzeugen und weniger konventioneller Architektur.» Als verbindendes Element von «microarchitecture» und «microgravity» sieht er nicht nur radikale Leichtbauprinzipien, sondern ein fundamentales Verständnis für den Menschen im Raum. «Wie arbeitet man im Weltraum?» ist eine der ersten Fragen an die Studenten.
Ganzheitliches Denken bestimmt die Mikroarchitektur: Ökologie im High-Tech-Gewand. Hier liegt denn auch die Bedeutung der Raumfahrt-Architektur für das tägliche Leben: «In Zukunft», so meint Horden, «müssen wir lernen, mehr mit erheblich weniger Aufwand zu erstellen.» Der Weltraum dient dazu lediglich als Katalysator. Dort oben entsteht eine ganz neue Ästhetik. Wasser glitzert kostbarer als jeder Diamant. So lag es nahe, den verfügbaren Vorrat nicht irgendwo wegzuschliessen, sondern als Blickfang für die Crew einzusetzen - glitzerndes Nass hinter Glas. «Millionen Dinge warten nur darauf, entdeckt zu werden. Es ist so, als ob man eine Schatztruhe öffnet», erklärt der Engländer. Von diesem Optimismus hat ein guter Teil Eingang in das Faltblatt zur Raumstation gefunden. Ein weisser Pfeil schwebt dort durchs All. «We are here», steht darüber zu lesen. Und tatsächlich erkennt man die Erde, als glitzernde blaue Kugel, umringt von Venus und Mars, auf dünnen Umlaufbahnen um unser Zentralgestirn. So einfach ist das, vom Weltraum aus gesehen.
Wie ein Quartier entsteht
Vom Flughafen München-Riem zur Messestadt
München ist bekannt als Stadt der Musik, der Theater und des Oktoberfests. Doch als Heimstatt moderner Architektur? Da herrscht selbst in Fachkreisen Skepsis. Dabei ist ein ganzer Stadtteil im Entstehen: Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens sucht die Messestadt Riem nach einer neuen Urbanität in Citynähe.
Vom Tower des Flughafens Riem hatte man früher einen guten Überblick. Nun blockt die neue Messe alle Sicht nach Osten ab, und Schotter umspült die Überbleibsel des Airports. Kein Jet würde hier noch zur Landung ansetzen. Nur Kondensstreifen künden vom regen Flugverkehr über München. Mit einemmal wirken Wappenhalle und Kontrollturm wie Kulissen einer vergessenen Inszenierung. Wo bis zum 17. Mai 1992 Jets in die Lüfte stiegen, prägen neben weiten, meist noch unbebauten Flächen Dutzende von Baugruben und Kränen das Bild. Doch generalstabsmässig schieben sich erste Gebäude vor und setzen neue Landmarken, die das riesige Areal aufteilen. 556 Hektaren Schotter-, Gras- und Sandflächen weichen parzellierten Einheiten und fügen sich in ein klares Raster von Verbindungswegen. In 15 Jahren wird der Wandel vom einstigen Flughafenareal zum modernsten Stadtteil Münchens abgeschlossen sein. Schon heute sind die Umrisslinien des Projekts erkennbar. Rund um die bereits realisierten Bauten - das Internationale Congress-Centrum, die Neue Messe, die Feuerwache und die Grund- und Hauptschule Riem - soll Urbanität wachsen: Wohngebiete für 16 000 Menschen und beinahe ebenso viele Arbeitsplätze. Wenn schon nicht «nachhaltig» gebaut werden kann, so soll doch zumindest ein grüner Bezirk wachsen, in dem sich Ökonomie und Ökologie nicht ausschliessen. Dazu muss allerdings aus den drei Hauptelementen des neuen Quartiers - Wohn-, Messe- und Gewerbebauten - ein lebendiges Ensemble wachsen.
Das Alte im Neuen
Vom eleganten Oval der Flughafenanlage wird kaum mehr als ein rudimentärer Bogen bleiben, der sich nach Süden, im künftigen Landschaftspark, vollends verliert. Schon rosten die Schilder am mannshohen Draht. Aber für einige Zeit werden sich neue und alte Zeichensysteme überlagern und zumindest Chiffren des Airports erkennbar bleiben. Bevor das Koordinatennetz der Messestadt endgültig die Regie übernimmt, bildet das Areal seinen eigenen Subtext aus, ein Palimpsest, das entziffert werden will. Noch immer etwa ist die einstige Start- und Landebahn zu ahnen, freilich um etliches nach Süden verschoben, so, als hätten Riesenhände die alten Markierungen ausradiert und kurzerhand verlegt. Denn auch Neu- Riem besitzt eine markante Magistrale: Anderthalb Kilometer gerade Strecke, bis die Willy- Brandt-Allee im De-Gasperi-Bogen zum Zubringer für die Autobahn 94 wird.
Gleichwohl ist hier Individualverkehr nur geduldet. Für die eigentliche Anbindung ans Zentrum sorgt die verlängerte U-Bahn-Linie der «U 2» mit ihren Haltestellen «Messestadt West» und «Messestadt Ost». Sie bildet das verkehrstechnische Rückgrat des Quartiers, das bisher nur mit S-Bahn und Bus zu erreichen war. Von hier aus wachsen im ersten Bauabschnitt Wohnzellen. Auch sie hängen mittelbar am Zentralnervensystem der Willy-Brandt-Allee. Während also nach Süden das Gelände in einem Landschaftspark auslaufen wird, formen sich nach Westen, in Richtung Stadtzentrum, härtere Grenzen. Hier werden Reviere abgesteckt für Gewerbeansiedlungen. Ähnliches gilt für den Osten. Nahe Salmdorf werden einmal Ver- und Entsorgungsflächen stehen.
Eine Messe für die Stadt München
Über Jahrzehnte gewachsen, waren die Messehallen auf der Theresienhöhe in den achtziger Jahren erschöpft. Aussicht auf Erweiterung bestand nicht mehr. 1987 fiel schliesslich die Entscheidung für den neuen Standort Riem, und im Juli 1991 wurde europaweit ein städtebaulicher Ideenwettbewerb zur künftigen Nutzung des Flughafengeländes München-Riem ausgeschrieben, den das Büro Jürgen Frauenfeld aus Frankfurt a. M. unter 75 Teilnehmern gewann. Bereits zum Jahreswechsel folgte ein Realisierungswettbewerb zur Neuen Messe. Den ersten Preis errangen die dänischen Architekten Erik Bystrup, Torben Bregenhøj, Eva Jarl Hansen, Peter Mortensen und Bjørn Vandborg aus Kopenhagen. «Ruhe und Klarheit der Gebäudehüllen war uns oberstes Gebot», erklärt Bregenhøj, «hochwertige Materialien sollten helle und grosszügige Räume charakterisieren.» So sind die Baukörper denn auch geworden: elegant, aber langweilig.
Die Dänen schufen eine funktionale, das Areal zügig erschliessende Architektur, die trotz ihren Ausmassen zurückhaltend wirkt. Im ersten Bauabschnitt verfügt die Neue Messe über 140 000 Quadratmeter, im Endausbau werden es 200 000 sein, was München auf Platz vier der Messestandorte innerhalb der Bundesrepublik katapultieren wird: nach Hannover, Köln und Frankfurt, gleichauf mit Düsseldorf, aber noch vor Berlin und Leipzig. Das 650 Meter lange und 35 Meter breite Atrium verbindet die zwölf linear angeordneten, stützenfreien Messehallen und wird so zur öffentlichen Wandelhalle. Schade nur, dass zwischen den weiss und silbergrau glänzenden Bauten und ihren filigranen Fassaden aus Metall und Glas kein Blick auf die Alpensilhouette möglich ist wie etwa von der gegenüberliegenden Feuerwache.
Mondlandschaft mit Monolithen
Aus dem Nirgendwo, einem gespenstischen Scheideweg der Planstrassen X und 3, wuchs im April 1998 Münchens modernste Feuerwache: ein winkelförmiger Bau von fast japanisch anmutender Schlichtheit. Architekt Reinhard Bauer bewies aber auch einen Sinn fürs Exquisite: Im Inneren steht Ahornholz gegen Sichtbeton; geätztes Glas und Schiebetüren öffnen die Besprechungsräume zum Gang hin. Für Bauer, der an der TU München studierte und danach in Berlin und München arbeitete, war das Projekt einer seiner ersten grossen Aufträge. Als er 1995 den Wettbewerb gewann, wollte er jede plumpe Assoziation an «Feuer» vermeiden. Selbst die Signalfarbe Rot oder ein Schlauchturm schienen ihm bereits zuviel. Statt dessen spricht der Bau in Silbergrau und Schwarz - mit subtilen Botschaften und kleinen Fingerzeigen - von seiner Bestimmung. Vor den Ruhequartieren des einen Flügels erhebt sich etwa eine Lavawand, und das Dach ist, für den Passanten unsichtbar, mit Ziegelsplitt gedeckt - rot, immerhin. Bauers minimalistisches Programm spiegelt sich ebenso im Eingangsbereich, wo es, nur knapp über dem Boden, in schlichten Lettern heisst: «Feuerwache 10».
Von ähnlicher Prägnanz ist die Grund- und Hauptschule Riem. In dieser Unterrichtsstätte mit ihren winzigen Zellenfenstern in der holzverkleideten Fassade könnte man durchaus einen Gefängnisbau vermuten. Dabei ist das spartanische Aussehen eher auf zuviel denn auf zuwenig Planung zurückzuführen. Dem Stuttgarter Büro Mahler, Günter, Fuchs gelang ein markanter, auf Fernwirkung angelegter Bau. Vor- und zurückspringende Flügel und der überzeugend in die Front eingebundene Kubus der Hausmeisterwohnung lassen den Raum zwischen den «Kisten» nicht als Vakuum erscheinen, sondern betonen eine musikalische, kontrapunktische Anlage. Der Reiz des Einfachen, hier ist er greifbar: als Abfolge eleganter Baukörper.
Planung und Struktur
Fünf Wettbewerbe waren nötig, um dem riesigen Areal zumindest auf dem Papier Gestalt zu verleihen - 556 Hektaren Bauland in München, wann hat es das zuletzt gegeben? Man darf hierin wohl den Versuch sehen, ein übergeordnetes Gestaltungskonzept im ausfransenden Gelände der Peripherie zu verwirklichen. Eine gute Hand bewiesen die Bauherren bei den öffentlichen Gebäuden. Nun müssen sich um diese Kondensationskerne Wohn- und Geschäftsbauten lagern und die Leere füllen, die vom Oval des Flugfelds noch ausgeht. So gross die Aufgabe, so pragmatisch war Münchens Zugriff. Planung und Koordination des Wandels im «wilden Osten» liegen nämlich in den Händen des «Massnahmeträgers München-Riem GmbH», kurz MRG. Dahinter verbirgt sich keine städtische Beteiligungsgesellschaft, sondern eine private Konstruktion, je zur Hälfte getragen von der GBWAG (Bayerische Wohnungs-Aktiengesellschaft), einem Wohnbauunternehmen, und der Gewerbegrund, einem Projektentwickler. «Wir haben kein Gewinninteresse, sondern leben von einem vereinbarten Honorar, das die Stadt München bezahlt», erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Franz Eichele. «Unsere Tätigkeit geht bis zur Erschliessung und Parzellierung der Grundstücke. Sie schliesst keine Grundstücksgeschäfte mit ein. Die Grundstücke sind überwiegend Eigentum der Stadt und werden durch sie verkauft.»
Um die Interessen der Landeshauptstadt zu wahren, existiert ein Beirat, dessen Vorsitz bei Oberbürgermeister Christian Ude liegt. Der Beirat tagt alle drei bis vier Wochen, und ihm sind alle wesentlichen Entscheidungen zur Zustimmung vorzulegen. Als grössten Vorteil gegenüber staatlichen Stellen sieht Eichele die Flexibilität des Unternehmens, das aus derzeit 15 Mitarbeitern besteht: Hier gibt es «kürzere Entscheidungswege». Dies hat unter anderem dazu geführt, dass man die einzelnen Projekte auch im Terminplan und Kostenrahmen, hinsichtlich der Kosten sogar deutlich günstiger als budgetiert, erstellen konnte. Rund 2600 Wohnungen wurden im ersten Bauabschnitt geschaffen, und wenn es zunächst auch Verzögerungen gab, so läuft die Placierung am Markt doch planmässig. Eine Prognose bis ins Jahr 2013, dem voraussichtlichen Ende der Baumassnahmen, wagt freilich niemand abzugeben - zu unwägbar ist die Entwicklung über anderthalb Jahrzehnte.
Grün soll das Quartier werden, mit kurzen Wegen zwischen Arbeit und Wohnen, ein Stadtteil mit hohem Erholungswert, in der - wohl vergeblichen - Hoffnung, auch manchen Weltenbummler und Kurzurlauber zu fesseln. Unwillkürlich drängt sich da der Gedanke an Siedlungsprojekte der klassischen Moderne auf, aber auch an Gartenstädte und den gar nicht mehr so neuen Versuch, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. In den Blick kommen freilich auch die Grenzen einer «längst nicht mehr zu leistenden planerischen Fürsorglichkeit». Erst die Zukunft wird zeigen, ob das Konzept der Neuen Messe im Münchner Osten aufgeht. In Riem jedenfalls scheint vorsichtiger Aufbruch angesagt inmitten der saturierten Stadt München.
[ Literatur zum Thema: Messe München. Entwurf, Planung, Realisation. Prestel-Verlag, München 1998. 159 S., Fr. 98.-. ]
Dabeisein ist alles
Vom Radstadion zum «Olympic Spirit»
Es hatte sich schon lange abgezeichnet; nun ist es offiziell: Vom vielbeschworenen olympischen Geist ist nur noch Kommerz geblieben. Und vom ehemaligen Münchner Radstadion eine mittelmässige Fun-Arena. In zweijähriger Bauzeit wurde alles Authentische gegen eine vollklimatisierte, sterile Event-Architektur eingetauscht. Rund 75 Millionen Mark - abgesichert durch eine Bürgschaft der Stadt München - flossen in den Umbau. Dafür wurde das Stadion vollständig entkernt. Auf der Grundfläche von 113×51 Metern und zwei Ebenen können nun bis zu 2600 Besucher die «olympische Welt des Sports aktiv und passiv erleben». Dabeisein ist alles. Das Internationale Olympische Komitee vergibt die Lizenz, das Konzept wurde in den USA von der International Spirit Development Corporation entwickelt. Dahinter steht Andrew Y. Grant, der in seiner über dreissigjährigen Karriere in der Freizeit-Industrie unter anderem den «Wild Animal Parc» in Kalifornien oder die Universal Studios in Hollywood leitete.
Sensationen wie diese darf man freilich nicht erwarten. Das macht bereits die Presseerklärung deutlich: «Nach dem Erwerb der Eintrittskarte gelangen die Gäste in die Begrüssungshalle. Sie ist mit diversen Info-Terminals und Anzeige-Displays ausgestattet. Rund um eine symbolisch brennende olympische Flamme erfährt der Besucher so konkret, was ihm Olympic Spirit München bietet.» Und das ist furchterregend. Entstanden ist ein potemkinsches Dorf, eine Abfolge von Arcade-Spielen und interaktiven Simulationen, die unendlich weit von dem entfernt sind, was sie eigentlich vermitteln wollen: direkte Teilnahme am Sport. Ob 180-Grad-Videopräsentation oder High-Tech-Computer, der Besucher wird Teil einer gigantischen Spielkonsole. Irgendwo hinter den 10 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche versteckt sich noch eine 500 Quadratmeter messende Sporthalle. So gross ist allerdings auch der Sports-Shop mit Originalrequisiten, der einen beim Verlassen des Ausstellungsbereichs erwartet: economic spirit in Perfektion.
Unterirdisches Lichterfest
Neues Design für Münchens U-Bahnhöfe
Der Abstieg ist vorprogrammiert. Unbarmherzig geht es nach unten, ins Herz der Erde. Doch kein staubiger Grubenkorb nimmt die Besucher auf, sondern eine metallene Fahrtreppe. Rechts stehen, links gehen. Ein langgezogener Bahnsteig kommt in den Blick, eine Halle ohne Stützen oder störende Träger. Roher, unbehandelter Beton, zwei Gleise. Hier ist Endstation, wortwörtlich. Denn mit dem U-Bahnhof «Westfriedhof» läuft die U 1 im Münchner Norden aus. Wer freilich auf stille Einkehr und Ruhe hoffte, sieht sich einer theatralischen Inszenierung gegenüber. Im Untergrund führte der sonst für fragile Lichtobjekte bekannte Designer Ingo Maurer martialisch Regie. Bekannt wurden Maurer und sein Team bereits in den frühen achtziger Jahren durch ironisch gebrochene Leuchtobjekte. Niedervolthalogenanlagen im High-Tech-Look lagen damals ganz im Trend. Dieser spielerisch-leichte Ansatz fehlt beim Münchner Grossprojekt. Hier tauchen elf überdimensionale Halbkugeln aus Aluminium, entfernt an mutierte Trockenhauben oder gestürzte Schüsseln erinnernd, den Bahnsteig in farbiges Licht: gelb, rot, blau. Fahrgäste stellen sich hier gerne an den Rand, näher an die Gleise, um etwas Abstand zwischen sich und die schwebenden Ungetüme zu bringen. An den Tunnelwänden kann sich das Auge endlich festsaugen. Über sie fliesst Maurers Blau, ein irisierender Ton, der die gesamte Station durchdringt und zusammenhält.
München leuchtet unterirdisch
Auch jenseits der festlichen Plätze und weissen Säulentempel, der antikisierenden Monumente und Barockkirchen, die Thomas Manns Diktum vom «leuchtenden München» beschwört, gibt es Mindestanforderungen an die Ästhetik öffentlicher Räume. Der unvermeidliche Aufenthalt im Untergrund solle, so Stadtrat Rolf Schirmer in einer Festschrift zum U-Bahn-Bau, eine positive Grundstimmung hervorrufen. Zugleich räumt er ein, dass nicht jede Station höchsten Ansprüchen genüge. Münchens unterirdische Welten sind weder Elysium noch Inferno, sondern zuallererst Spiegelungen einer zeitverhafteten Architektur. Dieses Schicksal teilten sie freilich mit anderen Referenzpunkten auf dem europäischen Kontinent, etwa mit der 1998 eröffneten, ganz in puristisches Weiss getauchten Lissabonner Metrostation Baixa/Chiado oder mit der Jubilee Extension Line, die den «Millennium Dome» mit dem Londoner Stadtzentrum verbinden soll. Letztlich ist der Vorwurf der Zeitgebundenheit ungenau; denn gerade das avancierteste Design schreibt sich als spezifische Signatur in alle Projekte ein. Kaum anders ist die Situation beim Münchner «Westfriedhof». Freilich gelang dem Architekturbüro Auer & Weber inmitten des beschaulichen Villenvororts Gern ein beinahe magischer Ort: kein beliebiger Platz unter der Erde, kein Verteilerbahnhof für Menschen, sondern ein Raum mit hohem Wiedererkennungswert.
Der U-Bahn-Bau und die nachfolgenden Olympischen Spiele 1972 wurden für München zum grossen Sprung nach vorn. Noch immer spricht der ehemalige Oberbürgermeister Hans- Jochen Vogel von einem Projekt, das die Struktur der Stadt wie kaum ein anderes in diesem Jahrhundert verändert habe. Es klingt paradox: Gerade das Unsichtbare, ja Klandestine des Tunnelbaus half im Zuge der «fröhlichen Spiele», die Isarmetropole vollends in die Moderne zu schieben. Rund 80 Bahnhöfe und ebenso viele Kilometer Schienen umfasste 1998 das unterirdische Netz, und 900 000 Fahrgäste nutzen dieses Angebot täglich. Allein dies sei Grund genug, in den Stationen mehr als nur «räumliche Strukturen zur Bewältigung der Fahrgastströme» zu sehen, sondern «vor allem die architektonische Formung öffentlicher Räume», erklärt Oberbürgermeister Christian Ude. Dabei scheint manches in die Jahre gekommen. Vom Glanz eines Otl Aicher und seines feinsinnigen Farbprogramms etwa blieben nur noch Relikte einer verblassenden Ästhetik, bestens zu erleben in den Stationen der U 3, die geradewegs zum Olympiazentrum führt.
Transparente Bahnstation
Neue Perspektiven bot die erweiterte U 1. Mit den neuen Stationen der in einem Winkelhaken Münchens Nordwesten mit dem Südosten verbindenden Linie entstanden vielschichtige Variationen über das Thema «moderner U-Bahnhof». Unter den teils in Spektralfarben schillernden, teils auf pure Materialästhetik setzenden Stationen bildet St. Quirin zweifellos das Highlight. Hier bricht alles Unterirdische nach oben, drängt ans Licht. Eine mächtige Glasfront beherrscht die Szene. Am Computer entstand ihr geschwungenes Schalentragwerk, das knapp oberhalb des Bahntrassees einsetzt und hinaufreicht bis zum Mittelgrat des transparenten Daches. Geblendet vom unvermittelt einfallenden Tageslicht, erleben die Fahrgäste für wenige Augenblicke echt bayrisches Himmelsgewölk. Doch auch umgekehrt geht der Blick. Vom Rand des Kraters, der sich um die Panoramascheibe erstreckt, zwischen Unkraut und Schneeresten, tut sich eine zunächst befremdliche Perspektive nach innen auf: hinein ins Herz der unterirdischen Verkehrsströme. Besonders abends, wenn die Station gleissend in den Nachthimmel zu entschweben scheint, wird das gekrümmte Glasauge von St. Quirin zur veritablen Flimmerkiste für Passanten. Darüber vergisst man leicht, dass die vorgelagerte Mulde alles andere als gelungen ist. In ihr sammelt sich bereits Unrat, und dieser beschert dem High-Tech-Bahnhof und seiner eleganten Frontscheibe nicht die beste Aussicht. Und doch gelang mit der gläsernen Dachschale, für die der Architekt Paul Kramer vom U-Bahn-Referat in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Elsner verantwortlich zeichnet, etwas Wunderbares. Ganz selbstverständlich gibt sie Einsicht in den sonst so verschlossenen und düsteren Untergrund. Wer U-Bahnhöfe als ungeliebte Durchgangsbereiche kennt, als Orte, die möglichst schnell zu überwinden sind, wird in den Stationen der erweiterten Linie 1 auf ein subterranes Reich der Überraschungen treffen.
Flic Flac in Passau
Der Allrounder André Heller als Architekt
Von Betrug war die Rede und von Dilettantismus. An Passaus «Neuer Mitte» habe sich kein diplomierter Architekt, sondern ein Variétékünstler versucht. Selbst der Referent für Stadtentwicklung, Franz Xaver Scheuerecker, erklärte in einem Interview: «Das wird nichts. Das ist nicht machbar.» Heller reagierte postwendend. Sein Entwurf einer «internationalen Gedanken- Freihandelszone» stehe nicht mehr zur Verfügung. Auf dem Gelände der von den Nazis errichteten und durch den politischen Aschermittwoch weit über Bayern hinaus bekannten Nibelungenhalle sollte Passaus neues Herz schlagen. Hellers Vorschlag sah dazu eine Kombination aus Konzert- und Kaufhaus samt Aussichtsturm und Gartenanlagen vor. Allerdings fiel sein Entwurf durch eine beängstigende Abwesenheit von Architektur auf, zumal das Einkaufs- und Erlebnisparadies ganz unter einer grünen Dachrampe verschwand, gleichsam geborgen im Schoss der Erde.
Während sich Passaus Bürger spontan angetan zeigten, meldeten Architekten, Fachpresse und das Feuilleton der «Süddeutschen Zeitung» Bedenken an. In der harschen Kritik sah Heller «eine Art Glaubenskrieg», in dem der «Gegner vor keiner Diffamierung» zurückschrecke. Oberbürgermeister Willi Schmöller sprach gegenüber der Passauer «Neuen Presse» gar von einer «Architektenmafia» und gab an, mit Heller weiter im Gespräch zu bleiben. Dabei wollte Heller - Begründer des Zirkus Roncalli und des poetischen Variétés Flic Flac - nach eigenem Bekunden gar nicht als Baumeister auftreten, sondern sich mit «wesentlichen Architekten» verbünden. Er sehe seine Aufgabe eher in der «Herstellung von Faszinationen». Wie unlängst im «Meteorit» in Essen, einer 15 000 Quadratmeter grossen Halle mit Multimedia-Einlagen. Wie es scheint, ist Passau vergleichsweise glimpflich davongekommen, sieht man einmal vom alljährlichen Hochwasser ab.