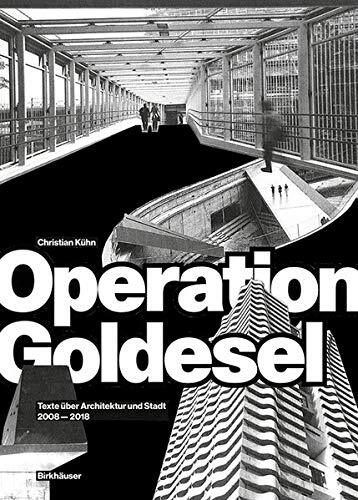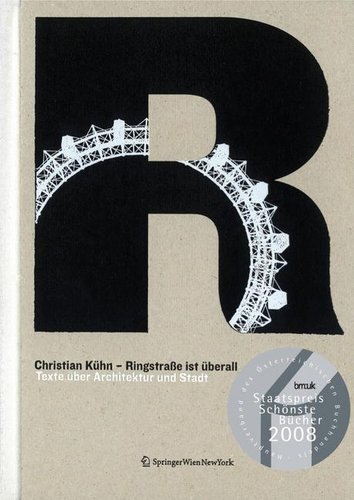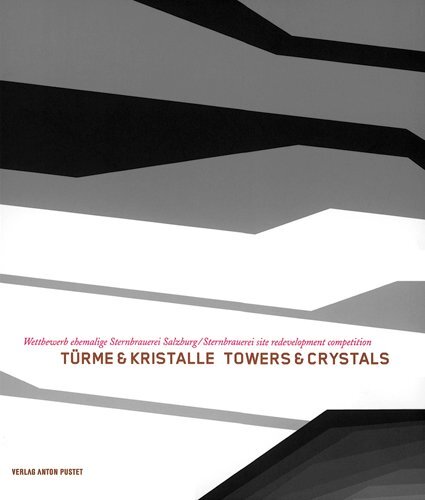Die neue Sport Arena in Wien-Leopoldstadt: Hier beweist die Stadt Mut
Die neue Sport Arena Wien bietet Platz für Leichtathletik, Ballsport, Kunstturnen, Kraft- und Cardio-Training. Als Neubau und ohne begrünte Fassade widerspricht sie aktuellen Trends in der Architektur – belegt aber den Mut der Stadt, die Interessen der Nutzer zu berücksichtigen.
Irgendwann war hier das Ende der Welt, eine Aulandschaft mit mäandernden Wasserläufen, in die sich die Donau aufspaltete. Erst durch die große Donauregulierung der 1870er-Jahre entstand daraus ein Fluss mit parallelen, wie mit dem Lineal gezogenen Ufern. Hunderte Hektar Bauland für die Donaumetropole Wien – Otto Wagners unbegrenzte Großstadt – wurden so geschaffen. Nach dem Ersten Weltkrieg verwandelte sich die Metropole in den „Wasserkopf“ eines scheinbar viel zu kleinen Landes mit einem Überangebot an Raum. Die Stadtregierung konnte großzügig mit den Flächen umgehen: Als 1929 nach einem Standort für ein Sportzentrum mit dem größten Stadion und dem größten Freibad des Landes gesucht wurde, fiel die Wahl auf ein Areal im Prater östlich der bestehenden Trabrennbahn. Hier fand 1931 die 2. Internationale Arbeiter-Olympiade mit 80.000 Teilnehmern aus 23 Ländern statt.
Die Anbindung an den Fluss war damals kein Thema. Das rechte Ufer der Donau blieb – wie der Name Handelskai andeutet – städtische Infrastruktur, die sich bis in die 1970er-Jahre nur langsam entwickelte. Erst mit dem Radstadion, das 1978 am Handelskai errichtet wurde, wagte das Sportzentrum den Sprung ans Wasser. Dieses Stadion war ein Rundbau aus Fertigteilen mit einem Durchmesser von 110 Metern, der Platz für bis zu 5500 Besucher bot. Besondere Attraktion war die Radrennbahn mit Steilkurve, aber auch Leichtathletik-Wettkämpfe fanden hier statt. Die Akzeptanz der Halle war in der engeren Radfahrszene durchaus vorhanden, ansonsten aber über die Jahre schwindend, nicht zuletzt wegen unattraktiver räumlicher Bedingungen, die sich auch nach einer ersten Sanierung 1999 nicht wesentlich verbesserten. 20 Jahre später stellte sich die Frage: Soll man neuerlich in den Bestand investieren oder einen Neubau wagen?
Städtebauliche Chance
Inzwischen hatten sich die äußeren Rahmenbedingungen deutlich verändert. Die neue U-Bahnlinie U2 erhielt die Station „Stadion“. Eine Shoppingmall mit 27.000 Quadratmeter Verkaufsflächen und einer Parkgarage für 880 Plätzen eröffnete 2007. Und schließlich wurde das unmittelbar im Osten angrenzende Grundstück zum Standort für einen Fernbus-Terminal erkoren, der unangenehm nahe an das Radstadion heranrücken musste. Die 2020 erfolgte Entscheidung, das Radstadion nicht zu sanieren, sondern als multifunktionale Sportarena mit neuem Programm neu zu errichten, war eine städtebauliche Chance: Wo bisher ein Rundbau mit 110 Meter Durchmesser wie eine unnahbare Festung gewirkt hatte, konnte man plötzlich in stadträumlichen Dimensionen denken.
Den Architekturwettbewerb für die Arena konnte das Büro von Christoph Karl und Andreas Bremhorst (KuB) 2021 für sich entscheiden. Ihr Projekt ist auf den ersten Blick unspektakulär, eine ruhige, horizontal gelagerte Box, die in alle vier Richtungen unterschiedlich reagiert: Nach Nordwesten öffnet sie sich mit einer fast monumentalen Loggia zu einem bestehenden Park mit alten Bäumen, der – wie alle Außenanlagen des Projekts – von Carla Lo gestaltet wurde. Nach Nordosten, also zum Handelskai, liegt ein großzügiger Ladehof, über den die Ver- und Entsorgung der Sportarena läuft.
Im Südosten bildet die Schmalseite der Box das Gegenüber zum Fernbusbahnhof, der hier so knapp an die Arena heranrückt, dass deren Freiflächen de facto Teil des Bahnhofsvorplatzes werden. Hier wurde versucht, einen nahtlosen Übergang zwischen den Freiräumen der beiden Projekte zu schaffen, unter Einbeziehung eines Beirats, der für das Busbahnhofprojekt zur Qualitätssicherung eingerichtet ist. Die vierte, 120 Meter lange südwestliche Front der Sportarena öffnet sich zu einem großen Vorplatz, der nach einem Wettkampf Raum für bis zu 3000 Besucher bieten muss. Auch dieser Vorplatz ist zoniert, wobei die erste Zone ein vor Regen geschützteer Außenraum ist, der durch eine Auskragung des ersten Obergeschoßes über die volle Länge der Sportarena entsteht.
Der Clou des Projekts ist die raffinierte Stapelung mehrerer Sporthallen übereinander: eine Ballsporthalle mit ausfahrbaren Tribünen für 3000 Personen, die das erste Untergeschoß und das Erdgeschoß verbindet; auf demselben Niveau eine Kunstturnhalle mit Besuchergalerie. Darüber liegen ein Bereich für Kraft- und Cardio-Training und eine Abfolge von flexibel nutzbaren Räumen, die bei Wettkämpfen als VIP-Zone fungieren. Die oberste, größte Halle bietet schließlich Platz für die Leichtathletik. Garderoben und Nebenräume sind nach Bedarf im Haus verteilt, ebenso die zahlreichen Möglichkeiten für das Aufwärmen, auch auf den Dachterrassen.
Sanierung hätte Weiterwursteln bedeutet
Die Erschließung der Halle kommt mit nur zwei innen liegenden Treppenhäusern aus und erlaubt es, auch bei Wettkämpfen in der Ballsporthalle den Trainingsbetrieb in den anderen Bereichen aufrechtzuerhalten. Trotz der Tiefe des Baukörpers gibt es auf der Eingangsebene so gut wie überall einen Blick ins Grüne, der durch die Verglasung der Erdgeschoßfassade möglich wird. Je heller, so die Architekten, desto besser. Bei Bedarf – vor allem bei Wettkämpfen, bei denen es auf gleichmäßige Belichtung ankommt – können die Räume aber verdunkelt werden. Dass hier mit großen Spannweiten und enormen statischen Kräften gearbeitet wird, zeigt sich nicht nur in der spektakulären Konstruktion der Leichtathletikhalle. Das Tragsystem ist insgesamt bis ins Detail von einer Klarheit und Präzision, die ihresgleichen suchen. Mit Gesamtkosten von 133 Millionen Euro spielt die Sportarena in einer Liga mit, zu der etwa das Wien Museum gehört. Würden diese beiden städtischen Bauten im architektonischen Zehnkampf gegeneinander antreten, würde die Sportarena zumindest in den Kategorien Logik der Konstruktion, Effizienz der Erschließung und Schönheit der Innenräume um Längen gewinnen.
Dabei widerspricht die Arena in mehrerer Hinsicht aktuellen Trends in der Architektur. Sie ersetzt einen gar nicht so alten Bestand durch einen Neubau ähnlicher Funktion, sie hat keine begrünte Fassade, und sie ist nicht in Holz konstruiert. Die Stadt Wien hat Mut bewiesen, die Interessen der Nutzer ins Zentrum zu rücken und mit diesem Neubau ein Zeichen des Respekts vor den Athleten zu setzen. Eine Sanierung hätte Weiterwursteln bedeutet, eine begrünte Fassade ist in einem Park mit alten Bäumen deplatziert, und eine Hallenkonstruktion aus Holz bei diesen Spannweiten unwirtschaftlich. Vielleicht kann man auch das von dieser Arena lernen: sich vom Zeitgeist nicht indoktrinieren zu lassen.