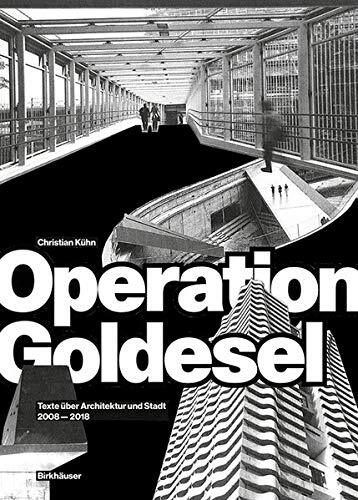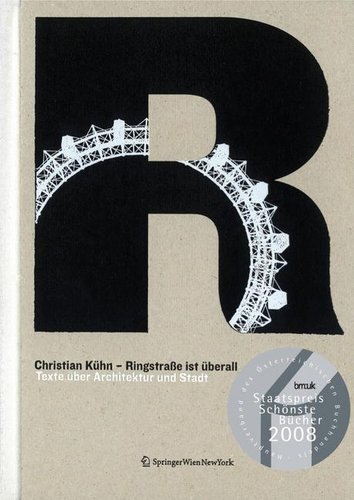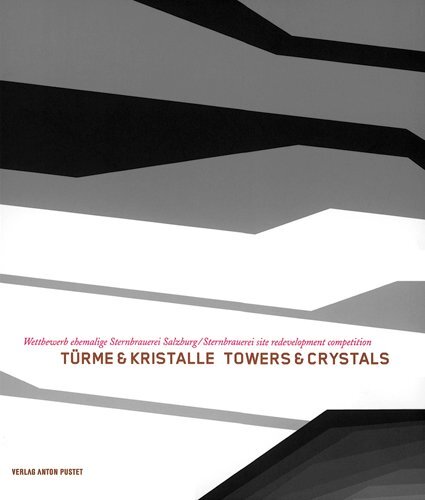Kunst trifft Bau. Au!
Das von Oswald Oberhuber und Margarethe Cufer entworfene Haus an der Ecke Esterházygasse/Linke Wienzeile wurde saniert. Jetzt trägt es Tattoos. Wie konnte es dazu kommen?
Ist Architektur Kunst? An dieser Frage haben sich viele, auch große Geister, die Zähne ausgebissen. In der Geschäftseinteilung des Kulturbetriebs gelten Architekten bestenfalls als „auch Künstler“, zu sehr ist ihre Arbeit von funktionellen, technischen und finanziellen Aspekten beeinflusst und oft genug auf diese reduziert.
Kooperation auf Augenhöhe zwischen den Disziplinen Kunst und Architektur ist daher oft schwierig. Ein berühmtes Beispiel ist das Hundertwasser-Haus. Friedensreich Hundertwasser hatte sich seit den 1950er-Jahren gegen das gewandt, was er unter „Rationalismus in der Architektur“ verstand, unter anderem mit dem „Verschimmelungsmanifest“ aus dem Jahr 1958. Als er in den 1970er-Jahren einen prominenten Platz in der Populärkultur erobert hatte, bot ihm die Stadt Wien an, ein Haus nach seinen Ideen umzusetzen. Hundertwasser war für den ideologischen Überbau („Die gerade Linie ist gottlos“) und fürs Formale zuständig.
Prominente Künstler gestalteten Häuser
Für alles dazwischen, also die Wohnungseinteilung, das Erschließungssystem und die Konstruktion, brauchte es einen Architekten. Diese Rolle übernahm Josef Krawina, der einen terrassierten Baukörper mit Erschließungsturm entwarf, der Hundertwassers Erwartungen entsprach. Als Krawina in der Folge aber versuchte, Einfluss auf die Fassadengestaltung zu nehmen, kam es zum Bruch. Krawina musste aus dem Projekt aussteigen, während Hundertwasser die erste Version einer Architektur realisieren konnte, die sich auch aus 40 Jahren Distanz am besten als Wurstelprater-Architektur charakterisieren lässt, wenn auch als eine höchst einprägsame. Hundertwasser dürfte das selbst nicht viel anders gesehen haben, wenn er die Zuschreibung seines gebauten Werks zum Kitsch und seine eigene Rolle als die eines Behübschers als Ehrentitel bezeichnete. Seine Architektur verführt zum kollektiven Dämmerschlaf einer geschlossenen Gesellschaft, die von den Potenzialen einer offenen nichts mehr hören will.
Das 1985 fertiggestellte Hundertwasserhaus blieb nicht das einzige Projekt im Rahmen des geförderten Wohnbaus, bei dem die Stadt Wien Häuser von prominenten Künstlern gestalten ließ. Arik Brauer durfte Mitte der 1990er-Jahre ein ansonsten eher konventionelles Haus mit gezackten Giebeln und großformatigen Fliesenbildern verzieren. Als Architekt fungierte Peter Pelikan, der schon beim Hundertwasserhaus als Ersatz für Josef Krawina eingesprungen war. Auch wohlmeinende Kritiker konnten in diesem Haus nur einen schwachen Abklatsch des Hundertwasserhauses erkennen, der weit hinter dessen Originalität zurückblieb.
Einen ganz anderen Weg ging der Künstler und langjährige Rektor der Universität für angewandte Kunst Oswald Oberhuber, der im Auftrag des Österreichischen Siedlungswerks (ÖSW) an der Ecke Linke Wienzeile/Esterházygasse für einen Wohnbau die Rolle des „Hauskünstlers“ übernehmen sollte. Als Partnerarchitektin wurde ihm Margarethe Cufer zur Seite gestellt, eine im Umgang mit den Rahmenbedingungen des Wiener Wohnbaus sattelfeste Architektin, die bei Roland Rainer an der Akademie der bildenden Künste diplomiert hatte.
Kein keramischer Zierrat nötig
In einem gemeinsamen Statement sprachen Cufer und Oberhuber von einer neuen Form des Zusammenwirkens von Kunst und Architektur: „Nicht die Dekoration der Fassade eines ansonsten langweiligen Hauses war das Ziel, sondern eine Durchdringung von Kunst und Architektur. Kunst verstanden als eine besondere Sicht der Gesamtproblematik, die in einen Dialog tritt mit der professionellen Kenntnis der Architektur des sozialen Wohnbaus und seiner restriktiven Bedingungen.“ Das Haus sollte vor allem ein zeitgemäßes Stadthaus sein, das als guter Nachbar mit seiner Umgebung im Dialog steht. Dazu braucht es keinen keramischen Zierrat und keine farbenfrohe Malerei auf der Fassade. Cufer und Oberhuber entwickeln eine Lochfassade mit Fenstern, die wie zufällig verteilt wirken. Sie sind unterschiedlich groß und auch im Detail vielfältig gestaltet, mit diversen Fensterteilungen und Brüstungen. Diese lockere Verteilung als Kontrast zur klassizistischen Ordnung in der Nachbarschaft war Oberhuber ein besonderes Anliegen. Cufer brachte die Idee dann in Einklang mit den funktionellen Anforderungen im Grundriss.
Den oberen Abschluss des Hauses bildet ein weit auskragendes Gesimse, mit dem sich das Haus klar als Produkt der architektonischen Postmoderne deklariert. Außergewöhnlich ist die Ecklösung, die in den obersten beiden Geschoßen zwei symmetrische Erker aus der Fassade herausstechen lässt, über denen das Gesimse eine Art Mittelscheitel ausbildet. Zum Ausgleich für so viel Symmetrie dürfen die Fenster im Feld unter den Erkern verrückt spielen. Als oberer Abschluss dient ein kreisrundes Stahlgerüst, das turmartig über der Gesimskante aufragt. Funktion hat es – wie die Dachaufbauten der Gründerzeit, die ja eine eigene Landschaft über den Dächern der Stadt darstellten – keine. Als vertikale Geste am richtigen Ort ist es trotzdem alles andere als überflüssig.
Den Alltag der Passanten bereichern
Das Haus gehört zu den besten Beispielen einer intelligenten und humorvollen Postmoderne, für die in Österreich etwa das Werk von Heinz Tesar, ebenfalls Schüler von Roland Rainer, und manche Projekte von Hermann Czech stehen. Busladungen von Touristen wird diese Architektur wohl nie anziehen, aber sie bereichert – als kurze Synkope im gleichförmigen Rhythmus der Großstadt – den Alltag der Passanten.
Als im vergangenen Jahr ein Baugerüst vor dem Haus hochgezogen wurde, durfte man hoffen, dass die ergraute Fassade saniert und die verfärbten Paneele in den beiden Erkern ausgetauscht würden. Groß war die Überraschung, als sich die Fassade nach Entfernung des Gerüsts als tätowiert präsentierte. Die Tätowierung stammt von der Künstlerin Luisa Kasalicky und wurde vom ÖSW in Kooperation mit dem KÖR (Kunst im öffentlichen Raum Wien) beauftragt. Die beiden zu Mustern arrangierten Bildmotive, die Kasalicky bereits in anderen Arbeiten verwendet hat, sind von Kreuzrippengewölben abgeleitet, daher der Titel „Vektorgotik“.
Was diese Muster an diesem Haus und in dieser gotikfreien Gegend zu suchen haben, bleibt ein Rätsel. Sicher ist, dass die Fassade durch diese künstlerische Intervention schwer beeinträchtigt ist. Dass von den zahlreichen Beteiligten, vom ÖSW über das KÖR bis zur MA 19, der Magistratsabteilung für Architektur und Stadtgestaltung, niemand das Gespräch mit Margarethe Cufer gesucht oder nach Vorliegen des künstlerischen Entwurfs die Notbremse gezogen hat, ist kein gutes Zeichen für die Baukultur in dieser Stadt.