Artikel
Viel Gold, nackte Frauen und eine Standuhr mit Hakenkreuz – Diktatoren von Hitler bis Saddam Hussein zelebrierten als Bauherren ihren schlechten Geschmack. Bashar al-Asad eiferte ihnen nach
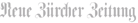
Wer sich nicht mit Bauvorschriften, Ausnützungsziffern und Hypotheken herumschlagen muss, kann kühne Träume verwirklichen. Doch Einblicke in die Paläste von Gewaltherrschern zeigen, dass das meist schiefgeht.
12. Dezember 2024 - Lucien Scherrer
Im Innenhof schiesst ein Mann Gewehrsalven in die Luft, drinnen im Palast drängen sich Familien durch Gänge und Hallen, einige tragen Teller weg und lachen. Ein bärtiger Islamist posiert hinter einem mächtigen Pult, flankiert von einem Papierdrucker und zwei goldenen, aber doch billig wirkenden Stehlampen. In einem Wohnzimmer lässt sich ein junger Mann mit Krücken auf einem beigen Sofa nieder, auf einer Ablage hinter ihm ist eine Art Vase zu sehen, vielleicht aus Porzellan, violett und in Form einer deformierten Pfeife oder eines Muschelhorns. Vor ihm steht einer jener Glastische, die auch Kokser lieben.
Die Bilder und die verwackelten Videos, die nach der Flucht des syrischen Gewaltherrschers Bashar al-Asad um die Welt gegangen sind, offenbaren eine banale Einsicht: Diktatoren sind Menschen, und die haben oft einen zweifelhaften Geschmack. Bashar al-Asad und seine Frau Asma scheinen jene schweren Möbel gemocht zu haben, die man auch in Hotellobbys antrifft, dazu rote Teppiche, auf Hochglanz polierten Marmor, Goldimitationen und schnelle Autos: Mercedes, Ferrari, Aston Martin und Lamborghini.
Saddam Husseins Riesenvogel in Marmor
Rund eine Milliarde Dollar soll das asadsche Anwesen in Damaskus gekostet haben. Das Hauptgebäude nimmt mehr Platz ein als vier Fussballfelder. Wer hier zu Gast war, sollte eingeschüchtert und beeindruckt werden. Natürlich wecken die Bilder aus dem Palast voyeuristische Instinkte. Wie haben die Asads wohl gelebt? Hat er ihr Abends auf dem beigen Sofa erzählt, wen er als Nächstes verhaften lasse? Ist er mit seinem Ferrari F50 nachts durch die Stadt gefahren, mit knallenden Auspuffrohren? Oder hat er sich nur ans Steuer gesetzt und davon geträumt?
Der Hotel-Look, den die Asads in ihrem Palast imitierten, ist jedenfalls typisch für Diktatoren. Das zumindest schreibt der britische Stilkritiker Peter York in seinem Buch «Zu Besuch bei Diktatoren». Gerade absoluten Herrschern der Moderne seien die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem nicht bewusst. Sie imitierten noblen Stil, wie Pornoproduzenten und andere Aufsteiger. Obwohl sie sich nicht um Ausnützungsziffern, Waldabstände, prozessierende Nachbarn und Geld kümmern müssen, ist das Resultat laut York meist bizarr: «Die Häuser der Diktatoren zeigen uns, was passiert, wenn Menschen ohne jedes Mass ihre Phantasien ausleben können.»
Häufig aus guten Gründen paranoid, wechseln Diktatoren Paläste und Wohnungen wie andere Leute die Kleider. Allein Saddam Hussein soll rund 65 Residenzen besessen haben. Wechselte er die Unterkunft, liess er mehrere Wagenkolonnen und Doppelgänger losfahren, die alle dasselbe Abendessen einnahmen, jedoch an einem anderen Ort. Der 2003 gestürzte irakische Diktator – man fand ihn, bärtig und verwahrlost, in einem Erdloch – war nicht nur berüchtigt für seine Grausamkeit, sondern auch für seinen Geschmack.
In einem seiner Paläste in Bagdad gab es einen Saal, über dessen Eingangstüre ein rund vier Meter hoher und zehn Meter breiter Falke (oder sollte es ein Adler sein?) thronte. Geformt war der Riesenvogel aus braunem und grauem italienischem Marmor, die Krallen auf dem Boden ruhend. In Basra stand dem Diktator ein Bad mit fünf Lavabos zur Verfügung, die Hähnen in Gold, dazu fünf Spiegel mit Goldrahmen. Die allgemeine Anmutung des Raums: mehr schmuddelig als edel. Was Kunst betrifft, pflegte der «Löwe von Babylon» eine Vorliebe für Bilder im New-Age- und Fantasy-Stil. Sie zeigten nackte Frauen, die den Busen vorrecken, von Drachen attackiert oder von Schlangen und muskulösen Schwertmännern mit blonder Trump-Mähne umringt werden.
Allein Saddams Inneneinrichtung, so schreibt Peter York, habe die Invasion der Alliierten in den Irak gerechtfertigt. Wie sein Nachbar Asad hortete der irakische Präsident Autos. Unter anderem besass er einen rosafarbenen Chevy Bel Air aus den 1950er Jahren, der im Krieg von einem Panzer zermalmt wurde. Die Wagensammlung seines Sohnes Udai liess Saddam eines Tages in Brand setzen: Er war wütend, weil Udai einen Nachbarn getötet hatte. Nicht, dass das verboten gewesen wäre. Aber Saddam mochte den Getöteten.
Saddam Hussein, ein ehemaliger Verbündeter der USA gegen den Kommunismus, wuchs in archaischen Klan-Verhältnissen auf, seine Hand zierte ein billiges Tattoo. Die Asad-Dynastie dagegen stammte aus besseren Verhältnissen. Sie gehörte zu jenen sozialistischen Gewaltherrschern, die mit der Sowjetunion verbündet waren und ihr Volk im Namen des Fortschritts und der Gerechtigkeit ausbeuteten. Zuletzt finanzierten sie ihren Lebensstil mit dem Verkauf der Droge Captagon und der Unterschlagung von Hilfsgütern.
Ceausescus lila Lavabo und Hitlers Korbstühle
Zu diesem progressiven und meist kleptokratischen Diktatorenklub gehörten Josip Broz Tito, Fidel Castro, der rumänische «Conducator» Nicolae Ceausescu und die nordkoreanische Kim-Dynastie. Diese herrscht derzeit in dritter Generation und pflegt den vielleicht klotzigsten Stil in der internationalen Diktatorengilde.
Kim Jong Il, der Vater des gegenwärtigen Diktators Kim Jong Un, liebte Mercedes, Filme und Frauen, die er kidnappen liess. Gemäss Aussagen seines japanischen Kochs soll er in seinem Hauptsitz in Pjongjang einen unterirdischen Bunker besessen haben, inklusive Weinkeller mit etwa 10 000 Flaschen und Karaoke-Bar. In einem anderen Palast hatte er ein bombensicheres olympisches Schwimmbecken, mit goldenen Fliesen auf dem Grund, die sein Ebenbild zeigten.
Ob die Fliesen mittlerweile das Porträt des aktuellen «Führers» Kim Jong Un (Markenzeichen: Bürstenschnitt und Mittelscheitel) nachbilden sollen, ist unbekannt. Sicher ist, dass Kim Jong Uns Grossvater Kim Il Sung bis heute als «ewiger» Präsident Nordkoreas fungiert, obwohl er 1994 verstorben ist. Zu Lebzeiten sollen sich die Berge vor ihm verneigt haben, sein Tod hat laut der staatlichen Propaganda selbst Vögel in Trauer versetzt. Zu seinem neoklassizistischen Mausoleum führt eine sechsspurige Strasse.
Der Bauernsohn Nicolae Ceausescu war vom Prunk seiner nordkoreanischen Genossen derart beeindruckt, dass er sich in Bukarest das zweitgrösste Gebäude der Welt (nach dem Pentagon) bauen liess. Dafür benötigte er unter anderem eine Million Kubikmeter Marmor. Als guter Kommunist nannte er es «Palast des Volkes». Bilder in Peter Yorks Buch zeigen Räume voller Pelzmäntel und Uhren, ein Schwimmbad und mehrere Badezimmer mit seltsamen Schläuchen und Armaturen. Die Lavabos sind lila und rosa wie bei Barbie zu Hause, die Wasserspender golden. Alles «einnehmend hässlich», wie York schreibt. Die zahlreichen Badezimmer führt er auf die Hypochondrie von Ceausescu und dessen Gattin Elena zurück.
Diese ging so weit, dass sich die beiden stets die Hände desinfizierten und ihr Essen vorkosten liessen, selbst bei einem Besuch bei der Queen, die darüber gar nicht amused war. Den Wunsch, mit gigantischen Bauwerken in Erinnerung zu bleiben, hegen die meisten Diktatoren, egal welcher Ideologie. Adolf Hitler, der in Berlin eine geschlossene Halle für 200 000 Volksgenossen plante – in der sich aufgrund von Ausdünstungen womöglich Regenwolken an der Decke gebildet hätten –, mochte es privat traditionell. Das Mobiliar in seinem Berghof in Berchtesgaden soll er selbst ausgesucht haben, darunter Korbstühle, Topfpflanzen, Nippesfiguren und eine Standuhr, auf der ein Adler mit Hakenkreuz thronte.
In einem Zimmer stand tatsächlich eine jener Weltkugeln, mit denen Charlie Chaplin im Film «Der grosse Diktator» jongliert. «Macht ist lächerlich. Und absolute Macht ist absolut lächerlich», schrieb eine englische Zeitung zum Buch von Peter York. Das zeigten gerade die Häuser und Paläste der Mächtigen. Wie die Jahrzehnte alte Herrschaft der Asads zeigt, bleibt diese Erkenntnis jedoch meist allzu lange folgenlos.
Die Bilder und die verwackelten Videos, die nach der Flucht des syrischen Gewaltherrschers Bashar al-Asad um die Welt gegangen sind, offenbaren eine banale Einsicht: Diktatoren sind Menschen, und die haben oft einen zweifelhaften Geschmack. Bashar al-Asad und seine Frau Asma scheinen jene schweren Möbel gemocht zu haben, die man auch in Hotellobbys antrifft, dazu rote Teppiche, auf Hochglanz polierten Marmor, Goldimitationen und schnelle Autos: Mercedes, Ferrari, Aston Martin und Lamborghini.
Saddam Husseins Riesenvogel in Marmor
Rund eine Milliarde Dollar soll das asadsche Anwesen in Damaskus gekostet haben. Das Hauptgebäude nimmt mehr Platz ein als vier Fussballfelder. Wer hier zu Gast war, sollte eingeschüchtert und beeindruckt werden. Natürlich wecken die Bilder aus dem Palast voyeuristische Instinkte. Wie haben die Asads wohl gelebt? Hat er ihr Abends auf dem beigen Sofa erzählt, wen er als Nächstes verhaften lasse? Ist er mit seinem Ferrari F50 nachts durch die Stadt gefahren, mit knallenden Auspuffrohren? Oder hat er sich nur ans Steuer gesetzt und davon geträumt?
Der Hotel-Look, den die Asads in ihrem Palast imitierten, ist jedenfalls typisch für Diktatoren. Das zumindest schreibt der britische Stilkritiker Peter York in seinem Buch «Zu Besuch bei Diktatoren». Gerade absoluten Herrschern der Moderne seien die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem nicht bewusst. Sie imitierten noblen Stil, wie Pornoproduzenten und andere Aufsteiger. Obwohl sie sich nicht um Ausnützungsziffern, Waldabstände, prozessierende Nachbarn und Geld kümmern müssen, ist das Resultat laut York meist bizarr: «Die Häuser der Diktatoren zeigen uns, was passiert, wenn Menschen ohne jedes Mass ihre Phantasien ausleben können.»
Häufig aus guten Gründen paranoid, wechseln Diktatoren Paläste und Wohnungen wie andere Leute die Kleider. Allein Saddam Hussein soll rund 65 Residenzen besessen haben. Wechselte er die Unterkunft, liess er mehrere Wagenkolonnen und Doppelgänger losfahren, die alle dasselbe Abendessen einnahmen, jedoch an einem anderen Ort. Der 2003 gestürzte irakische Diktator – man fand ihn, bärtig und verwahrlost, in einem Erdloch – war nicht nur berüchtigt für seine Grausamkeit, sondern auch für seinen Geschmack.
In einem seiner Paläste in Bagdad gab es einen Saal, über dessen Eingangstüre ein rund vier Meter hoher und zehn Meter breiter Falke (oder sollte es ein Adler sein?) thronte. Geformt war der Riesenvogel aus braunem und grauem italienischem Marmor, die Krallen auf dem Boden ruhend. In Basra stand dem Diktator ein Bad mit fünf Lavabos zur Verfügung, die Hähnen in Gold, dazu fünf Spiegel mit Goldrahmen. Die allgemeine Anmutung des Raums: mehr schmuddelig als edel. Was Kunst betrifft, pflegte der «Löwe von Babylon» eine Vorliebe für Bilder im New-Age- und Fantasy-Stil. Sie zeigten nackte Frauen, die den Busen vorrecken, von Drachen attackiert oder von Schlangen und muskulösen Schwertmännern mit blonder Trump-Mähne umringt werden.
Allein Saddams Inneneinrichtung, so schreibt Peter York, habe die Invasion der Alliierten in den Irak gerechtfertigt. Wie sein Nachbar Asad hortete der irakische Präsident Autos. Unter anderem besass er einen rosafarbenen Chevy Bel Air aus den 1950er Jahren, der im Krieg von einem Panzer zermalmt wurde. Die Wagensammlung seines Sohnes Udai liess Saddam eines Tages in Brand setzen: Er war wütend, weil Udai einen Nachbarn getötet hatte. Nicht, dass das verboten gewesen wäre. Aber Saddam mochte den Getöteten.
Saddam Hussein, ein ehemaliger Verbündeter der USA gegen den Kommunismus, wuchs in archaischen Klan-Verhältnissen auf, seine Hand zierte ein billiges Tattoo. Die Asad-Dynastie dagegen stammte aus besseren Verhältnissen. Sie gehörte zu jenen sozialistischen Gewaltherrschern, die mit der Sowjetunion verbündet waren und ihr Volk im Namen des Fortschritts und der Gerechtigkeit ausbeuteten. Zuletzt finanzierten sie ihren Lebensstil mit dem Verkauf der Droge Captagon und der Unterschlagung von Hilfsgütern.
Ceausescus lila Lavabo und Hitlers Korbstühle
Zu diesem progressiven und meist kleptokratischen Diktatorenklub gehörten Josip Broz Tito, Fidel Castro, der rumänische «Conducator» Nicolae Ceausescu und die nordkoreanische Kim-Dynastie. Diese herrscht derzeit in dritter Generation und pflegt den vielleicht klotzigsten Stil in der internationalen Diktatorengilde.
Kim Jong Il, der Vater des gegenwärtigen Diktators Kim Jong Un, liebte Mercedes, Filme und Frauen, die er kidnappen liess. Gemäss Aussagen seines japanischen Kochs soll er in seinem Hauptsitz in Pjongjang einen unterirdischen Bunker besessen haben, inklusive Weinkeller mit etwa 10 000 Flaschen und Karaoke-Bar. In einem anderen Palast hatte er ein bombensicheres olympisches Schwimmbecken, mit goldenen Fliesen auf dem Grund, die sein Ebenbild zeigten.
Ob die Fliesen mittlerweile das Porträt des aktuellen «Führers» Kim Jong Un (Markenzeichen: Bürstenschnitt und Mittelscheitel) nachbilden sollen, ist unbekannt. Sicher ist, dass Kim Jong Uns Grossvater Kim Il Sung bis heute als «ewiger» Präsident Nordkoreas fungiert, obwohl er 1994 verstorben ist. Zu Lebzeiten sollen sich die Berge vor ihm verneigt haben, sein Tod hat laut der staatlichen Propaganda selbst Vögel in Trauer versetzt. Zu seinem neoklassizistischen Mausoleum führt eine sechsspurige Strasse.
Der Bauernsohn Nicolae Ceausescu war vom Prunk seiner nordkoreanischen Genossen derart beeindruckt, dass er sich in Bukarest das zweitgrösste Gebäude der Welt (nach dem Pentagon) bauen liess. Dafür benötigte er unter anderem eine Million Kubikmeter Marmor. Als guter Kommunist nannte er es «Palast des Volkes». Bilder in Peter Yorks Buch zeigen Räume voller Pelzmäntel und Uhren, ein Schwimmbad und mehrere Badezimmer mit seltsamen Schläuchen und Armaturen. Die Lavabos sind lila und rosa wie bei Barbie zu Hause, die Wasserspender golden. Alles «einnehmend hässlich», wie York schreibt. Die zahlreichen Badezimmer führt er auf die Hypochondrie von Ceausescu und dessen Gattin Elena zurück.
Diese ging so weit, dass sich die beiden stets die Hände desinfizierten und ihr Essen vorkosten liessen, selbst bei einem Besuch bei der Queen, die darüber gar nicht amused war. Den Wunsch, mit gigantischen Bauwerken in Erinnerung zu bleiben, hegen die meisten Diktatoren, egal welcher Ideologie. Adolf Hitler, der in Berlin eine geschlossene Halle für 200 000 Volksgenossen plante – in der sich aufgrund von Ausdünstungen womöglich Regenwolken an der Decke gebildet hätten –, mochte es privat traditionell. Das Mobiliar in seinem Berghof in Berchtesgaden soll er selbst ausgesucht haben, darunter Korbstühle, Topfpflanzen, Nippesfiguren und eine Standuhr, auf der ein Adler mit Hakenkreuz thronte.
In einem Zimmer stand tatsächlich eine jener Weltkugeln, mit denen Charlie Chaplin im Film «Der grosse Diktator» jongliert. «Macht ist lächerlich. Und absolute Macht ist absolut lächerlich», schrieb eine englische Zeitung zum Buch von Peter York. Das zeigten gerade die Häuser und Paläste der Mächtigen. Wie die Jahrzehnte alte Herrschaft der Asads zeigt, bleibt diese Erkenntnis jedoch meist allzu lange folgenlos.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom





