Artikel
Und plötzlich riecht es nach feuchtem Pulver
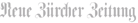
Die Eröffnung des Museums für Neue Kunst in Karlsruhe
Selten werden einem Metaphern so sehr aufgedrängt wie derzeit in Karlsruhe. Hier hat kürzlich das Museum für Neue Kunst seine Tore geöffnet, und zwar am nördlichen Ende eines mehr als dreihundert Meter langen Baus, der einst als Munitionsfabrik diente und heute nebst der Städtischen Galerie Karlsruhe und der Hochschule für Gestaltung das Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) beherbergt, dem auch das neue Museum organisatorisch zugehört.
28. Dezember 1999 - Samuel Herzog
Die Architektur dieser Fabrik zeichnet sich vor allem durch das weitgehende Fehlen von Wänden aus: Die Konstruktion über Pfeilern und die fast vollständige Durchfensterung der Fassaden sollten den Bau im Falle einer versehentlichen Explosion vor einem Kollaps bewahren - der Druck sollte lediglich die Glasscheiben bersten lassen. Angesichts einer solchen Anlage liegt es natürlich nahe, das neue Museum auf seine Sprengkraft hin zu prüfen - zumal die benachbarten Labors und das Medienmuseum des ZKM im Bereich der Forschung zwischen Kunst und neuen Technologien einigen Zündstoff bieten. Und so ist man denn im ersten Moment auch versucht, die Explosionsmetaphorik gnadenlos auszureizen und im Zusammenhang mit dem neuen Museum von einer «schwierigen Zündung» zu reden oder, treffender wohl, das Fehlen einer «Lunte» zu konstatieren.
Problem «Sammlermuseum»
Als das ZKM vor gut zwei Jahren eröffnet wurde, nahmen nicht nur das Medienmuseum und die diversen Labors ihren Betrieb offiziell auf, sondern für kurze Zeit auch ein Museum für Neue Kunst. Dieses wurde zunächst essentiell aus den Beständen jener Sammlung alimentiert, die der kürzlich verstorbene Heinrich Klotz als Gründer und erster Direktor des ZKM zusammengetragen hatte. Dass die mit einem Budget von wenig mehr als zehn Millionen angekauften Werke vorwiegend aus dem Bereich der Medienkunst jedoch nicht ausreichen würden, um einen regelmässigen Betrieb des Instituts zu garantieren, war von Anfang an klar. Also war bald von einem «Sammlermuseum» die Rede, welches, so schrieb Klotz, «die grossen privaten Kunstsammlungen im Lande der Öffentlichkeit zugänglich machen» sollte. In der Euphorie, welche die Gründung des ZKM weit über die Grenzen von Karlsruhe hinaus auslöste, war zu hören, dass mitunter renommierte Sammlungen wie die des italienischen Grafen Panza di Buomo oder jene von Frieder Burda dem Museum zur Verfügung stehen würden. Nun aber baut Burda ein eigenes Museum in Baden-Baden, und der Name Panza di Buomo ist wie das Schäumchen auf dem Espresso mit der Zeit aus dem Gerede verschwunden.
Die Sammler, die dem Museum nun bei seiner Wiedereröffnung noch hold sind, stammen aus Baden-Württemberg und heissen Rentschler, Weisshaupt oder Grässlin. Für die Eröffnungsausstellung immerhin standen dem Museum aber auch einige Werke aus den Sammlungen Froehlich und Burda zur Verfügung - und im Falle von Burda etwa sei auch weiterhin mit gelegentlichen Leihgaben zu rechnen, versichert Kurator Ralph Melcher, zumal dessen Museum nur von bescheidener Grösse sein werde.
Dass sich dieses Museum für Neue Kunst nun nicht mit den Glanzstücken weltweit bekannter Sammlungen schmücken kann, ist nicht eigentlich das Problem. Die Schwierigkeit der neuen Institution liegt vielmehr darin, dass es ihr an einer erkennbaren Haltung sowohl gegenüber den Sammlungen als auch - innerhalb des Hauses - gegenüber den Aktivitäten der Labors und des Medienmuseums fehlt. In seiner Eröffnungsausstellung jedenfalls präsentiert sich das Museum für Neue Kunst weniger als ein Haus, das über Werke aus Sammlungen verfügt und mit ihnen arbeitet, sondern eher als ein Museum im Dienste der Sammler.
Wer das Museum betritt, nimmt auf einen Blick den Grossteil der Anlage wahr, denn die rund siebentausend Quadratmeter Ausstellungsfläche sind auf drei luftigen Etagen rund um zwei Lichthöfe verteilt. Die erwähnte Offenheit der Architektur machte den Einbau von zahlreichen beweglichen Stellwänden nötig. Und auf diesen Wänden nun breiten sich - einem Kunstkalender ähnlich - die ganzen prachtvollen Namen der amerikanischen und der europäischen Kunst seit dem Zweiten Weltkrieg aus - lose gruppiert nach Sammlungen.
Pop-art und Farbfeldmalerei bilden die Schwerpunkte der Sammlung Siegfried Weishaupt: Da gibt es etwa Andy Warhols «Last supper» mit dem multiplen Jesus nach Leonardo zu sehen, und rund um drei pulsierende Quadrate von Josef Albers sind die fliessenden Farbfelder von Kenneth Noland, Mark Rothko oder Morris Louis gruppiert. Ähnliche Tendenzen weist die Sammlung Froehlich auf, erweitert etwa durch gewichtige Stücke von Bruce Naumann, die zu einem kleinen Schwerpunkt zusammengestellt sind. Frieder Burda hat Bilder der neuen deutschen Klassiker Sigmar Polke und Gerhard Richter beigesteuert, und in der Sammlung Friedrich E. Rentschler wird der Bogen von Frank Stellas «Shaped Canvases» über Minimal-Künstler wie Sol Le Witt und Donald Judd, die reduzierte Malerei von Daniel Buren und Niele Toroni bis zu den Konzepten von Giulio Paolini oder einer Plastik von Jeff Koons geschlagen. Die jüngsten Werke schliesslich stammen aus der Sammlung Grässlin: Bilder und Objekte von Martin Kippenberger, ein Porträt aus Blumenvasen der Sammlerfamilie von Tobias Rehberger, Installationen von Georg Herold, Objekte von Asta Gröting oder «The sick soul II» von Clegg & Guttmann.
Keine Überraschungen
All dies ist von stabiler Qualität und wird auch durchaus so präsentiert, dass der Gang durch die Ausstellung ein kaum beschwertes Vergnügen ist. Die Enttäuschung stellt sich eigentlich erst beim Verlassen des Museums ein, wenn man feststellt, dass man kaum Unbekanntes, nichts Überraschendes gesehen hat - und von der Kaufkraft der reichen Sammler mehr beeindruckt ist als vom Konzept der Ausstellung oder von einer originellen Auseinandersetzung mit den Exponaten.
Man mag es verstehen, dass Götz Adriani, der Leiter des neuen Museums, keinen «chronologischen Gänsemarsch der Stile» inszenieren wollte, der «die Erfahrung des Werks einer geschichts- philosophischen Konstruktion opfert». Man glaubt ihm auch gerne, wenn er schreibt, dass es ihm «im Sinne von Michel Foucaults Reaktion auf Linné nicht so sehr um System und Methode, sondern um eine Struktur, ein tableau» gehe. Was man hingegen nur schwer begreift, ist der Um- stand, dass dieses Tableau so konventionell sein muss und so sehr den Sammler und seinen Geschmack in den Vordergrund setzt - selbst wenn Adriani versichert, dass der Betrachter so «in letzter Konsequenz» nicht nur etwas über «die Zeit, in der er lebt, und ihre Kunst» erfährt, sondern «auch etwas über sich selbst».
Gerade die Nähe zu den ungestümen Versuchen in den benachbarten Labors des ZKM hätte doch auch in diesem neuen Museum dem Geist des Experiments mehr Platz verschaffen müssen: Eine Neubewertung des Gezeigten durch die Konfrontation mit Werken der jüngsten Zeit wäre ebenso denkbar gewesen wie ein Versuch, die Stellung dieser Klassiker etwa gegenüber der Medienkunst zu untersuchen. Doch die Abgrenzung des neuen Museums zu den benachbarten Experimenten ist schon architektonisch nicht zu übersehen: Dort, wo Klotz einst einen durch die ganze Fabrik verlaufenden Weg geplant hatte, erhebt sich jetzt eine dicke weisse Mauer. Der Ruf des ZKM als einer Institution, die sich ohne Angst vor ungesicherten Positionen dem Experiment verschrieben hat, passt gut zum Bild der Munitionsfabrik. Mit dem neuen Museum jedoch riecht es auch in diesem Haus ohne Wände nun plötzlich nach feuchtem Pulver.
[ Museum für Neue Kunst im Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Eröffnungsausstellung bis 26. März 2000. Katalogbuch «Die Kunst zu sammeln» DM 49.-, Katalog «Bruce Naumann» DM 39.-. ]
Problem «Sammlermuseum»
Als das ZKM vor gut zwei Jahren eröffnet wurde, nahmen nicht nur das Medienmuseum und die diversen Labors ihren Betrieb offiziell auf, sondern für kurze Zeit auch ein Museum für Neue Kunst. Dieses wurde zunächst essentiell aus den Beständen jener Sammlung alimentiert, die der kürzlich verstorbene Heinrich Klotz als Gründer und erster Direktor des ZKM zusammengetragen hatte. Dass die mit einem Budget von wenig mehr als zehn Millionen angekauften Werke vorwiegend aus dem Bereich der Medienkunst jedoch nicht ausreichen würden, um einen regelmässigen Betrieb des Instituts zu garantieren, war von Anfang an klar. Also war bald von einem «Sammlermuseum» die Rede, welches, so schrieb Klotz, «die grossen privaten Kunstsammlungen im Lande der Öffentlichkeit zugänglich machen» sollte. In der Euphorie, welche die Gründung des ZKM weit über die Grenzen von Karlsruhe hinaus auslöste, war zu hören, dass mitunter renommierte Sammlungen wie die des italienischen Grafen Panza di Buomo oder jene von Frieder Burda dem Museum zur Verfügung stehen würden. Nun aber baut Burda ein eigenes Museum in Baden-Baden, und der Name Panza di Buomo ist wie das Schäumchen auf dem Espresso mit der Zeit aus dem Gerede verschwunden.
Die Sammler, die dem Museum nun bei seiner Wiedereröffnung noch hold sind, stammen aus Baden-Württemberg und heissen Rentschler, Weisshaupt oder Grässlin. Für die Eröffnungsausstellung immerhin standen dem Museum aber auch einige Werke aus den Sammlungen Froehlich und Burda zur Verfügung - und im Falle von Burda etwa sei auch weiterhin mit gelegentlichen Leihgaben zu rechnen, versichert Kurator Ralph Melcher, zumal dessen Museum nur von bescheidener Grösse sein werde.
Dass sich dieses Museum für Neue Kunst nun nicht mit den Glanzstücken weltweit bekannter Sammlungen schmücken kann, ist nicht eigentlich das Problem. Die Schwierigkeit der neuen Institution liegt vielmehr darin, dass es ihr an einer erkennbaren Haltung sowohl gegenüber den Sammlungen als auch - innerhalb des Hauses - gegenüber den Aktivitäten der Labors und des Medienmuseums fehlt. In seiner Eröffnungsausstellung jedenfalls präsentiert sich das Museum für Neue Kunst weniger als ein Haus, das über Werke aus Sammlungen verfügt und mit ihnen arbeitet, sondern eher als ein Museum im Dienste der Sammler.
Wer das Museum betritt, nimmt auf einen Blick den Grossteil der Anlage wahr, denn die rund siebentausend Quadratmeter Ausstellungsfläche sind auf drei luftigen Etagen rund um zwei Lichthöfe verteilt. Die erwähnte Offenheit der Architektur machte den Einbau von zahlreichen beweglichen Stellwänden nötig. Und auf diesen Wänden nun breiten sich - einem Kunstkalender ähnlich - die ganzen prachtvollen Namen der amerikanischen und der europäischen Kunst seit dem Zweiten Weltkrieg aus - lose gruppiert nach Sammlungen.
Pop-art und Farbfeldmalerei bilden die Schwerpunkte der Sammlung Siegfried Weishaupt: Da gibt es etwa Andy Warhols «Last supper» mit dem multiplen Jesus nach Leonardo zu sehen, und rund um drei pulsierende Quadrate von Josef Albers sind die fliessenden Farbfelder von Kenneth Noland, Mark Rothko oder Morris Louis gruppiert. Ähnliche Tendenzen weist die Sammlung Froehlich auf, erweitert etwa durch gewichtige Stücke von Bruce Naumann, die zu einem kleinen Schwerpunkt zusammengestellt sind. Frieder Burda hat Bilder der neuen deutschen Klassiker Sigmar Polke und Gerhard Richter beigesteuert, und in der Sammlung Friedrich E. Rentschler wird der Bogen von Frank Stellas «Shaped Canvases» über Minimal-Künstler wie Sol Le Witt und Donald Judd, die reduzierte Malerei von Daniel Buren und Niele Toroni bis zu den Konzepten von Giulio Paolini oder einer Plastik von Jeff Koons geschlagen. Die jüngsten Werke schliesslich stammen aus der Sammlung Grässlin: Bilder und Objekte von Martin Kippenberger, ein Porträt aus Blumenvasen der Sammlerfamilie von Tobias Rehberger, Installationen von Georg Herold, Objekte von Asta Gröting oder «The sick soul II» von Clegg & Guttmann.
Keine Überraschungen
All dies ist von stabiler Qualität und wird auch durchaus so präsentiert, dass der Gang durch die Ausstellung ein kaum beschwertes Vergnügen ist. Die Enttäuschung stellt sich eigentlich erst beim Verlassen des Museums ein, wenn man feststellt, dass man kaum Unbekanntes, nichts Überraschendes gesehen hat - und von der Kaufkraft der reichen Sammler mehr beeindruckt ist als vom Konzept der Ausstellung oder von einer originellen Auseinandersetzung mit den Exponaten.
Man mag es verstehen, dass Götz Adriani, der Leiter des neuen Museums, keinen «chronologischen Gänsemarsch der Stile» inszenieren wollte, der «die Erfahrung des Werks einer geschichts- philosophischen Konstruktion opfert». Man glaubt ihm auch gerne, wenn er schreibt, dass es ihm «im Sinne von Michel Foucaults Reaktion auf Linné nicht so sehr um System und Methode, sondern um eine Struktur, ein tableau» gehe. Was man hingegen nur schwer begreift, ist der Um- stand, dass dieses Tableau so konventionell sein muss und so sehr den Sammler und seinen Geschmack in den Vordergrund setzt - selbst wenn Adriani versichert, dass der Betrachter so «in letzter Konsequenz» nicht nur etwas über «die Zeit, in der er lebt, und ihre Kunst» erfährt, sondern «auch etwas über sich selbst».
Gerade die Nähe zu den ungestümen Versuchen in den benachbarten Labors des ZKM hätte doch auch in diesem neuen Museum dem Geist des Experiments mehr Platz verschaffen müssen: Eine Neubewertung des Gezeigten durch die Konfrontation mit Werken der jüngsten Zeit wäre ebenso denkbar gewesen wie ein Versuch, die Stellung dieser Klassiker etwa gegenüber der Medienkunst zu untersuchen. Doch die Abgrenzung des neuen Museums zu den benachbarten Experimenten ist schon architektonisch nicht zu übersehen: Dort, wo Klotz einst einen durch die ganze Fabrik verlaufenden Weg geplant hatte, erhebt sich jetzt eine dicke weisse Mauer. Der Ruf des ZKM als einer Institution, die sich ohne Angst vor ungesicherten Positionen dem Experiment verschrieben hat, passt gut zum Bild der Munitionsfabrik. Mit dem neuen Museum jedoch riecht es auch in diesem Haus ohne Wände nun plötzlich nach feuchtem Pulver.
[ Museum für Neue Kunst im Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Eröffnungsausstellung bis 26. März 2000. Katalogbuch «Die Kunst zu sammeln» DM 49.-, Katalog «Bruce Naumann» DM 39.-. ]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom





