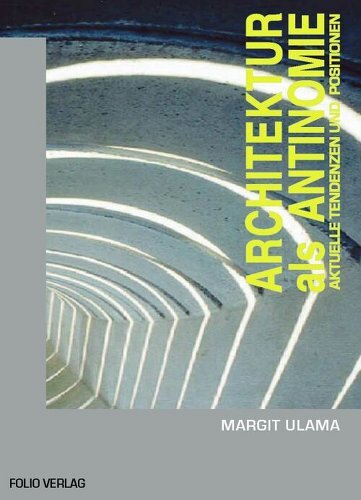Während sich am Beginn der neunziger Jahre der einfache Baukörper als zentrales und eigenständiges Thema der Architekturentwicklung etablierte, wurden in jüngerer Zeit Grenzbereiche des Minimalistischen erforscht. Einen pointierten Ausdruck dieser Recherche bilden neue Formen des Ornamentalen, die frühere Traditionen weiterführen. Es handelt sich dabei um gestaltete Oberflächen, denen die Aufgabe zukommt, die Baukörper, die radikal reduziert und gleichsam verarmt sind, zu nobilitieren. Die Bibliothek in Eberswalde von Jacques Herzog und Pierre de Meuron und die Informationstechnischen Institute der TU Graz (2000) von Florian Riegler und Roger Riewe sollen in diesem Kontext eingehender betrachtet werden.
Kaum ein anderes Diktum der neueren Architekturgeschichte hat so sehr und so lange das Bewusstsein geprägt wie jenes von Adolf Loos aus dem Jahr 1908, laut dem das Ornament „Verbrechen“ sei. Resultierte es ursprünglich aus einer Polemik gegen die schwülstigen Auswüchse des Historismus, so galt es in der Folge als Beleg dafür, dass zeitgemässe Architektur davon befreit zu sein habe. Doch das flotte Zitieren vergass auch die differenzierte Argumentation. Der Titel des Aufsatzes lautete „Ornament und Verbrechen“; später distanzierte sich Loos explizit von einer systematischen und konsequenten Abschaffung des Ornaments. Er selbst verwendete nicht nur den blossen, spröden Kubus, sondern auch ornamentale Elemente. Dennoch kam es einem Tabubruch gleich, als Herzog & de Meuron im Zusammenhang mit dem Entwurf für ihre Bibliothek der Fachhochschule in Eberswalde (1999) von der Tätowierung des Gebäudes sprachen und das Äussere mit einer Bilderhaut überzogen. Ganz anders gingen Florian Riegler und Roger Riewe bei ihrem Konzept für die Informationstechnischen Institute der TU Graz (2000) auf den Inffeldgründen vor. Doch auch hier findet man pure Kuben; mittels einer dichten und unregelmässigen Fenstersetzung entsteht eine Art Muster. Oder vielleicht doch ein Ornament oder ein ornamentales Muster? Im Sinne eines Oxymorons überlagert sich Konträres. Eine frühere Dichotomie wird aufgehoben, und es entsteht etwas Neues, das als konsequente Fortsetzung unterschiedlicher Traditionen gelten kann.
Theoretische Grundlagen
Fülle, ungezügelte Phantasie und reicher Schmuck einerseits sowie Reduktion, Vernunft und Konzentration auf das Wesentliche andererseits sind Zeichen konträrer Lebenshaltungen, die mit dem Begriffspaar apollinisch - dionysisch bis in die griechische Mythologie zurückreichen. Während einfache Form und pure Materialität wiederkehrende Themen des 20. Jahrhunderts bildeten, konzentrierte sich das theoretische und praktische Interesse hinsichtlich des Ornaments auf die Jahrhundertwende und die Zeit davor. Für Loos war die Befreiung vom Ornament - zeitbedingt - Ausdruck eines kulturellen Fortschritts. Dagegen steht die Überzeugung von Ernst H. Gombrich, dass es keine Kultur ohne Tradition der Ornamentik gebe. August Schmarsow widmete sich um die Jahrhundertwende so unterschiedlichen Themen wie der Raumgestaltung und der Ornamentik. Letztere bezeichnete er vorsichtig als „Uranfang aller Künste“. In der Diskussion von Gottfried Semper und Alois Riegl spitzten sich schliesslich gegensätzliche Auffassungen und Ansätze zu. Für den Ersten bildeten bekanntermassen Technik, Material und Zweck die Prämissen jeglichen Schaffens; Riegl opponierte dem und leitete seine „Geschichte der Ornamentik“ (1893) aus einem übergeordneten Kunstwollen ab. Doch auch Semper berührt letztlich die Welt des Ornaments, das für ihn Konsequenz und nicht primäres Bedürfnis ist und dessen höchster Ausdruck in der Annäherung ans Immaterielle liegt. - Die breite Diskussion zum Ornament umfasst natürlich auch Fragen seiner Definition und Abgrenzung. Aus kulturkonservativer Sicht beklagte Hans Sedlmayr Mitte des 20. Jahrhunderts den „Tod des Ornaments“, und er verwendete den Begriff des ornamentalen Musters. Gerade die Grenzbereiche - und zwar sowohl zum Muster als auch zum Bildhaften - präsentieren sich als die aktuellen Topoi, eingebettet in die jeweilige Entwurfsstrategie der Architekten. Die traditionellen Grundlagen bleiben weiterhin gültig. So grenzt sich das Ornament vom blossen Muster dahingehend ab, dass es seinen Träger beziehungsweise dessen Form interpretiere, was antike Vasen auf schöne Weise veranschaulichen. Hinsichtlich des Bildes sind zusätzlich Abstraktion und Entindividualisierung ausschlaggebend. Wenn die Fenstersetzung bei Rieger & Riewe zum abstrakten Muster tendiert und Herzog & de Meuron sich unmittelbar des Bildes bedienen, vexiert beides und kippt am Ende ins Ornamentale.
Dies beruht im Sinne eines paradigmatischen Widerspruchs auf einer äussersten Reduktion, und zwar in doppelter Hinsicht. Das neue Ornament artikuliert sich als solches minimalistisch, und es verbindet sich mit einer spezifischen Tendenz, für die der einfache Baukörper die Grundlage bildet. Für Letzteres stellt die Minimal Art der sechziger Jahre insofern eine Voraussetzung dar, als sich damals ein besonderer, plastischer Umgang mit einfachen Volumina etablierte, der in der Folge auch den Blick auf den Kubus der Moderne fundamental veränderte. In den sechziger Jahren brachte man mit dem Ganzen der Körper neue Relationen ins Spiel, sowohl jene zwischen den Teilen als auch die zum umgebenden Raum. Das körperliche Erfahren wurde konstitutiv für das visuelle. Die architektonische Fortsetzung dessen beruht auf der betonten Bündigkeit der Quader in Eberswalde, aber auch auf den Inffeldgründen in Graz.
Ornamentale Fenstersetzung
Die Bauten in Eberswalde und Graz sind jeweils Ausdruck einer umfassenden Entwurfsstrategie, gewissermassen die Pointierung einer spezifischen Thematik. Riegler & Riewe stellten Mitte der neunziger Jahre einen Wohnbau in Graz-Strassgang fertig. Mit diesem Low-cost- Projekt entwickelten sie auf allen Ebenen eine extreme Reduktion: hinsichtlich des Baukörpers, der Materialität, der Wohnungstypologie und damit auch der Interpretation der Funktionen. Die lang gestreckte Sichtbeton-Box scheint einfach auf den flachen Grund gesetzt, obwohl sie unterkellert ist. Differenziert wird dieses pure Konzept mittels der Schiebeelemente aus Nylon und Streckmetall vor den raumhohen Öffnungen. Auf diese Weise überzieht ein gleichmässiges, sich stetig veränderndes Muster die drei Geschosse. Man kann von einem seriellen Streifenmuster sprechen, das knapp vor der Betonfassade deren Konturen wiederholt und eine Art Reliefierung mit starker Schattenwirkung darstellt. Besonders aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Ansichtszeichnung, die die Architekten als langes, in sich strukturiertes Rechteck ohne jeglichen Umraum publizierten, und die frontale Photographie. Dabei vermittelt sich die Flächigkeit der Fassade, mehr noch, deren Isotropie, die sich eigentlich erst auf Grund des Musters ausdrückt. Die Photographie zeigt verschiedene horizontale Streifen: eine Betonfläche im Vordergrund, das Erdreich, den Baukörper und darüber den Himmel. Natürlich reicht der Baukörper seitlich über das Bild hinaus, und die Fassade wird zur tendenziell unendlich sich fortsetzenden Fläche. Das Fassadenmuster unterstreicht dies, beziehungsweise es konstituiert die essenzielle Idee des Entwurfes.
Das 1998 fertiggestellte Bundesinstitut für Sozialpädagogik in Baden bei Wien setzt dies subtil fort. Riegler & Riewe verwenden hier drei autonome Körper, die aber auch Raum definieren. Den Mittelpunkt bildet der quer gelagerte, fünfgeschossige, mit einer Glashaut überzogene und daher grünlich schimmernde Haupttrakt. An den Längsseiten steht das Kellergeschoss frei. Dies hat natürlich praktische Gründe und wird am Ende zu einem integralen Teil des ästhetischen Konzeptes. Die räumliche Organisation ist simpel; ein Mittelgang, der sich zu einer Halle erweitert, erschliesst die Klassenräume an der Nordseite. Die Fassadenkomposition sticht noch mehr ins Auge als beim früheren Bau. Kleine Öffnungen sind gleichmässig verteilt, an der Südseite weniger, an der Nordseite mehr. Dies verbindet sich mit einem innovativen Heizkonzept, bei dem die südseitige Betonwand als grossflächiger Sonnenkollektor wirkt. Besonders an der Nordseite artikuliert sich auf Grund der stärkeren Durchlöcherung wieder ein gleichförmiges und atektonisches Fassadenmuster. Blickt man vom Park auf den grünlich schimmernden Körper, so versinkt dieser auf Grund des Grabens nun scheinbar im Boden. Die tendenzielle Unendlichkeit der Fassadenfläche wird unmittelbar vor Augen geführt, und das Muster kippt ins Ornamentale.
Städtebauliche Implikationen
Bei den Informationstechnischen Instituten der TU Graz verwenden Riegler & Riewe mit dem lang gestreckten Sichtbetonkörper das Pendant zur glasumhüllten Box. Die Fenster wurden in jedem Geschoss wieder gesplittet und sitzen noch dichter als beim Schulbau in Baden. Auch bei dem Beispiel verwandelt sich das durch die Fenstersetzung entstandene Muster in ein Ornament; dieses paraphrasiert und interpretiert die Idee sowohl des Baukörpers als auch des städtebaulichen Konzeptes insgesamt. - Bei dem Entwurf für das grosse Grundstück am Stadtrand schichtete man lange, schmale Volumina dicht nebeneinander. Bei den besonders eng gesetzten fungiert der Zwischenraum als glasgedeckte Halle; daneben entspricht der Querschnitt der Aussenräume annähernd jenem der Volumina. Baukörper und Raumkörper verwandeln sich einander an, und diese Relation von „void“ und „solid“ wurde bereits von der Minimal Art vorgeführt. Die texturhafte, antihierarchische Komposition füllt nach der letzten Baustufe das rechteckige Grundstück und geriert sich ähnlich autonom wie der einzelne Baukörper.
Variiert wird dieses strenge geometrische Konzept durch die flexiblen Längen der Boxen. Im zentralen Bereich entstehen unregelmässige, amöbenhaft fliessende Aussenräume, die aber auch in die betont langen und schmalen Zwischenräume übergehen. Ein einfaches Grundkonzept entfaltet sich zu einer besonderen Komplexität, wobei das körperliche Erfahren der unterschiedlichen Aussenräume wesentlich wird. Daneben birgt der Wechsel der lang gestreckten, tendenziell unendlichen Innenhallen mit den stark rhythmisierten Querwegen eben diese Erfahrung. So streng der einzelne Baukörper ist, so frei und beinahe verspielt wirken die variablen Längen, auch wenn diese funktionale Anforderungen reflektieren.
Bild contra Ornament
Die Bibliothek in Eberswalde spielt mit der konträren Form des Ornaments. Im OEuvre von Herzog & de Meuron stellen sowohl das nicht abstrakte, figürliche Haus als auch der einfache Kubus kontinuierliche Themen dar. Die neutrale Box bildet dabei den Hintergrund zur vielfältigen strukturellen und materiellen Differenzierung der Fassade bis hin zur Umhüllung mit einer kontinuierlichen Bilderhaut. Die Bibliothek vexiert zwischen dem Banalen und dem Elaborierten. Die freistehende Box ist rüde, vielleicht noch mehr als jene von Riegler & Riewe, das räumliche Konzept vergleichbar einfach. In städtebaulicher Hinsicht ergänzt sie ganz einfach die bestehenden Bauten am Campus der Fachhochschule. Das ästhetische Spiel mit der Wahrnehmung verdichtet sich an der Oberfläche, und zwar an der äussersten Oberfläche. Gottfried Semper pries die Farbe als das immateriellste Bekleidungsmittel; Herzog & de Meuron gelang es, diese Idee noch weiter zu steigern. Die äusserst plastisch wirkenden Bilder resultieren nämlich allein aus der Differenzierung des Betons und der Fenster in raue und glatte Flächen und sind materiell gewissermassen gar nicht existent.
Mittels eines speziell entwickelten Waschbetonverfahrens, das bereits bei der Sportanlage Pfaffenholz angewendet worden war, wurden Zeitungsbilder aus dem Archiv von Thomas Ruff im metaphorischen Sinn auf die einzelnen Betonplatten gedruckt und damit zum zweiten Mal verfremdet. Vom Ornamentfries bis zur flächenhaften Hülle, von der Textur bis zum einzelnen Bild, von tiefen Schatten bis zur glänzenden Oberfläche reichen die Eindrücke - je nach Blickwinkel und Distanz. Mit den Bildern werden Geschichten erzählt, und es wird die Oberflächenmaterialität zu einer äussersten Differenzierung getrieben.
Zur Betonwand der Ricola-Produktions- und -Lagerhalle in Mülhausen meint Jacques Herzog: „Einen oder zwei Tage nach dem Regen rinnt immer noch Wasser ganz langsam herunter fast wie in einem 24-Stunden-Video von Douglas Gordon. Wenn die Wand feucht ist, erscheint sie transparenter als die Glaswand, ein Effekt, den wir wirklich lieben, weil er nicht nur schön ist, sondern auch Fragen nach Festigkeit und Transparenz stellt.“ In Eberswalde bergen die Schatten eine gewisse Schwere, während das Texturhafte die massive Wand mit einer leichten Struktur überlagert.
Bei den Bauten von Herzog & de Meuron kommen immer wieder Einflüsse der Minimal Art ins Spiel. Betont körperlich erfährt man den Raum zwischen Rückfassade und Felswand beim Ricola-Lagerhaus in Laufen, und beim Steinhaus in Tavole stellt man auf diese Weise wechselnde Relationen zwischen dem Kubus und dem Raumgitter her. In Eberswalde hat sich dieser Kubus gänzlich auf sich selbst zurückgezogen. Mittels der Bewegung erlebt man das Changieren der Fassade. Die Bilderhaut bedeutet die Nobilitierung eines Baukörpers, der radikal reduziert und gleichsam verarmt ist. Traditionelle Implikationen des Ornaments, zu denen ausserdem das Phantasievolle und das Luxuriöse zählen, kommen wieder zum Ausdruck. Man kann von Textur contra Bild, aber auch von Realistik contra Abstraktion sprechen. Doch auch bei diesem Beispiel stellt sich die Frage, ob die elaborierte Oberfläche die Form des Volumens in ihrer Essenz interpretiert und zum Ornament wird. Betrachtet man die einzelnen Friese, so umhüllen und umwickeln diese den autonomen Kubus in seiner Reinheit und Bündigkeit. Sie betonen dabei seine In-sich-Geschlossenheit und radikalisieren letztlich die Idee des Solitärs.
Hülle und Kern
Diese subjektiven Interpretationen eines Ornamentalen entwickeln sich aus einer subtilen Materialdifferenzierung heraus. Man bemerkt ausserdem Parallelitäten innerhalb der Architekturentwicklung; so setzte Elsa Prochazka bei ihrem Umbau für Coca-Cola an einer südlichen Ausfallstrasse von Wien ebenfalls die Fenster wie zufällig verstreut - mit dem Argument der besseren Belichtung für die Computerarbeitsplätze. Doch ihre Haltung stellt eine moderat-moderne dar, die anderen präsentieren sich dezidierter. In Eberswalde wie auch auf den Inffeldgründen in Graz wird der pure Kubus in aller Entschiedenheit vor Augen geführt, also gleichsam der gute und wahre Kern. Werner Oechslin wies auf die Wertverschiebung am Beginn des 20. Jahrhunderts von der oberflächlichen Hülle zugunsten dieses Kerns hin. Jetzt kehrt beides gemeinsam zurück und damit auch Gegensätze wie Gebrauchszweck und Kunstzweck, Kernform und Kunstform, Kern und Hülle oder auch nackter Baukörper und Bekleidung. Oechslin zeichnet jene Entwicklung nach, die nach dem Abwerfen der Stilhülsen des 19. Jahrhunderts im befreiten, zeitlosen und ewigen Kern mündete. Wenn sich über den radikalisierten Kern jetzt eine neue Ornamenthülle legt, so bleibt die Frage nach dem Verhältnis der neuen Hülle zu eben diesem Kern.
Den Zeichen der Zeit mit ihren Ambivalenzen folgend, suggerieren die Beispiele von Riegler & Riewe einen klaren und eindeutigen Kern und heben diesen Eindruck im selben Moment wieder auf. Die geschlossenen Stirnseiten der Bauten auf den Grazer Inffeldgründen rücken im ersten Moment den Eindruck des massiven Kerns ganz in den Vordergrund. Doch bald bemerkt man die Fugen knapp neben den Kanten. An den Längsseiten wurden dünne Betonscheiben vorgeblendet, die zudem auf Grund ihrer starken Durchlöcherung nicht tragend sein können.
Die Scheiben interpretieren die klassischerweise Glasstrukturen überantwortete Funktion der Curtain-Wall; die Stützen dahinter bilden das Gestell, das mit den durchlöcherten, dennoch massiven Elementen bekleidet wird. Herzog & de Meuron liegen hingegen viel näher bei einem wirklichen Kern. Zwar findet man auch bei der Bibliothek einen Skelettbau, und der Kubus wird durch die horizontal laufenden Glasbänder unterbrochen. Doch prinzipiell bilden die Fassaden eine Einheit, und die freistehenden Stützen des Inneren verbinden sich mit jenen der Aussenwand. Alle Teile gemeinsam ergeben ein zusammenhängendes statisches System, und dieses fungiert als Träger für die Tafeln der Fassade. Der wahre Kern scheint zurückgekehrt, unverfälscht und bloss, umhüllt von einer ungreifbaren und umso intensiver wirkenden Bilderhaut.