Artikel
Baukunst und Technologietransfer
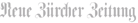
Der bayrische Bauingenieur und Architekt Franz Jakob Kreuter
29. April 2004 - Bruno Meyer
Zu den wichtigsten Architekten, die für Maximilian II. von Bayern arbeiteten, zählte Franz Jakob Kreuter (1813-1889). Obwohl er nie in Bayerns oberste Baubehörde berufen worden war, konnte er als freiberuflich tätiger Architekt zwei bedeutende frühe Bauaufträge des jungen Königs verwirklichen. Mit dem von August von Voit ausgeführten Wintergarten in der Münchner Residenz entwarf er 1851 den ersten Glas-Eisen-Bau in Süddeutschland, der die Konstruktion des Münchner Glaspalasts (1854) beeinflusste. Am Starnbergersee baute er das Kasino auf der Roseninsel (1852) in einer Gartenanlage von Peter Joseph Lenné, was danach am Seeufer zum Bau vieler Villen führte.
Villen und Fabriken
Doch Kreuter hatte sich bereits zuvor einen Namen gemacht. Nach seiner Ausbildung und Praxis bei Friedrich von Gärtner, Joseph Daniel Ohlmüller und Leo von Klenze unternahm er ab 1837 regelmässig Studienreisen in europäische Länder und korrespondierte für die «Allgemeine Bauzeitung» mit Ludwig Förster in Wien. Beeindruckt vom Wirken der englischen Ingenieure, liess er sich 1839 in München als Civil-Ingenieur nieder. Innert dreier Jahre baute er eine Stearinkerzen- und Seifenfabrik, eine Schwefelsäure- und Sodafabrik, eine Glashütte sowie eine Eisengiesserei, entwarf eine Baumwollspinnerei, studierte Bayerns Kohlebergbau sowie Gasbeleuchtungen und propagierte Asphaltbeläge. Gleichzeitig war er als Architekt von Privatbauten tätig. Hervorragend sind in München die Palais Schönborn (1844) und Dürckheim (1846) sowie die Villa Gruber am Bodensee bei Lindau (1847).
Im Jahre 1846 übernahm Kreuter in Budapest von Ludwig von Kossuth den Auftrag, für Ungarns Verbindung zur Adria die Eisenbahnstrecke vom Hafen Fiume nach Semlin bei Belgrad zu planen. Die einschlägigen Kenntnisse hatte er sich 1845 in Paris erworben. Als er 1848 seinen Bericht drucken liess, brach die Revolution aus. Kreuter verpflichtete sich im österreichischen Ministerium für Landeskultur, Handel und Gewerbe unter Anton von Doblhoff-Dier und entwarf Wohnungen für ein neues Arbeiterquartier in Wien. Danach kehrte Kreuter nach München zurück und engagierte sich für die wirtschaftliche und soziale Neuordnung des Staates. Seine Bewerbung um eine Staatsstelle blieb freilich ohne Erfolg. Immerhin ehrte ihn Maximilian II. für seinen Einsatz als Civil-Ingenieur der Telegrafenlinie Strassburg-Triest mit dem Michaelsorden. Ebenso vielgestaltig wie Kreuters Tätigkeiten war sein Lebensbild. Aus zahllosen Details hat es der Kunsthistoriker Christoph Hölz rekonstruiert. Er fand über 500 Architekturzeichnungen, Reiseskizzen und Studienblätter sowie Briefe, Abrechnungen und Akten in über 50 Archiven und in Privatbesitz. Daraus ergab sich ein Werkverzeichnis mit 54 Nummern. Das meist farbige Planmaterial repräsentiert bereits einen eigenen Wert, sind doch viele der Gebäude inzwischen zerstört oder umgenutzt.
Architektur allein erfüllte Kreuters Leben nur teilweise. 1852 übersiedelte er nach Wien, erwarb ein Landgut und förderte die Landwirtschaft im Hinblick auf eine moderne Nationalökonomie. In dieser Funktion nannte er sich nun «Entrepreneur». Für den Pflanzenbau pflegte er internationale Kontakte - wie zuvor schon mit Joseph Paxton für die Seerosenanlage im Wintergarten. Sein «Praktisches Handbuch der Drainage» (1851) war ein finanzieller Erfolg und wurde mehrfach aufgelegt. «Die Österreichische Hochmüllerei» (1884) hingegen bezeugt seine Kenntnis vom Stand der Technik und der Wirtschaft des Getreidebaus. Als 1883 der Orient-Express Paris-Konstantinopel eröffnet wurde, erlebte Kreuter dieses Ereignis als Eisenbahnpionier, allerdings schwer an Malaria erkrankt. Ab 1860 hatte er Vorstudien für das Netz in Serbien gemacht. Seine Vermessungen und Streckenentwürfe wurden Grundlage für die Verträge zwischen dem Bankier Moritz von Hirsch und dem türkischen Sultan.
Private Auftraggeber
In Wien erhielt Kreuter von den Habsburgern allerdings keine Aufträge mehr. Wegen Kosten- und Terminüberschreitungen hatte er sich mit dem bayrischen Hof zerstritten. Und beim Wiener Militärgouverneur war er «als arger Demokrat» registriert. Trotz dieser Ungnade verstand er es, weiterhin als Architekt für Private tätig zu sein. So baute er in Wien das Palais des Fürsten Windischgrätz, das Haus des Grafen Bray und gemeinsam mit Theophil Hansen das Palais des Bankiers Simon von Sina, für den er später den Palazzo Grassi in Venedig erneuerte.
Kreuter hinterliess weder ein Unternehmen noch ein Vermögen, aber ein Werk und eine grosse Familie. Heinrich Hübschs Frage, nach welchem Stile man bauen solle, hatte er nicht theoretisch beantwortet. Sein Werk ist vielmehr ein praktischer Beitrag an die Erfindung eines neuen Stils. Um die Architektur jener Zeit besser einzuschätzen, wünscht Christoph Hölz noch weitere solche Biografien. Dem ist anzufügen, dass diese auch die Entwicklung des Ingenieur- und des Architektenberufs erhellen würden, wie etwa Eckhard Bolenz («Vom Baubeamten zum freiberuflichen Architekten», 1991) und Ulrich Pfammatter («Die Erfindung des modernen Architekten», 2000) gezeigt haben. - Wie kam Kreuter ohne staatliche Stellung zu Aufträgen, fragte sich Christoph Hölz. Kurz gefasst lässt sich nun sagen: Eine berufliche Qualifikation konnte er sich bei namhaften Meistern erwerben. Was er als Sohn eines Hauslehrers und Reisebegleiters von Adelsfamilien zudem besass, war die Fähigkeit, die notwendigen Beziehungen auf höchster Ebene und über Grenzen hinweg herzustellen.
[Christoph Hölz: Der Civil-Ingenieur Franz Jakob Kreuter. Tradition und Moderne (1813-1889). Deutscher Kunstverlag, München 2003. 480 S., Fr. 112.-.]
Villen und Fabriken
Doch Kreuter hatte sich bereits zuvor einen Namen gemacht. Nach seiner Ausbildung und Praxis bei Friedrich von Gärtner, Joseph Daniel Ohlmüller und Leo von Klenze unternahm er ab 1837 regelmässig Studienreisen in europäische Länder und korrespondierte für die «Allgemeine Bauzeitung» mit Ludwig Förster in Wien. Beeindruckt vom Wirken der englischen Ingenieure, liess er sich 1839 in München als Civil-Ingenieur nieder. Innert dreier Jahre baute er eine Stearinkerzen- und Seifenfabrik, eine Schwefelsäure- und Sodafabrik, eine Glashütte sowie eine Eisengiesserei, entwarf eine Baumwollspinnerei, studierte Bayerns Kohlebergbau sowie Gasbeleuchtungen und propagierte Asphaltbeläge. Gleichzeitig war er als Architekt von Privatbauten tätig. Hervorragend sind in München die Palais Schönborn (1844) und Dürckheim (1846) sowie die Villa Gruber am Bodensee bei Lindau (1847).
Im Jahre 1846 übernahm Kreuter in Budapest von Ludwig von Kossuth den Auftrag, für Ungarns Verbindung zur Adria die Eisenbahnstrecke vom Hafen Fiume nach Semlin bei Belgrad zu planen. Die einschlägigen Kenntnisse hatte er sich 1845 in Paris erworben. Als er 1848 seinen Bericht drucken liess, brach die Revolution aus. Kreuter verpflichtete sich im österreichischen Ministerium für Landeskultur, Handel und Gewerbe unter Anton von Doblhoff-Dier und entwarf Wohnungen für ein neues Arbeiterquartier in Wien. Danach kehrte Kreuter nach München zurück und engagierte sich für die wirtschaftliche und soziale Neuordnung des Staates. Seine Bewerbung um eine Staatsstelle blieb freilich ohne Erfolg. Immerhin ehrte ihn Maximilian II. für seinen Einsatz als Civil-Ingenieur der Telegrafenlinie Strassburg-Triest mit dem Michaelsorden. Ebenso vielgestaltig wie Kreuters Tätigkeiten war sein Lebensbild. Aus zahllosen Details hat es der Kunsthistoriker Christoph Hölz rekonstruiert. Er fand über 500 Architekturzeichnungen, Reiseskizzen und Studienblätter sowie Briefe, Abrechnungen und Akten in über 50 Archiven und in Privatbesitz. Daraus ergab sich ein Werkverzeichnis mit 54 Nummern. Das meist farbige Planmaterial repräsentiert bereits einen eigenen Wert, sind doch viele der Gebäude inzwischen zerstört oder umgenutzt.
Architektur allein erfüllte Kreuters Leben nur teilweise. 1852 übersiedelte er nach Wien, erwarb ein Landgut und förderte die Landwirtschaft im Hinblick auf eine moderne Nationalökonomie. In dieser Funktion nannte er sich nun «Entrepreneur». Für den Pflanzenbau pflegte er internationale Kontakte - wie zuvor schon mit Joseph Paxton für die Seerosenanlage im Wintergarten. Sein «Praktisches Handbuch der Drainage» (1851) war ein finanzieller Erfolg und wurde mehrfach aufgelegt. «Die Österreichische Hochmüllerei» (1884) hingegen bezeugt seine Kenntnis vom Stand der Technik und der Wirtschaft des Getreidebaus. Als 1883 der Orient-Express Paris-Konstantinopel eröffnet wurde, erlebte Kreuter dieses Ereignis als Eisenbahnpionier, allerdings schwer an Malaria erkrankt. Ab 1860 hatte er Vorstudien für das Netz in Serbien gemacht. Seine Vermessungen und Streckenentwürfe wurden Grundlage für die Verträge zwischen dem Bankier Moritz von Hirsch und dem türkischen Sultan.
Private Auftraggeber
In Wien erhielt Kreuter von den Habsburgern allerdings keine Aufträge mehr. Wegen Kosten- und Terminüberschreitungen hatte er sich mit dem bayrischen Hof zerstritten. Und beim Wiener Militärgouverneur war er «als arger Demokrat» registriert. Trotz dieser Ungnade verstand er es, weiterhin als Architekt für Private tätig zu sein. So baute er in Wien das Palais des Fürsten Windischgrätz, das Haus des Grafen Bray und gemeinsam mit Theophil Hansen das Palais des Bankiers Simon von Sina, für den er später den Palazzo Grassi in Venedig erneuerte.
Kreuter hinterliess weder ein Unternehmen noch ein Vermögen, aber ein Werk und eine grosse Familie. Heinrich Hübschs Frage, nach welchem Stile man bauen solle, hatte er nicht theoretisch beantwortet. Sein Werk ist vielmehr ein praktischer Beitrag an die Erfindung eines neuen Stils. Um die Architektur jener Zeit besser einzuschätzen, wünscht Christoph Hölz noch weitere solche Biografien. Dem ist anzufügen, dass diese auch die Entwicklung des Ingenieur- und des Architektenberufs erhellen würden, wie etwa Eckhard Bolenz («Vom Baubeamten zum freiberuflichen Architekten», 1991) und Ulrich Pfammatter («Die Erfindung des modernen Architekten», 2000) gezeigt haben. - Wie kam Kreuter ohne staatliche Stellung zu Aufträgen, fragte sich Christoph Hölz. Kurz gefasst lässt sich nun sagen: Eine berufliche Qualifikation konnte er sich bei namhaften Meistern erwerben. Was er als Sohn eines Hauslehrers und Reisebegleiters von Adelsfamilien zudem besass, war die Fähigkeit, die notwendigen Beziehungen auf höchster Ebene und über Grenzen hinweg herzustellen.
[Christoph Hölz: Der Civil-Ingenieur Franz Jakob Kreuter. Tradition und Moderne (1813-1889). Deutscher Kunstverlag, München 2003. 480 S., Fr. 112.-.]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






