Bauwerk
Schulanlage Leutschenbach
Christian Kerez - Zürich (CH) - 2009
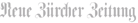
Der Architekt eines als Luxusbau verschrienen Zürcher Schulhauses sagt: «Ich würde alles noch einmal genau gleich machen»
Das Zürcher Schulhaus Leutschenbach ist nicht zum ersten Mal in den Schlagzeilen – zu Unrecht, findet Christian Kerez.
8. Februar 2025 - Marius Huber
Für den Architekten Christian Kerez muss es sich unangenehm vertraut anfühlen, wie das Aufplatzen einer alten Wunde. Das spektakuläre Zürcher Schulhaus Leutschenbach mit der Turnhalle auf dem Dach, eröffnet vor 15 Jahren, wird regelmässig als Beispiel herangezogen, wenn die Stadt Zürich für ihre Bauten kritisiert wird. Ein effekthaschender Luxusbau sei das, Kunst um der Kunst willen, viel zu teuer. Diese Vorwürfe wiederholen sich jetzt erneut auf allen Kanälen, weil bekanntgeworden ist, dass das Schulhaus im Sommer wegen Lärmproblemen nachgebessert werden musste.
Herr Kerez, wenn Sie noch einmal zurückkönnten: Was würden Sie am Schulhaus Leutschenbach anders machen?
Ich schaue es mir immer noch sehr gerne an, es ist grosszügig und abwechslungsreich. Ich würde alles noch einmal genau gleich machen.
Obwohl Sie dadurch im Ruf stehen, einer zu sein, der zu teuer baut und primär auf Architekturpreise aus ist?
Diese Kritik kommt meist von Leuten, die das Schulhaus nie von innen gesehen und erlebt haben. Viel wichtiger sind mir die Reaktionen der Direktbetroffenen.
Wenn Sie die Kritik wirklich kaltliesse, sässen wir kaum hier.
Ich möchte einiges klarstellen. Von den 64 Millionen Franken Anlagekosten, von denen immer geschrieben wird, sind lediglich 40,5 Millionen reine Gebäudekosten. Ich will mich gegen das schlechte Image dieses Schulhauses wehren – auch im Namen der Schüler, die dort einen wichtigen Abschnitt ihres Lebens verbringen und stolz sind auf ihre Schule.
Den Schülern macht doch gar niemand einen Vorwurf.
Aber als Schüler identifiziert man sich mit seiner Schule. Darum ist es wichtig, dass Schulhäuser unterschiedlich aussehen und eine eigene Persönlichkeit haben. Die Fussballmannschaft aus dem Leutschenbach hat die besondere Form ihres Schulhauses auf den Trikots abgebildet – das bedeutet mir mehr als mancher Architekturpreis.
Was sagen Sie zum Vorwurf der eitlen Spektakelarchitektur: Ist es nicht ein Fakt, dass es auch viel einfacher ginge?
Wir haben den Wettbewerb damals nicht gewonnen, weil wir ein Spektakel boten. Sondern weil wir Platz für einen öffentlichen Park gewonnen haben, indem wir in die Höhe bauten.
Auch in die Höhe bauen kann man konventioneller – ohne komplexe Statik aus dem Brückenbau und schwebende Geschosse.
Bauen ist nirgends so teuer wie in der Schweiz, und, ja, auch das Schulhaus Leutschenbach war teuer. Aber der Schein trügt. Viele halten es für teurer, als es war, weil die Fachwerkbauweise aus Stahl im Schulhausbau ungewohnt ist. Im Brückenbau, wo sie herkommt, wird sie angewandt, um Kosten zu sparen. Aber im zwinglianischen Zürich ist etwas gleich verdächtig, wenn es aus dem Rahmen fällt.
Pro Kubikmeter war das Schulhaus zu seiner Zeit eines der teureren.
Das ist richtig. Aber das liegt daran, dass es eine extrem kompakte Anlage mit sparsamen Grundrissen ist. Die Kosten pro Klassenzimmer liegen leicht unter dem Durchschnitt der Schulhäuser jener Zeit.
Allerdings heisst es unter Architekten heute, dass sich seit dem Leutschenbach kaum noch jemand traue, im Schulhausbau Experimente zu wagen. Ohne Grund wurde es kaum zur Zäsur.
Ich dachte damals, dass ich die Tür öffne für andere, die Experimente wagen. Tatsächlich hat das Leutschenbach kaum zu Veränderungen geführt. Es gab allerdings einen Wandel, der ausgelöst wurde durch eine politisch motivierte Polemik, dass die öffentliche Hand zu teuer baue. Als Folge davon hat man den Schulhausbau privatisiert. Und was ist passiert? Die teuerste Schulhausanlage in der Stadt Zürich ist die ZHdK, die Hochschule der Künste. Der Kanton ist dort nur Mieter der Allreal. Diese Schule hat 550 Millionen Franken Baukosten verschlungen. 550 Millionen! Aber kaum jemand spricht darüber.
Warum überhaupt Experimente? Was spricht dagegen, einen Zweckbau nach bewährtem Muster zu erstellen?
Weil Vielfalt wichtig ist. Ein Experiment muss auch nicht teuer sein. Man kann anders bauen und trotzdem billig. Ich baue mit meinem Büro zurzeit 450 Wohnungen in Südamerika – jede davon kostet weniger als 35 000 Franken.
Ein Experiment bedeutet doch per definitionem mehr Unwägbarkeit, auch finanziell. Dass ausgefallene Bauten teurer werden als geplant, ist die Regel. Auch bei Ihnen hat sich die Bauzeit damals verlängert.
Ich habe als junger Architekt einen Fehler gemacht: Wir haben den Kostenvoranschlag unter politischem Druck linear um 5 Prozent gekürzt. Wir dachten, wir könnten nicht nur alles besser, sondern auch etwas billiger machen. Das war ein Irrtum, diese freiwilligen Kürzungen haben uns am Ende gefehlt.
Sind sich Baukünstler nicht einfach zu schade dafür, auch einmal einen Entwurf abzuliefern, der nicht alles neu erfindet?
Ich beobachte etwas anderes: Wettbewerbe schränken heute den Spielraum von Architekten so stark ein, dass sich die verschiedenen Projekte kaum noch unterscheiden. Vielleicht braucht es in Zukunft gar keine Architekten mehr, weil eine KI die strengen Vorgaben besser umsetzen kann.
Abgesehen von einem tollen Motiv fürs Fussballtrikot: Was haben Kinder und die Lehrer davon, wenn ihnen der Staat eine Architektur-Ikone als Schulhaus hinstellt?
In diesem Schulhaus gibt es ganz viele unterschiedliche Räume. Eine reichhaltige räumliche Organisation, die dank der Stahlkonstruktion sehr direkt umgesetzt werden konnte.
Man wird den Verdacht nicht los, dass am Anfang der Wunsch des Architekten stand, diese aufregende Konstruktion zu errichten. Und alles andere musste sich dann danach richten, bis hin zur kühlen Materialisierung aus Stahl, Beton und Industrieglas.
Überhaupt nicht, die erste Idee war der Aussenplatz. Wir wollen nicht wie alle anderen hier eine Turnhalle und da die Klassenzimmer hinstellen, deshalb stapelten wir alles aufeinander. Daraus ergab sich die Frage, wie man den Weg von unten nach oben ansprechend gestaltet. So kamen wir auf die Organisation der Räume. Und erst daraus ergaben sich die Statik und das Material.
Was wussten Sie über die Bedürfnisse von Kindern, als Sie das Haus entworfen haben?
Sehr viel! Der spätere Schulleiter und ein Vertreter des pädagogischen Dienstes waren Teil der Wettbewerbsjury. Und in einer zweiten Phase konnten sich auch Lehrer mit ihren Wünschen einbringen. Dieses Projekt habe ich nicht im Alleingang entwickelt. Darum wehre ich mich gegen den Vorwurf, es sei mir nur um die Architektur gegangen. Die Auszeichnungen bekam das Gebäude später auch deshalb, weil es im Schulhausbau damals als vorbildlich galt. Unter anderem wegen der grossen Gemeinschaftszonen und der guten Nutzung vom Tageslicht.
Pädagogische Fachleute sind das eine, die Perspektive von Kindern ist etwas anderes. Wie kommen Sie darauf, dass sich Kinder leere Räume aus Stahl, Beton und Industrieglas wünschen?
Als Architekt bereite ich nur die Bühne, auf der sich die Kinder ausdrücken können – Farbe und Reichtum bringen diese selbst rein. Meine Architektur ist bewusst karg, aus Respekt vor den Nutzern.
Auch zu den fehlenden Nischen sagten Sie einmal, dass die Kinder sich diese selbst erkämpfen müssten. Eine seltsam harte Haltung.
Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Das Erlebnis dieser weiten Pausenplätze ohne Versteckmöglichkeiten war grossartig. Gleichzeitig hat man als Kind stets auch Nischen gefunden und sich in diesen exponierten Räumen eingerichtet. Die verborgenen Nischen, die die Lehrer nicht kannten, haben uns mehr interessiert als jene, die von den Lehrern für uns eingerichtet wurden. Auch das will ich als Architekt nicht vorwegnehmen.
Das neue Zürcher Kinderspital von Herzog & de Meuron sorgt mit einem ganz anderen Ansatz für Aufsehen: Es will Geborgenheit vermitteln und setzt auf viel Holz, auf Pflanzen und auf Nischen.
Das finde ich wunderbar – ich war übrigens Teil der Jury. Aber es ist ein Spital, das ist etwas anderes. Wobei ich nicht ausschliessen will, dass man im Schulhausbau auch einen solchen Weg gehen kann.
Wenn Architekten wegen der Polemik ums Leutschenbach wirklich ängstlicher geworden sind und sich weniger trauen: Warum sind dann die neuesten Zürcher Schulhäuser noch teurer geworden?
Wenigstens sehen diese Schulen billig aus, dann muss sich ja niemand mehr drüber ärgern. (Lacht.) Architekten müssen immer mehr und aufwendigere gesetzliche Auflagen erfüllen. Ob es nun um Materialien geht, um Energieeffizienz oder Befindlichkeiten – es ist verrückt. Das treibt die Kosten in die Höhe und führt dazu, dass sich heutige Schulhäuser kaum noch voneinander unterscheiden.
Man könnte auch hier günstiger bauen, das hat zum Beispiel die private Zurich International School mit ihrem Campus gezeigt.
Der Architekt Marc Angélil hat für diese private Bauherrschaft viel weniger Auflagen erfüllen müssen. Diese Schule hat etwa kein Minergie-Label.
Könnte es daran liegen, dass diese Schule im Gegensatz zur Stadt Zürich im Leutschenbach nicht ein Zeichen für herausragende Baukultur setzen wollte?
Nein, noch einmal: Das Leutschenbach mag teuer aussehen, aber kostenmässig ist es ein durchschnittliches Schulhaus.
Sollte man angesichts stark schwankender Schülerzahlen nicht konsequent auf modulare, erweiterbare Schulen setzen statt auf in sich geschlossene Bildungstempel?
In einem Zürcher Schulmodul kostet ein Klassenzimmer fast gleich viel wie in einem Neubau. Die Kosten senkt man so also kaum. Und schauen Sie nach Frankreich: Dort hat man extrem günstig gebaut, alles vorfabriziert. Bei den Unruhen in den Banlieues wurden diese Schulen angezündet, weil sie als Ausdruck der Hoffnungslosigkeit wahrgenommen werden. Das kann man dem Leutschenbach und der Stadt Zürich nicht vorwerfen.
Warum haben Sie eigentlich nach dem Leutschenbach nie mehr ein Schulhaus gebaut?
Das klingt angesichts der schlechten Presse zurzeit vielleicht seltsam, aber ich habe damals jahrelang all meine Energie in dieses Projekt investiert. Danach fand ich, dass ich für mich das bestmögliche Schulhaus gebaut habe. Da braucht es kein zweites mehr.
Herr Kerez, wenn Sie noch einmal zurückkönnten: Was würden Sie am Schulhaus Leutschenbach anders machen?
Ich schaue es mir immer noch sehr gerne an, es ist grosszügig und abwechslungsreich. Ich würde alles noch einmal genau gleich machen.
Obwohl Sie dadurch im Ruf stehen, einer zu sein, der zu teuer baut und primär auf Architekturpreise aus ist?
Diese Kritik kommt meist von Leuten, die das Schulhaus nie von innen gesehen und erlebt haben. Viel wichtiger sind mir die Reaktionen der Direktbetroffenen.
Wenn Sie die Kritik wirklich kaltliesse, sässen wir kaum hier.
Ich möchte einiges klarstellen. Von den 64 Millionen Franken Anlagekosten, von denen immer geschrieben wird, sind lediglich 40,5 Millionen reine Gebäudekosten. Ich will mich gegen das schlechte Image dieses Schulhauses wehren – auch im Namen der Schüler, die dort einen wichtigen Abschnitt ihres Lebens verbringen und stolz sind auf ihre Schule.
Den Schülern macht doch gar niemand einen Vorwurf.
Aber als Schüler identifiziert man sich mit seiner Schule. Darum ist es wichtig, dass Schulhäuser unterschiedlich aussehen und eine eigene Persönlichkeit haben. Die Fussballmannschaft aus dem Leutschenbach hat die besondere Form ihres Schulhauses auf den Trikots abgebildet – das bedeutet mir mehr als mancher Architekturpreis.
Was sagen Sie zum Vorwurf der eitlen Spektakelarchitektur: Ist es nicht ein Fakt, dass es auch viel einfacher ginge?
Wir haben den Wettbewerb damals nicht gewonnen, weil wir ein Spektakel boten. Sondern weil wir Platz für einen öffentlichen Park gewonnen haben, indem wir in die Höhe bauten.
Auch in die Höhe bauen kann man konventioneller – ohne komplexe Statik aus dem Brückenbau und schwebende Geschosse.
Bauen ist nirgends so teuer wie in der Schweiz, und, ja, auch das Schulhaus Leutschenbach war teuer. Aber der Schein trügt. Viele halten es für teurer, als es war, weil die Fachwerkbauweise aus Stahl im Schulhausbau ungewohnt ist. Im Brückenbau, wo sie herkommt, wird sie angewandt, um Kosten zu sparen. Aber im zwinglianischen Zürich ist etwas gleich verdächtig, wenn es aus dem Rahmen fällt.
Pro Kubikmeter war das Schulhaus zu seiner Zeit eines der teureren.
Das ist richtig. Aber das liegt daran, dass es eine extrem kompakte Anlage mit sparsamen Grundrissen ist. Die Kosten pro Klassenzimmer liegen leicht unter dem Durchschnitt der Schulhäuser jener Zeit.
Allerdings heisst es unter Architekten heute, dass sich seit dem Leutschenbach kaum noch jemand traue, im Schulhausbau Experimente zu wagen. Ohne Grund wurde es kaum zur Zäsur.
Ich dachte damals, dass ich die Tür öffne für andere, die Experimente wagen. Tatsächlich hat das Leutschenbach kaum zu Veränderungen geführt. Es gab allerdings einen Wandel, der ausgelöst wurde durch eine politisch motivierte Polemik, dass die öffentliche Hand zu teuer baue. Als Folge davon hat man den Schulhausbau privatisiert. Und was ist passiert? Die teuerste Schulhausanlage in der Stadt Zürich ist die ZHdK, die Hochschule der Künste. Der Kanton ist dort nur Mieter der Allreal. Diese Schule hat 550 Millionen Franken Baukosten verschlungen. 550 Millionen! Aber kaum jemand spricht darüber.
Warum überhaupt Experimente? Was spricht dagegen, einen Zweckbau nach bewährtem Muster zu erstellen?
Weil Vielfalt wichtig ist. Ein Experiment muss auch nicht teuer sein. Man kann anders bauen und trotzdem billig. Ich baue mit meinem Büro zurzeit 450 Wohnungen in Südamerika – jede davon kostet weniger als 35 000 Franken.
Ein Experiment bedeutet doch per definitionem mehr Unwägbarkeit, auch finanziell. Dass ausgefallene Bauten teurer werden als geplant, ist die Regel. Auch bei Ihnen hat sich die Bauzeit damals verlängert.
Ich habe als junger Architekt einen Fehler gemacht: Wir haben den Kostenvoranschlag unter politischem Druck linear um 5 Prozent gekürzt. Wir dachten, wir könnten nicht nur alles besser, sondern auch etwas billiger machen. Das war ein Irrtum, diese freiwilligen Kürzungen haben uns am Ende gefehlt.
Sind sich Baukünstler nicht einfach zu schade dafür, auch einmal einen Entwurf abzuliefern, der nicht alles neu erfindet?
Ich beobachte etwas anderes: Wettbewerbe schränken heute den Spielraum von Architekten so stark ein, dass sich die verschiedenen Projekte kaum noch unterscheiden. Vielleicht braucht es in Zukunft gar keine Architekten mehr, weil eine KI die strengen Vorgaben besser umsetzen kann.
Abgesehen von einem tollen Motiv fürs Fussballtrikot: Was haben Kinder und die Lehrer davon, wenn ihnen der Staat eine Architektur-Ikone als Schulhaus hinstellt?
In diesem Schulhaus gibt es ganz viele unterschiedliche Räume. Eine reichhaltige räumliche Organisation, die dank der Stahlkonstruktion sehr direkt umgesetzt werden konnte.
Man wird den Verdacht nicht los, dass am Anfang der Wunsch des Architekten stand, diese aufregende Konstruktion zu errichten. Und alles andere musste sich dann danach richten, bis hin zur kühlen Materialisierung aus Stahl, Beton und Industrieglas.
Überhaupt nicht, die erste Idee war der Aussenplatz. Wir wollen nicht wie alle anderen hier eine Turnhalle und da die Klassenzimmer hinstellen, deshalb stapelten wir alles aufeinander. Daraus ergab sich die Frage, wie man den Weg von unten nach oben ansprechend gestaltet. So kamen wir auf die Organisation der Räume. Und erst daraus ergaben sich die Statik und das Material.
Was wussten Sie über die Bedürfnisse von Kindern, als Sie das Haus entworfen haben?
Sehr viel! Der spätere Schulleiter und ein Vertreter des pädagogischen Dienstes waren Teil der Wettbewerbsjury. Und in einer zweiten Phase konnten sich auch Lehrer mit ihren Wünschen einbringen. Dieses Projekt habe ich nicht im Alleingang entwickelt. Darum wehre ich mich gegen den Vorwurf, es sei mir nur um die Architektur gegangen. Die Auszeichnungen bekam das Gebäude später auch deshalb, weil es im Schulhausbau damals als vorbildlich galt. Unter anderem wegen der grossen Gemeinschaftszonen und der guten Nutzung vom Tageslicht.
Pädagogische Fachleute sind das eine, die Perspektive von Kindern ist etwas anderes. Wie kommen Sie darauf, dass sich Kinder leere Räume aus Stahl, Beton und Industrieglas wünschen?
Als Architekt bereite ich nur die Bühne, auf der sich die Kinder ausdrücken können – Farbe und Reichtum bringen diese selbst rein. Meine Architektur ist bewusst karg, aus Respekt vor den Nutzern.
Auch zu den fehlenden Nischen sagten Sie einmal, dass die Kinder sich diese selbst erkämpfen müssten. Eine seltsam harte Haltung.
Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Das Erlebnis dieser weiten Pausenplätze ohne Versteckmöglichkeiten war grossartig. Gleichzeitig hat man als Kind stets auch Nischen gefunden und sich in diesen exponierten Räumen eingerichtet. Die verborgenen Nischen, die die Lehrer nicht kannten, haben uns mehr interessiert als jene, die von den Lehrern für uns eingerichtet wurden. Auch das will ich als Architekt nicht vorwegnehmen.
Das neue Zürcher Kinderspital von Herzog & de Meuron sorgt mit einem ganz anderen Ansatz für Aufsehen: Es will Geborgenheit vermitteln und setzt auf viel Holz, auf Pflanzen und auf Nischen.
Das finde ich wunderbar – ich war übrigens Teil der Jury. Aber es ist ein Spital, das ist etwas anderes. Wobei ich nicht ausschliessen will, dass man im Schulhausbau auch einen solchen Weg gehen kann.
Wenn Architekten wegen der Polemik ums Leutschenbach wirklich ängstlicher geworden sind und sich weniger trauen: Warum sind dann die neuesten Zürcher Schulhäuser noch teurer geworden?
Wenigstens sehen diese Schulen billig aus, dann muss sich ja niemand mehr drüber ärgern. (Lacht.) Architekten müssen immer mehr und aufwendigere gesetzliche Auflagen erfüllen. Ob es nun um Materialien geht, um Energieeffizienz oder Befindlichkeiten – es ist verrückt. Das treibt die Kosten in die Höhe und führt dazu, dass sich heutige Schulhäuser kaum noch voneinander unterscheiden.
Man könnte auch hier günstiger bauen, das hat zum Beispiel die private Zurich International School mit ihrem Campus gezeigt.
Der Architekt Marc Angélil hat für diese private Bauherrschaft viel weniger Auflagen erfüllen müssen. Diese Schule hat etwa kein Minergie-Label.
Könnte es daran liegen, dass diese Schule im Gegensatz zur Stadt Zürich im Leutschenbach nicht ein Zeichen für herausragende Baukultur setzen wollte?
Nein, noch einmal: Das Leutschenbach mag teuer aussehen, aber kostenmässig ist es ein durchschnittliches Schulhaus.
Sollte man angesichts stark schwankender Schülerzahlen nicht konsequent auf modulare, erweiterbare Schulen setzen statt auf in sich geschlossene Bildungstempel?
In einem Zürcher Schulmodul kostet ein Klassenzimmer fast gleich viel wie in einem Neubau. Die Kosten senkt man so also kaum. Und schauen Sie nach Frankreich: Dort hat man extrem günstig gebaut, alles vorfabriziert. Bei den Unruhen in den Banlieues wurden diese Schulen angezündet, weil sie als Ausdruck der Hoffnungslosigkeit wahrgenommen werden. Das kann man dem Leutschenbach und der Stadt Zürich nicht vorwerfen.
Warum haben Sie eigentlich nach dem Leutschenbach nie mehr ein Schulhaus gebaut?
Das klingt angesichts der schlechten Presse zurzeit vielleicht seltsam, aber ich habe damals jahrelang all meine Energie in dieses Projekt investiert. Danach fand ich, dass ich für mich das bestmögliche Schulhaus gebaut habe. Da braucht es kein zweites mehr.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom
Akteure
ArchitekturBauherrschaft
Tragwerksplanung
Landschaftsarchitektur
Kunst am Bau
Fotografie











