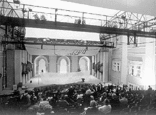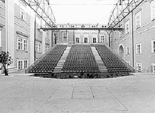Bauwerk
Überdachung Residenzhof
Klaus Kretschmer - Salzburg (A) - 1997

Ein Dach aus Stoff und Form
Kein Architekt, sondern ein Maschinenbauer mit Gefühl für szenische Wirkung und ein kreativer Statiker verwandelten den Salzburger Residenzhof in eine regensichere Opernbühne: ansprechende Ingenieurbaukunst mit Schönheitsfehlern.
17. August 1997 - Christian Kühn
Ein altes Klischee über das Verhältnis zwischen Architektur und Ingenieurbau besagt, daß der Architekt zuerst eine Form festlegt und der Ingenieur sich dann um deren Baubarkeit zu kümmern hat. Oft genug - so will es das Klischee - prallt dabei die freie Künstlernatur des Architekten mit der Verpflichtung des Ingenieurs zusammen, exakt zu rechnen und die geltenden Normen zu erfüllen.
Die wirkliche Beziehung zwischen den beiden Disziplinen ist freilich bei weitem nicht so simpel: Denn weder ist das Bauingenieurwesen eine exakte Wissenschaft, noch hat es je eine Architektur gegeben, die ihre Formen nicht auch aus dem Widerstand gegenüber dem Stofflichen abgeleitet hätte. Das Geheimnis der Ingenieurbaukunst besteht gerade darin, eine schlüssige Übereinstimmung zwischen konstruktivem Prinzip und formaler Durchbildung zu entwickeln, ohne einem der beiden Aspekte von vornherein Priorität einzuräumen. Die korrekte Berechnung ist dann nur ein nachgeordnetes, wenn auch nicht zu unterschätzendes Problem.
Die Überdachung des Hofs der alten Residenz in Salzburg ist ein gelungenes Beispiel für Ingenieurbaukunst in diesem Sinn. Die Aufgabenstellung erscheint auf den ersten Blick ganz simpel: Ein rechteckiger Hof, 24 mal 36 Meter im Geviert, soll für die Salzburger Festspiele in ein regensicheres „Opernhaus“ verwandelt werden. Schon in den fünfziger Jahren fanden hier Aufführungen statt, damals allerdings vor kleinerem Publikum. Als 1993 unter Gérard Mortier der Residenzhof als Spielstätte wiederentdeckt wurde, erhöhte man die Anzahl der Sitzplätze auf 800 und wich bei Regen ins Mozarteum aus.
Der Wunsch nach einer Überdachung ergab sich aus ökonomischen Überlegungen: Einerseits ist bei jeder Freiluftvorführung eine zweite Spielstätte als „Ausweichquartier“ blockiert, andererseits lassen sich Karten für eine Aufführung, die man unter Umständen nur konzertant erleben wird, nicht zum selben Preis verkaufen wie für andere Produktionen. Streng ökonomisch begründet war daher auch die Vorgabe für den Kostenrahmen: Das neue Dach sollte sich innerhalb von vier Jahren amortisieren und durfte daher nicht mehr als drei Millionen Schilling kosten.
Nun haben die Salzburger Festspiele mit der Überdachung von Spielstätten ja schon Erfahrung: Seit 1972 ist die Felsenreitschule mit einem flexiblen, auf Stahlseilen beweglichen Dach geschützt, das auch den stärksten Regenfällen trotzt. Um akustische Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist dieses Dach zweischichtig ausgeführt: Über der eigentlichen Dachhaut liegt als Zerstäuberschicht ein dünnes Drahtnetz, das den Regen davon abhält, aufs Dach zu trommeln.
Eine ähnliche zweischichtige Lösung sollte nun auch im Residenzhof ausgeführt werden. Anders als in der Felsenreitschule braucht das Dach hier nicht beweglich zu sein, dafür muß es in wenigen Tagen auf- und wieder abgebaut werden können.
Für Klaus Kretschmer, der als Maschinenbauingenieur und technischer Direktor der Salzburger Festspiele die Überdachung des Residenzhofs zu konzipieren hatte, sind solche Aufgaben nichts Ungewöhnliches. Wer etwa bei der heurigen Inszenierung der „Zauberflöte“ einen Blick hinter die Bühne der Felsenreitschule werfen darf, wird dort eine weitgespannte Stahlkonstruktion zu sehen bekommen, von der das tonnenschwere hölzerne Zirkuszelt des Bühnenbilds abgehängt ist, das für den Zuschauer wie aus leichtem, bunt gestrichenem Pappendeckel aussieht.
Auch im Residenzhof spielte die Frage des Bühnenbilds eine gewisse Rolle. Immerhin war klar, daß als erste Produktion unter dem neuen Dach Mozarts „Entführung aus dem Serail“ zur Aufführung kommen würde. Die ersten Entwürfe Kretschmers glichen denn auch einem Zelt mit leicht orientalisierendem Anklang, das weit aus dem Hof herausgeragt hätte. Mit dieser Idee konnte sich die Altstadtkommission freilich ganz und gar nicht anfreunden: Eine Verfremdung der gewohnten Salzburger Silhouette wäre zwar eine schöne Visualisierung der Ära Mortier, aber unvereinbar mit dem Schutz des Altstadtbilds.
Auch der Statiker, der mit Kretschmer zusammenarbeitete, war mit der Idee des Großzelts nicht glücklich, freilich aus ganz anderen Gründen. Karlheinz Wagner, der für die Salzburger Festspiele alle Bühnenkonstruktionen prüft und sich auch sonst gern - etwa als Statiker für das Denkmal am Wiener Judenplatz und die Ausgrabungen darunter - mit ungewöhnlichen Aufgaben beschäftigt, hatte für das Dach eine viel simplere Lösung vor Augen, nämlich die Membranen an mehreren Hoch- und Tiefpunkten in die Fassade zu dübeln.
Diese formal und statisch interessante Lösung scheiterte allerdings an zwei Punkten: Einerseits wollte das Denkmalamt Veränderungen an der Fassade nur im kleinsten Umfang zulassen, andererseits waren für die Aufführungen zwei Beleuchtertribünen zu schaffen, die eine eigene Tragkonstruktion unabhängig vom Dach erfordert hätten. So entschied man sich schließlich für eine Lösung mit vier Stahlfachwerken, die als Saumträger für die beiden Membranen wirken. An den Längsseiten sind die Obergurte dieser Träger parabelförmig gekrümmt und erreichen in der Mitte eine Konstruktionshöhe von vier Metern. Seitlich bildet eine Folie aus transparentem Kunststoff, die das Fachwerk sichtbar läßt, den notwendigen Regenschutz, während die restliche Dachhaut aus einer vorgespannten, transluzenten Membran besteht. Das Gewicht des Dachs wird in den Ecken von vier zarten Stahlsäulen aufgenommen, deren obere Gelenkpunkte fast unmerklich an die massiven Mauern der Residenz angedübelt sind - die einzige direkte Verbindung der Konstruktion mit dem Altbau.
Eine ganz besondere Herausforderung ergab sich bei dieser Lösung in bezug auf den Brandschutz. Stahl ist zwar ein ideales Material, um große Spannweiten mit wenig Gewicht zu überbrücken, im Falle eines Brandes verliert er jedoch seine Tragfähigkeit schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Nach den geltenden österreichischen Normen hätte die gesamte Konstruktion mit einem zusätzlichen, teuren Schutzanstrich versehen werden müssen, um den Flammen, die bei einem Brand in der Residenz aus den Fenstern schlagen würden, standzuhalten. Karlheinz Wagner hatte das Glück, auf seiten der Baupolizei mit Josef Reyer ein beamtetes Gegenüber zu haben, das sich nicht - wie so oft - hinter Normen versteckte, sondern einer intelligenteren Lösung durchaus offen gegenüberstand: Wagner führte eine Berechnung durch, die genauer auf die zu erwartenden Brandlasten und die Geometrien der Fensteröffnung einging, und es gelang ihm so, den Anstrich auf ganz wenige neuralgische Punkte zu beschränken.
Daß diese Überdachung ästhetisch ansprechend und mit insgesamt nur 2,6 Millionen Schilling Nettobaukosten kommod im Preisrahmen errichtet werden konnte, ist also der Zusammenarbeit einer Reihe von Akteuren zu verdanken: einem Maschinenbauer mit Gefühl für szenische Wirkung, einem kreativen Statiker, einem innovationsfreundlichen Beamten und einer Reihe von weiteren Planern und Bauleuten bei den ausführenden Firmen.
Eine Profession fehlt freilich in dieser Liste: der Architekt. Das kann Zufall sein, vielleicht ist es aber auch symptomatisch. Fragt man beim Auftraggeber nach, dann meint der lapidar, daß eine zeitgerechte Fertigstellung mit einem Architekten wohl kaum möglich gewesen wäre. Und auch dessen Honorar wäre bei einer so konstruktiv determinierten Aufgabe wohl kaum im richtigen Verhältnis zur Leistung gestanden. Dieses Urteil entspricht einer verbreiteten Auffassung: Billiger und schneller baut sich's ohne Architekten.
Vielleicht ist dieses Urteil sogar richtig. Aber daß man dafür einen Preis bezahlt, das zeigt sich sogar hier im Residenzhof. Als Ingenieurleistung hat die Lösung höchste Qualität, und auch die akustischen und bühnentechnischen Bedingungen mögen fast ideal sein. Daß es aber doch grundsätzlich um die Schaffung eines festlichen Gesamtrahmens gegangen wäre - nicht nur um Dach und Bühne, sondern auch um Raum und Bewegung - , hätte einem Architekten nicht entgehen können.
Und so sind es Kleinigkeiten, die die Freude an dem neuen Spielort trüben: Die Vorgabe der Altstadtkommission, die Überdachung nicht über den Altbau ragen zu lassen, hätte ein Architekt wohl kaum widerspruchslos hingenommen. Das hätte vielleicht Zeit gekostet, aber schon eine Hebung um zwei Meter hätte dem Hofraum seine Proportion erhalten. Und ein Architekt hätte auch jene Momente eines Opernbesuchs besser berücksichtigt, die außerhalb der eigentlichen Vorführung liegen. Die Treppenaufgänge, der Raum unter der Tribüne, die Eingangssituation - all das funktioniert hier, aber es könnte mehr: eben seinen spezifisch architektonischen Beitrag zur Feststimmung leisten. Vielleicht kann man sich in den nächsten Jahren dazu entschließen, die geglückte Überdachung um eine gleichwertige Infrastruktur zu ergänzen.
Die wirkliche Beziehung zwischen den beiden Disziplinen ist freilich bei weitem nicht so simpel: Denn weder ist das Bauingenieurwesen eine exakte Wissenschaft, noch hat es je eine Architektur gegeben, die ihre Formen nicht auch aus dem Widerstand gegenüber dem Stofflichen abgeleitet hätte. Das Geheimnis der Ingenieurbaukunst besteht gerade darin, eine schlüssige Übereinstimmung zwischen konstruktivem Prinzip und formaler Durchbildung zu entwickeln, ohne einem der beiden Aspekte von vornherein Priorität einzuräumen. Die korrekte Berechnung ist dann nur ein nachgeordnetes, wenn auch nicht zu unterschätzendes Problem.
Die Überdachung des Hofs der alten Residenz in Salzburg ist ein gelungenes Beispiel für Ingenieurbaukunst in diesem Sinn. Die Aufgabenstellung erscheint auf den ersten Blick ganz simpel: Ein rechteckiger Hof, 24 mal 36 Meter im Geviert, soll für die Salzburger Festspiele in ein regensicheres „Opernhaus“ verwandelt werden. Schon in den fünfziger Jahren fanden hier Aufführungen statt, damals allerdings vor kleinerem Publikum. Als 1993 unter Gérard Mortier der Residenzhof als Spielstätte wiederentdeckt wurde, erhöhte man die Anzahl der Sitzplätze auf 800 und wich bei Regen ins Mozarteum aus.
Der Wunsch nach einer Überdachung ergab sich aus ökonomischen Überlegungen: Einerseits ist bei jeder Freiluftvorführung eine zweite Spielstätte als „Ausweichquartier“ blockiert, andererseits lassen sich Karten für eine Aufführung, die man unter Umständen nur konzertant erleben wird, nicht zum selben Preis verkaufen wie für andere Produktionen. Streng ökonomisch begründet war daher auch die Vorgabe für den Kostenrahmen: Das neue Dach sollte sich innerhalb von vier Jahren amortisieren und durfte daher nicht mehr als drei Millionen Schilling kosten.
Nun haben die Salzburger Festspiele mit der Überdachung von Spielstätten ja schon Erfahrung: Seit 1972 ist die Felsenreitschule mit einem flexiblen, auf Stahlseilen beweglichen Dach geschützt, das auch den stärksten Regenfällen trotzt. Um akustische Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist dieses Dach zweischichtig ausgeführt: Über der eigentlichen Dachhaut liegt als Zerstäuberschicht ein dünnes Drahtnetz, das den Regen davon abhält, aufs Dach zu trommeln.
Eine ähnliche zweischichtige Lösung sollte nun auch im Residenzhof ausgeführt werden. Anders als in der Felsenreitschule braucht das Dach hier nicht beweglich zu sein, dafür muß es in wenigen Tagen auf- und wieder abgebaut werden können.
Für Klaus Kretschmer, der als Maschinenbauingenieur und technischer Direktor der Salzburger Festspiele die Überdachung des Residenzhofs zu konzipieren hatte, sind solche Aufgaben nichts Ungewöhnliches. Wer etwa bei der heurigen Inszenierung der „Zauberflöte“ einen Blick hinter die Bühne der Felsenreitschule werfen darf, wird dort eine weitgespannte Stahlkonstruktion zu sehen bekommen, von der das tonnenschwere hölzerne Zirkuszelt des Bühnenbilds abgehängt ist, das für den Zuschauer wie aus leichtem, bunt gestrichenem Pappendeckel aussieht.
Auch im Residenzhof spielte die Frage des Bühnenbilds eine gewisse Rolle. Immerhin war klar, daß als erste Produktion unter dem neuen Dach Mozarts „Entführung aus dem Serail“ zur Aufführung kommen würde. Die ersten Entwürfe Kretschmers glichen denn auch einem Zelt mit leicht orientalisierendem Anklang, das weit aus dem Hof herausgeragt hätte. Mit dieser Idee konnte sich die Altstadtkommission freilich ganz und gar nicht anfreunden: Eine Verfremdung der gewohnten Salzburger Silhouette wäre zwar eine schöne Visualisierung der Ära Mortier, aber unvereinbar mit dem Schutz des Altstadtbilds.
Auch der Statiker, der mit Kretschmer zusammenarbeitete, war mit der Idee des Großzelts nicht glücklich, freilich aus ganz anderen Gründen. Karlheinz Wagner, der für die Salzburger Festspiele alle Bühnenkonstruktionen prüft und sich auch sonst gern - etwa als Statiker für das Denkmal am Wiener Judenplatz und die Ausgrabungen darunter - mit ungewöhnlichen Aufgaben beschäftigt, hatte für das Dach eine viel simplere Lösung vor Augen, nämlich die Membranen an mehreren Hoch- und Tiefpunkten in die Fassade zu dübeln.
Diese formal und statisch interessante Lösung scheiterte allerdings an zwei Punkten: Einerseits wollte das Denkmalamt Veränderungen an der Fassade nur im kleinsten Umfang zulassen, andererseits waren für die Aufführungen zwei Beleuchtertribünen zu schaffen, die eine eigene Tragkonstruktion unabhängig vom Dach erfordert hätten. So entschied man sich schließlich für eine Lösung mit vier Stahlfachwerken, die als Saumträger für die beiden Membranen wirken. An den Längsseiten sind die Obergurte dieser Träger parabelförmig gekrümmt und erreichen in der Mitte eine Konstruktionshöhe von vier Metern. Seitlich bildet eine Folie aus transparentem Kunststoff, die das Fachwerk sichtbar läßt, den notwendigen Regenschutz, während die restliche Dachhaut aus einer vorgespannten, transluzenten Membran besteht. Das Gewicht des Dachs wird in den Ecken von vier zarten Stahlsäulen aufgenommen, deren obere Gelenkpunkte fast unmerklich an die massiven Mauern der Residenz angedübelt sind - die einzige direkte Verbindung der Konstruktion mit dem Altbau.
Eine ganz besondere Herausforderung ergab sich bei dieser Lösung in bezug auf den Brandschutz. Stahl ist zwar ein ideales Material, um große Spannweiten mit wenig Gewicht zu überbrücken, im Falle eines Brandes verliert er jedoch seine Tragfähigkeit schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Nach den geltenden österreichischen Normen hätte die gesamte Konstruktion mit einem zusätzlichen, teuren Schutzanstrich versehen werden müssen, um den Flammen, die bei einem Brand in der Residenz aus den Fenstern schlagen würden, standzuhalten. Karlheinz Wagner hatte das Glück, auf seiten der Baupolizei mit Josef Reyer ein beamtetes Gegenüber zu haben, das sich nicht - wie so oft - hinter Normen versteckte, sondern einer intelligenteren Lösung durchaus offen gegenüberstand: Wagner führte eine Berechnung durch, die genauer auf die zu erwartenden Brandlasten und die Geometrien der Fensteröffnung einging, und es gelang ihm so, den Anstrich auf ganz wenige neuralgische Punkte zu beschränken.
Daß diese Überdachung ästhetisch ansprechend und mit insgesamt nur 2,6 Millionen Schilling Nettobaukosten kommod im Preisrahmen errichtet werden konnte, ist also der Zusammenarbeit einer Reihe von Akteuren zu verdanken: einem Maschinenbauer mit Gefühl für szenische Wirkung, einem kreativen Statiker, einem innovationsfreundlichen Beamten und einer Reihe von weiteren Planern und Bauleuten bei den ausführenden Firmen.
Eine Profession fehlt freilich in dieser Liste: der Architekt. Das kann Zufall sein, vielleicht ist es aber auch symptomatisch. Fragt man beim Auftraggeber nach, dann meint der lapidar, daß eine zeitgerechte Fertigstellung mit einem Architekten wohl kaum möglich gewesen wäre. Und auch dessen Honorar wäre bei einer so konstruktiv determinierten Aufgabe wohl kaum im richtigen Verhältnis zur Leistung gestanden. Dieses Urteil entspricht einer verbreiteten Auffassung: Billiger und schneller baut sich's ohne Architekten.
Vielleicht ist dieses Urteil sogar richtig. Aber daß man dafür einen Preis bezahlt, das zeigt sich sogar hier im Residenzhof. Als Ingenieurleistung hat die Lösung höchste Qualität, und auch die akustischen und bühnentechnischen Bedingungen mögen fast ideal sein. Daß es aber doch grundsätzlich um die Schaffung eines festlichen Gesamtrahmens gegangen wäre - nicht nur um Dach und Bühne, sondern auch um Raum und Bewegung - , hätte einem Architekten nicht entgehen können.
Und so sind es Kleinigkeiten, die die Freude an dem neuen Spielort trüben: Die Vorgabe der Altstadtkommission, die Überdachung nicht über den Altbau ragen zu lassen, hätte ein Architekt wohl kaum widerspruchslos hingenommen. Das hätte vielleicht Zeit gekostet, aber schon eine Hebung um zwei Meter hätte dem Hofraum seine Proportion erhalten. Und ein Architekt hätte auch jene Momente eines Opernbesuchs besser berücksichtigt, die außerhalb der eigentlichen Vorführung liegen. Die Treppenaufgänge, der Raum unter der Tribüne, die Eingangssituation - all das funktioniert hier, aber es könnte mehr: eben seinen spezifisch architektonischen Beitrag zur Feststimmung leisten. Vielleicht kann man sich in den nächsten Jahren dazu entschließen, die geglückte Überdachung um eine gleichwertige Infrastruktur zu ergänzen.
Für den Beitrag verantwortlich: Spectrum
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom
Akteure
ArchitekturBauherrschaft
Tragwerksplanung